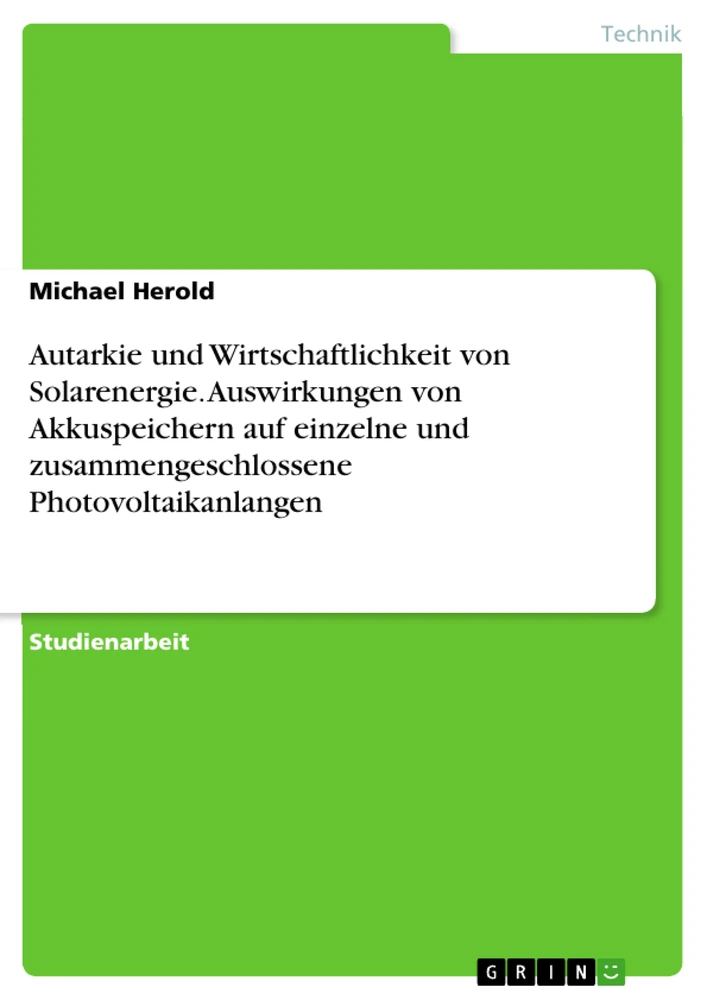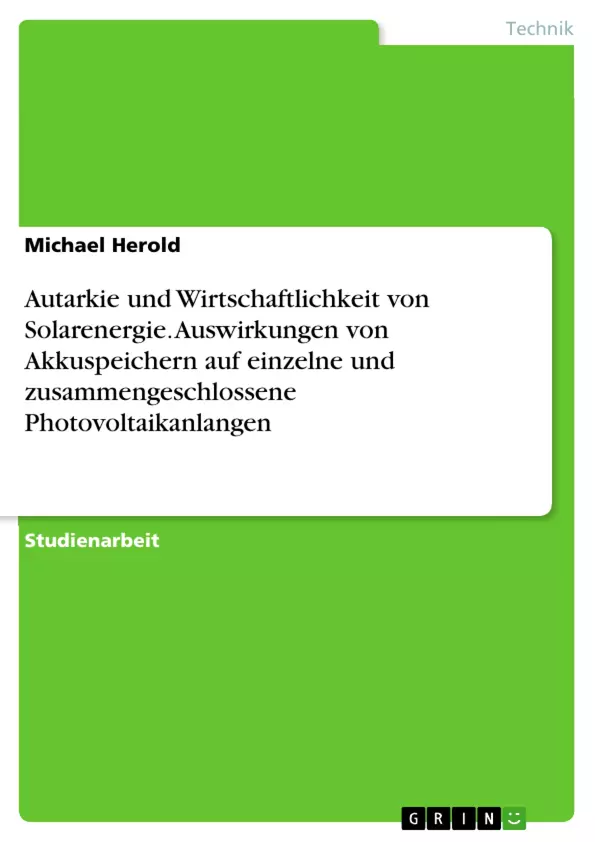Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, inwieweit einzelne Haushalte mit einer Photovoltaikanlage und einem dazugehörigen Speicher unabhängig von den zentralen Stromerzeugern sein können. Ergänzend soll der Stromeigenverbrauchsanteil bei einem Zusammenschluss von 100 Haushalten ermittelt werden. Zudem soll eine kurze Betrachtung der Wirtschaftlichkeit erfolgen.
In Zeiten der Energiewende, zunehmender Verknappung von fossilen Energieträgern und steigenden Strompreisen werden Photovoltaikanlagen, welche aus der Sonneneinstrahlung nutzbaren Strom erzeugen, immer attraktiver. Prinzipiell stellt sich für Eigentümer einer Photovoltaikanlage die Frage, ob es sinnvoller ist die erzeugte Energie selbst zu nutzen oder diese gegen einen Erlös in das Stromnetz einzuspeisen. In vielen Ländern erhält der Kunde eine wesentlich geringere Vergütung für die Einspeisung, als er für den Bezug zahlen muss.
Dieser Umstand legt eine Eigennutzung des generierten Stroms nahe. Die Nutzung des eigenen Stroms ist auch ohne Energiespeicher möglich. Da jedoch der Prozess der Energiegewinnung bei PV-Anlagen sehr wetter- und tages-zeitabhängig ist, kann ohne eine Speicherung nur ein geringer Teil der Energie selbst verwendet werden. Speziell am Beispiel eines durchschnittlichen, in Vollzeit arbeiten-den Haushalts wird dieser Effekt deutlich. Während der sonnenreichsten Zeit tagsüber sind die Bewohner des Hauses auf Arbeit und verbrauchen somit nicht mehr als die Grundlast. In den Verbrauchsspitzenzeiten früh vor der Arbeit und nach Feierabend sind die PV-Erträge nur noch gering. Den Anteil der Eigennutzung könnte man durch einen passenden Speicher entscheidend erhöhen. Problematisch ist jedoch, dass das Speichern von Strom bis jetzt relativ aufwändig und durch die teuren Akkus kostenintensiv und wenig rentabel war.
Jedoch hat sich die Situation in den letzten Jahren zunehmend verändert, da die Preise für Batterien, als auch für PV-Anlagen drastisch gesunken, während im Gegenzug die Kosten für Strom gestiegen sowie die Vergütungen für eingespeisten Strom gesunken sind. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass Energiespeicher, falls diese eine ausreichende Deckung des Bedarfs garantieren können sowie bezahlbar bleiben, eine attraktive Ergänzung zur Einspeisung der Energie ins Stromnetz der großen Anbieter darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Einsetzbare Komponenten
- 2.1.1 PV-Module
- 2.1.2 Akkumulatoren
- 2.2 Preisentwicklung der Komponenten
- 2.2.1 PV-Module
- 2.2.2 Akkumulatoren
- 3. Entwicklung des Forschungsmodells
- 3.1 Bereitgestellte Daten
- 3.1.1 Haushalte
- 3.1.2 Sonneneinstrahlung
- 3.2 Datenauswertung
- 4. Ergebnisse der Datenauswertung
- 4.1 Einzelne Haushalte
- 4.1.1 Autarkiegrad
- 4.1.2 Nutzbarkeit der PV-Energie
- 4.1.3 Wirtschaftlichkeit
- 4.2 Zusammenschluss von 100 Haushalten
- 4.2.1 Autarkiegrad
- 4.2.2 Nutzbarkeit der PV-Energie
- 4.2.3 Wirtschaftlichkeit
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, inwieweit einzelne Haushalte mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern unabhängig von zentralen Stromerzeugern werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Erreichung von Autarkie und der Wirtschaftlichkeit dieser Konzepte. Zusätzlich wird der Stromeigenverbrauchsanteil bei einem Zusammenschluss von 100 Haushalten ermittelt.
- Autarkiegrad von einzelnen Haushalten mit PV-Anlagen und Batteriespeichern
- Nutzbarkeit der PV-Energie in einzelnen Haushalten
- Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen mit Batteriespeichern für einzelne Haushalte
- Autarkiegrad von 100 zusammengeschlossenen Haushalten mit PV-Anlagen und Batteriespeichern
- Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen mit Batteriespeichern im Kontext eines Zusammenschlusses von Haushalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit beleuchtet den wachsenden Stellenwert von Photovoltaikanlagen im Kontext der Energiewende und der steigenden Strompreise. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob es für Eigenheimbesitzer sinnvoller ist, die erzeugte Energie selbst zu nutzen oder ins Stromnetz einzuspeisen. Die Abhängigkeit von Wetter- und Tageszeitbedingungen bei der Energiegewinnung durch PV-Anlagen sowie die Problematik der Stromspeicherung werden erläutert. Die Entwicklung der Preise für Batterien und PV-Anlagen in den letzten Jahren und deren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Energiespeichern werden ebenfalls diskutiert.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel behandelt die wichtigsten Komponenten von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern. Es beleuchtet die Preisentwicklung dieser Komponenten und analysiert deren Einfluss auf die Rentabilität von Energiespeichern.
- Kapitel 3: Entwicklung des Forschungsmodells: Hier wird das Forschungsmodell vorgestellt, das zur Analyse der Autarkie und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern verwendet wird. Es werden die Datenquellen und die Datenauswertungsmethodik beschrieben.
- Kapitel 4: Ergebnisse der Datenauswertung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenauswertung präsentiert. Zuerst wird der Autarkiegrad, die Nutzbarkeit der PV-Energie und die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen mit Batteriespeichern für einzelne Haushalte untersucht. Anschließend werden diese Aspekte für einen Zusammenschluss von 100 Haushalten betrachtet.
- Kapitel 5: Diskussion der Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenauswertung diskutiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Autarkie, Wirtschaftlichkeit, Stromeigenverbrauch, Energiespeicher, PV-Module, Akkumulatoren, Lastprofile, Energiewende, Stromnetz, Einspeisung, Strompreise.
Häufig gestellte Fragen
Kann man mit einer Photovoltaikanlage komplett autark werden?
Die Arbeit untersucht den Autarkiegrad und zeigt, dass Batterien die Unabhängigkeit deutlich erhöhen, eine vollständige Autarkie aber komplex ist.
Lohnt sich ein Batteriespeicher wirtschaftlich?
Durch sinkende Batteriepreise und steigende Stromkosten wird die Speicherung für den Eigenverbrauch zunehmend attraktiver als die Einspeisung.
Was ist der Vorteil eines Zusammenschlusses von Haushalten?
Ein Verbund (z.B. 100 Haushalte) kann Lastspitzen besser ausgleichen und den gemeinschaftlichen Eigenverbrauchsanteil optimieren.
Warum ist Eigenverbrauch besser als Einspeisung?
Da die Einspeisevergütung oft niedriger ist als der Preis für den Bezug von Strom vom Anbieter, spart selbst genutzter Strom direkt Geld.
Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Autarkie?
Da PV-Erträge tages- und jahreszeitabhängig sind, garantieren Speicher eine bessere Abdeckung während der Abendstunden oder an bewölkten Tagen.
- Quote paper
- Michael Herold (Author), 2015, Autarkie und Wirtschaftlichkeit von Solarenergie. Auswirkungen von Akkuspeichern auf einzelne und zusammengeschlossene Photovoltaikanlangen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308701