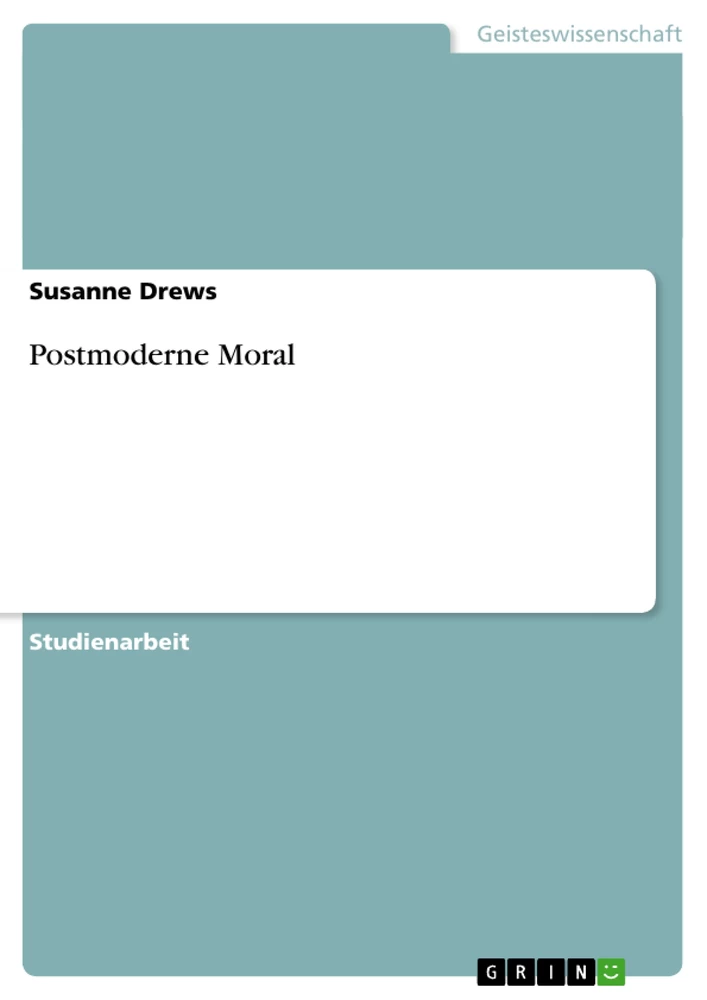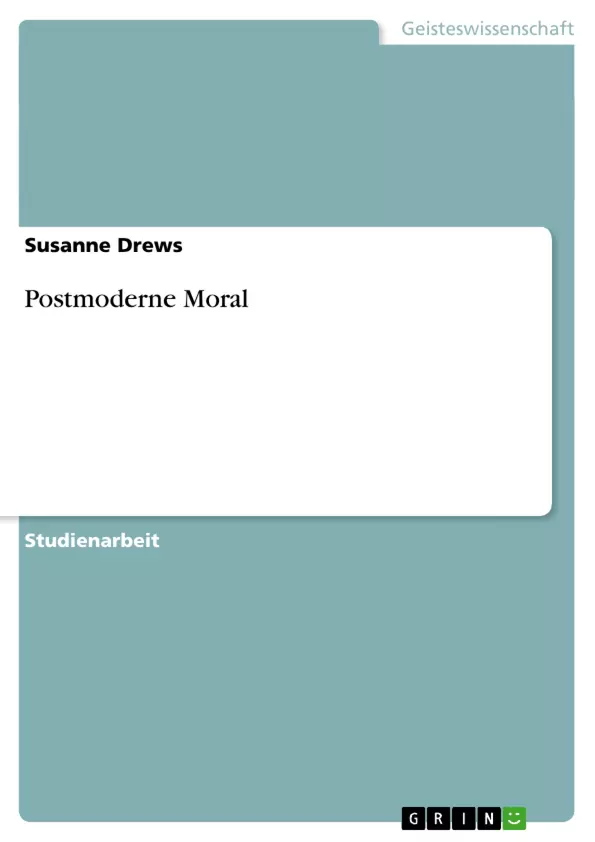Diese Hausarbeit soll sich mit dem Gesellschaftsbegriff der Postmodernen Gesellschaft unter dem Aspekt der postmodernen Moral beschäftigen. Es wird aber trotzdem nur bei einem kleinen Exkurs in die Postmoderne – Debatte bleiben, da der Begriff in fast allen Wissenschafts- und Lebensbereichen auftaucht und es somit zu weit führen würde, auf alle diese Bereiche einzugehen. Somit beschränkt sich diese Arbeit auf einige wichtige Vertreter und Schlüsselbegriffe der Postmoderne, genauer untersucht wird dabei der Aspekt der postmodernen Moral bei Zygmunt Bauman.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Ausdruck „Postmoderne“
- Postmoderne als Problematik
- Pluralität
- Differenzierung sozialer Ungleichheiten
- Wertproblematik
- Ein Prophet der Postmoderne - J.F. -Lyotard
- Zum Begriff „Moral“
- Plädoyer für postmoderne Moral -Z.Bauman
- Postmoderne moralische Krise
- Die Unordnung aushalten
- Postmoderne Einsicht
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Gesellschaftsbegriff der Postmodernen Gesellschaft unter dem Aspekt der postmodernen Moral. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Postmoderne und seiner Relevanz in verschiedenen Lebensbereichen. Dabei wird insbesondere die postmoderne Moral im Kontext von Zygmunt Bauman analysiert.
- Die Bedeutung des Begriffs „Postmoderne“ in verschiedenen Wissenschafts- und Lebensbereichen
- Die Pluralität als Schlüsselbegriff der Postmoderne und ihre Auswirkungen auf das Alltagsleben
- Die Problematik der postmodernen Moral und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Herausforderungen der postmodernen Moral und ihre Auswirkungen auf den Einzelnen
- Die Relevanz von Zygmunt Bauman für die Analyse der postmodernen Moral
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung und den Fokus auf die postmoderne Moral im Kontext der postmodernen Gesellschaft. Die Arbeit beschränkt sich auf einen kleinen Exkurs in die Postmoderne-Debatte, da der Begriff in vielen Bereichen auftaucht und eine umfassende Behandlung zu weit führen würde.
Zum Ausdruck „Postmoderne“
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Verwendung des Begriffs „Postmoderne“. Der Ausdruck soll anzeigen, dass wir nicht mehr in der Moderne, sondern in einer Zeit nach der Moderne leben. Der Ursprung der Postmoderne wird in den künstlerischen und politischen Umbrüchen der 1960er Jahre in den USA gesehen. Der Begriff wurde von verschiedenen Autoren wie Rudolf Pannwitz und Federico de Oniz in unterschiedlichen Kontexten verwendet.
Postmoderne als Problematik
Dieses Kapitel widmet sich der Problematik des Begriffs „Postmoderne“. Es wird argumentiert, dass eine rein postmoderne Zeit nicht existiert, da vormoderne, moderne und postmoderne Strömungen in der heutigen Gesellschaft koexistieren. Die Postmoderne wird als ein Wandlungsprozess betrachtet, der verschiedene Bereiche betrifft.
Pluralität
Der Schlüsselbegriff der Postmoderne ist die Pluralität. Sie beeinflusst unser Alltagsleben, Denken und Fühlen. Die Pluralität wurde schon von der Moderne entdeckt, ist in der Postmoderne jedoch vielfältiger und einschneidender geworden. Es gibt keine Gesamtdeutung mehr, sondern eine Vielzahl von Denkformen und Lebensformen. Die postmoderne Pluralität ist durch eine Mehrzahl unvereinbarer Maßstäbe und eine zunehmende Trennung im gesellschaftlichen Feld gekennzeichnet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Hausarbeit sind Postmoderne, Moral, Gesellschaft, Pluralität, Differenzierung sozialer Ungleichheiten, Wertproblematik, Zygmunt Bauman, und die Problematik der postmodernen Moral.
- Quote paper
- Susanne Drews (Author), 2002, Postmoderne Moral, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30887