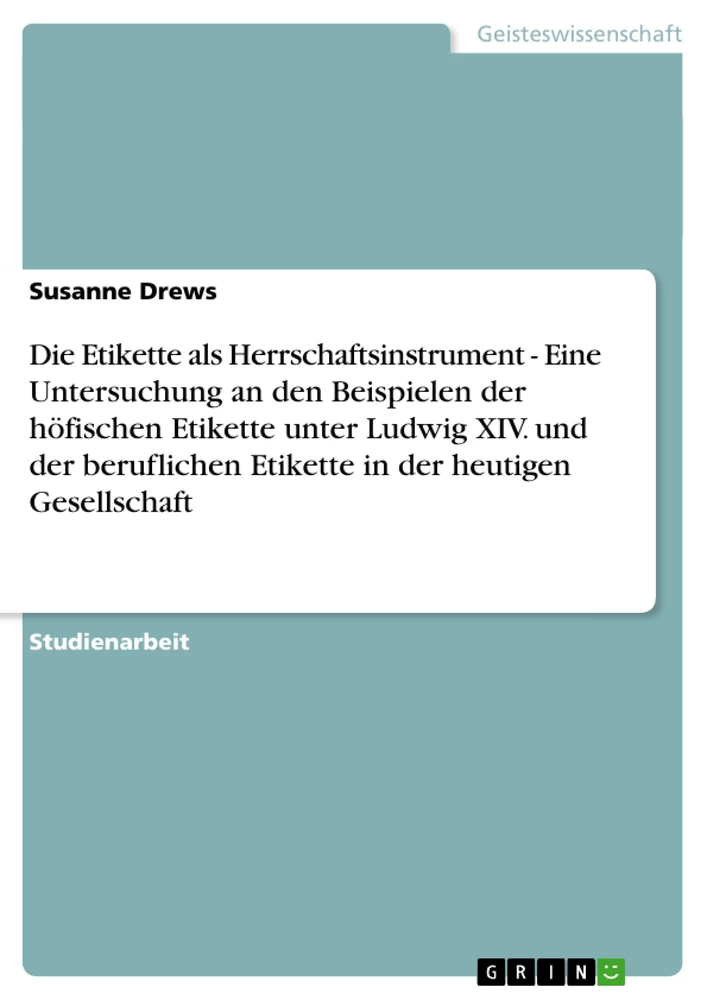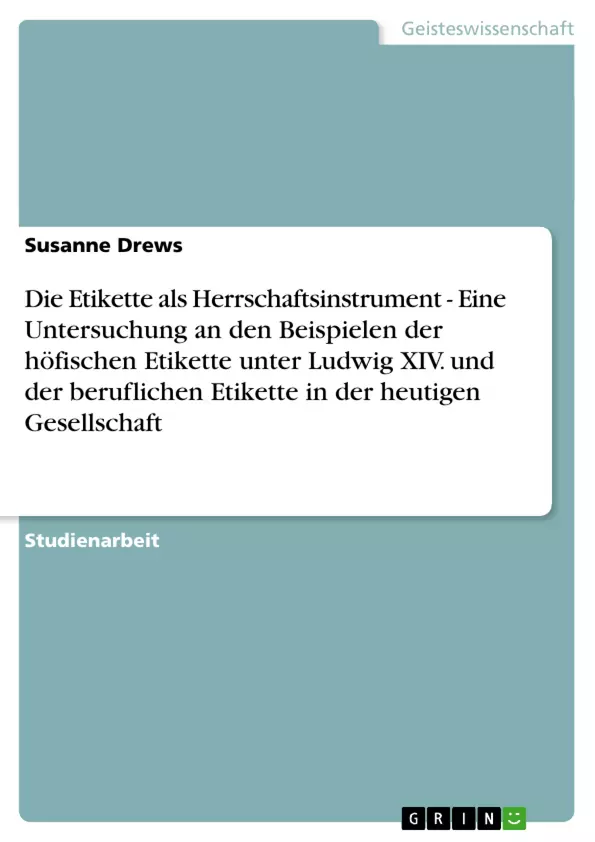In seinem Hauptwerk „ Über den Prozeß der Zivilisation“ veranschaulicht Norbert Elias den „ langfristigen Prozeß der Veränderung der Außenzwänge in Selbstzwänge“.1 Schon in seiner Studienzeit interessierte ihn die Frage, wieso sich Aristokraten einem höfischen Ritual beugen, das sie bei aller Zivilisiertheit bestimmten Zwängen unterwirft.2. Dazu brauchte er natürlich Material, das diese Frage klären sollte, das heißt, das diesen langfristigen Prozess der Umwandlung von Fremdzwängen in Selbstzwängen veranschaulicht und dies fand er in den Manierenbüchern. Denn genau dort werden die Veränderungen der Verhaltensregeln dokumentiert. Wichtig war dabei für ihn nicht die Veränderung des Benimmstandarts, sondern warum sich diese änderten, denn darin konnte er die Veränderung von Peinlichkeits- und Schamgrenzen und somit die Triebregulierung der Affekte und Gefühle sichtbar machen.3 Unter Ludwig XIV. war es zum Beispiel verpönt, Speisen mit der Gabel zu essen.4 Und deshalb verbot er dies auch jedem Höfling, der die Ehre hatte, in Anwesenheit des Königs zu essen. Für uns heute ist es unvorstellbar, nicht mit der Gabel zu essen. Sie nicht zu benutzen und mit den Fingern zu essen kommt uns unerzogen vor. Der Grund dafür ist, dass wir meinen, dies sei unhygienisch und unappetitlich. Elias sagt, dass dies Gründe sind, die in die Kategorie Peinlichkeitsgefühl und Scham gehören und es ist die Entstehung dieser Affektkontrollen, für die die Einführung der Gabel ein Beispiel ist. Um den Prozess der Zivilisation zu veranschaulichen ist es daher sehr wichtig zu zeigen, wie sich die Zivilisierung der Sitten der höfischen Menschen langsam in der gesamten Gesellschaft verfestigt haben, denn heutzutage handelt es sich bei diesen Sitten um festgefahrene Standarts. Für uns besteht kein Fremdzwang mehr, er ist zum Selbstzwang geworden, was ja, wie vorher schon bemerkt den Zivilisationsprozess auszeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Wieso legte Norbert Elias so viel Wert auf die Untersuchung der höfischen Etikette:
- Gesellschaftliche Normen und Etikette
- Hauptteil
- Was gehörte für Ludwig XIV. zur Etikette?
- Wieso hielten sich die Adligen so strikt an die Etikette?
- Wieso war für Ludwig XIV. die Einhaltung der Etikette so von Bedeutung?
- Warum elementare Manieren und eine gewisse Etikette auch heute noch entscheidend sind:
- Schlußwort:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung von Etikette als Herrschaftsinstrument anhand der Beispiele der höfischen Etikette unter Ludwig XIV. und der beruflichen Etikette in der heutigen Gesellschaft. Sie analysiert, wie Etikette zur Kontrolle und Festigung von Macht und sozialen Strukturen genutzt wurde und noch heute genutzt wird.
- Die Rolle von Etikette als Mittel der sozialen Kontrolle und Machtdemonstration
- Die Entwicklung von Verhaltensnormen und ihre Verfestigung in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Etikette für die soziale Ordnung und das gesellschaftliche Zusammenleben
- Die Veränderung von Etikette im Wandel der Zeit
- Die Relevanz von Etikette in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
In diesem einleitenden Kapitel wird der Fokus auf die Bedeutung der höfischen Etikette für Norbert Elias' Werk „Über den Prozeß der Zivilisation“ gelegt. Elias erkannte in den Manierenbüchern der höfischen Gesellschaft einen Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung von Verhaltensnormen und der Verfestigung von Selbstzwängen im Laufe der Zeit.
Gesellschaftliche Normen und Etikette
Das Kapitel beleuchtet die Rolle von Etikette als Teil gesellschaftlicher Normen. Es wird argumentiert, dass Normen zur Reduktion von Reibung und Konflikten in der Gesellschaft beitragen und dass Etikette eine wichtige Rolle in der Regulierung von Verhalten und in der Vorhersagbarkeit von Interaktionen spielt.
Was gehörte für Ludwig XIV. zur Etikette?
Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Analyse der Etikette am Hofe Ludwigs XIV. Es wird gezeigt, wie Ludwig XIV. durch die Einführung strikter Verhaltensregeln in allen Lebensbereichen nicht nur die Macht und Kontrolle am Hofe festigte, sondern auch seine eigene Stellung hervorhob.
Wieso hielten sich die Adligen so strikt an die Etikette?
Das Kapitel beleuchtet die Gründe für die strikte Einhaltung der Etikette durch die Adligen am Hofe Ludwigs XIV. Es wird darauf eingegangen, dass die Einhaltung der Etikette nicht nur zur Vermeidung von gesellschaftlicher Ächtung und zur Sicherung des sozialen Status diente, sondern auch eine Form von Selbstkontrolle und Selbsterziehung darstellte.
Wieso war für Ludwig XIV. die Einhaltung der Etikette so von Bedeutung?
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Etikette für Ludwig XIV. aus der Perspektive der Macht und Kontrolle betrachtet. Es wird deutlich, dass die Einhaltung der Etikette nicht nur die soziale Ordnung festigte, sondern auch eine Form von Selbstgewissheit und Kontrolle über die eigene Umgebung ermöglichte.
Schlüsselwörter
Etikette, höfische Gesellschaft, Macht, Kontrolle, soziale Normen, Selbstzwänge, Zivilisation, Ludwig XIV., Verhalten, gesellschaftliche Ordnung, Manieren, Tradition, Geschichte, Soziologie.
- Citation du texte
- Susanne Drews (Auteur), 2002, Die Etikette als Herrschaftsinstrument - Eine Untersuchung an den Beispielen der höfischen Etikette unter Ludwig XIV. und der beruflichen Etikette in der heutigen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30888