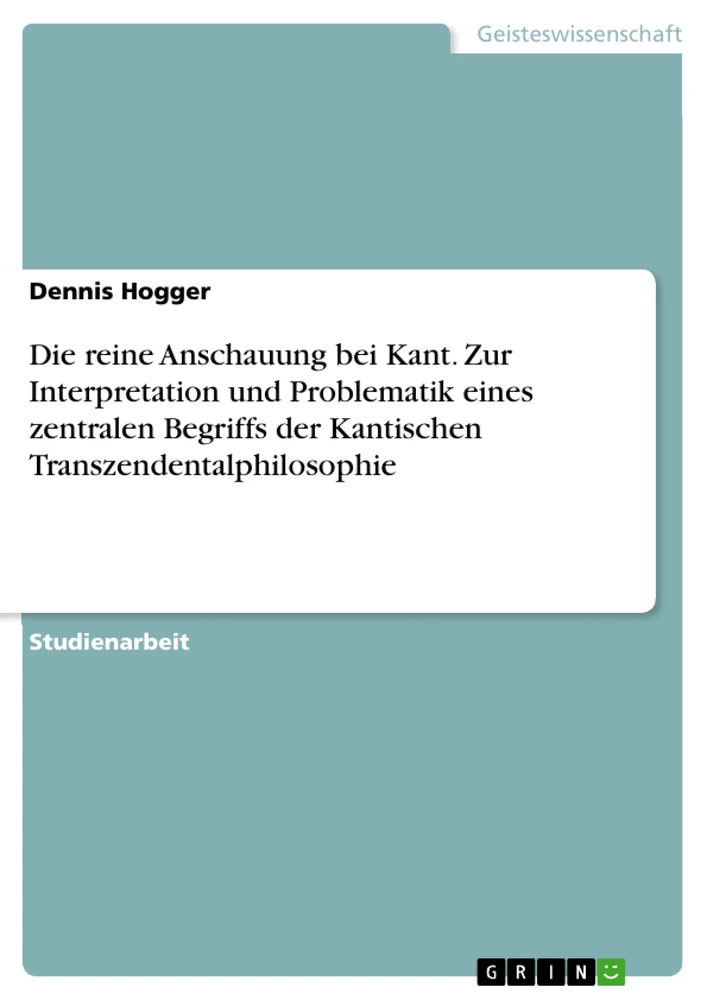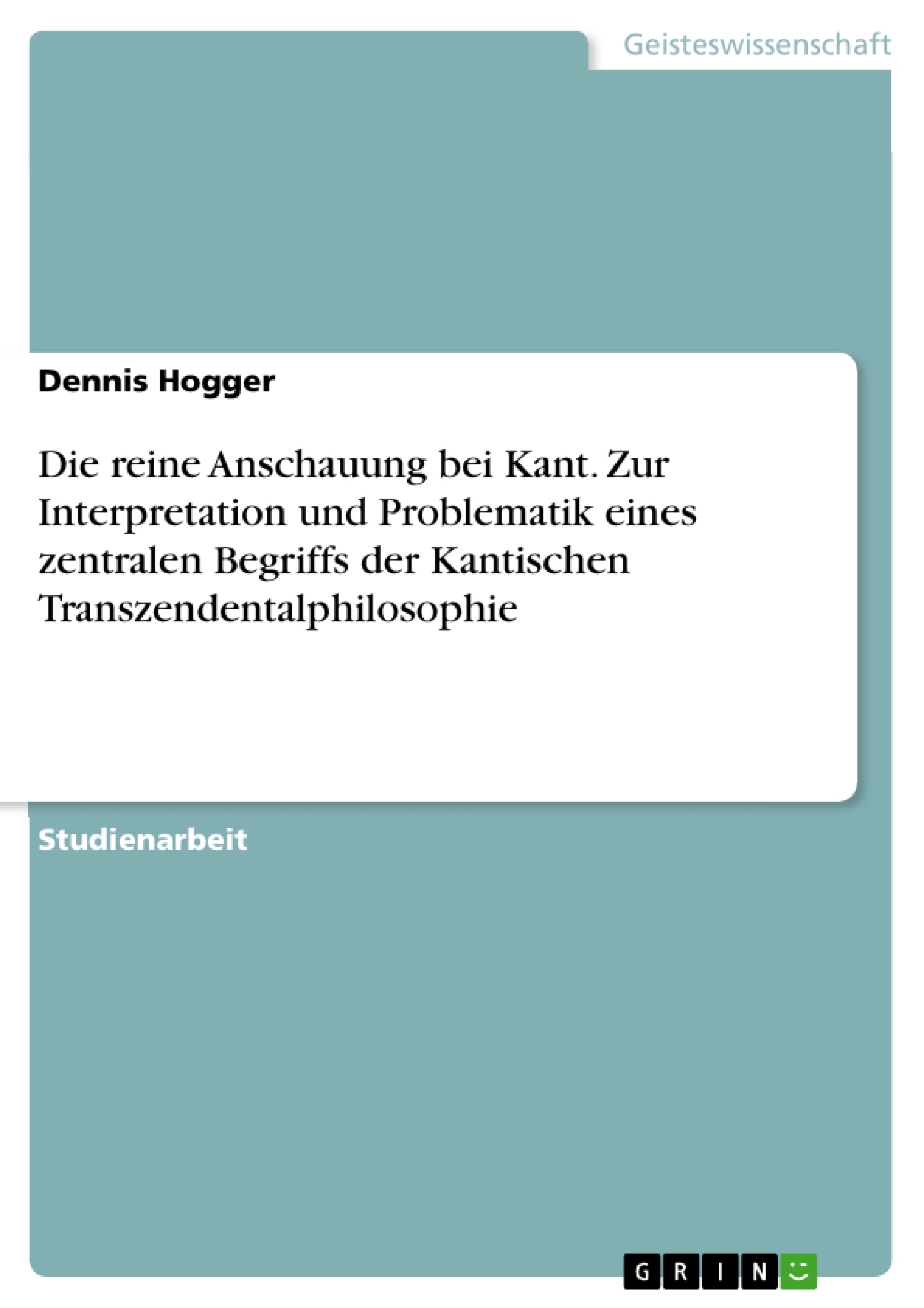Es ist eine aus der Schulmathematik bekannte Tatsache, dass man aus drei beliebigen Angaben über ein Dreieck – seien es Längenangaben, Winkel oder der Flächeninhalt – (fast) alle anderen Maße berechnen kann. Philosophisch ist daran zunächst nichts erstaunlich. Anders ist es, wenn man diese Berechnung an einem beliebigen dreieckigen Objekt in der realen Welt anstellt. Man kann durch reines Denken die meisten Maße eines realen Dreiecks berechnen, wenn man nur drei Maße nachgemessen hat. Die angewandten Berechnungsmethoden sind nicht durch Induktion erworben, sondern Teil eines rein apriorischen, auf Axiomen beruhenden mathematischen Systems, das völlig unabhängig von der Außenwelt erkannt und angewandt werden kann. Wie kann man mit reinem Denken völlig sichere und notwendige Aussagen über die Außenwelt treffen? Dies ist eine Frage, die durchaus philosophische Reflexion zulässt oder sogar erfordert.
Immanuel Kant hat dieses Problem gesehen und in dem Abschnitt über die Transzendentale Ästhetik in seinem Hauptwerk, der Kritik der reinen Vernunft, eine Lösung vorgeschlagen. Der Raum, auf dessen Anschauung die geometrischen Grundsätze beruhen, ist in Kants Augen, neben der Zeit, eine reine Anschauungsform. Wie der Begriff schon andeutet, steht die reine Anschauung zwischen dem reinen, apriorischen Verstand, und dem Empirischen, dem anschaulich Gegebenen; sie ist, in den Worten von Clemens Thaer, „nicht Verstand und nicht volle Sinnlichkeit“. Der Raum ist nichts den Dingen an sich Anhängendes, sondern liegt in uns, und dient zur Strukturierung und Ordnung der Sinneswahrnehmungen. Zugleich ist der Raum die Grundlage der geometrischen Grundsätze. Durch diese Mittlerposition des Raumes ist es verständlich, wie aus reinem Denken gewonnene geometrische Sätze auf die Außenwelt anwendbar sind, und dabei auch noch zu notwendig sicheren Ergebnissen führen.
Die Frage ist, ob der Begriff der reinen Anschauung an sich schlüssig ist. Wie begründet Kant die Möglichkeit eines solchen Konzepts, das ja auf den ersten Blick als Paradoxie erscheint? Und welche Probleme ergeben sich bei genauerer Analyse seiner Argumente? Das sind die Fragen, denen in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll. Selbstverständlich kann dabei nicht einmal im Ansatz Vollständigkeit angestrebt werden, deshalb soll sich lediglich auf einige Einzelprobleme konzentriert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Fundierung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“
- 3. Reine Anschauung - ein Widerspruch in sich?
- 4. Die Apriorität des Raumes
- 5. Der Anschauungcharakter des Raumes
- 6. Die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori in der Geometrie
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kants Konzept der reinen Anschauung, insbesondere im Kontext seiner Transzendentalen Ästhetik. Es wird analysiert, wie Kant die Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“ begründet und welche Probleme sich bei einer genaueren Betrachtung seiner Argumente ergeben. Der Fokus liegt auf der Schlüssigkeit des Konzepts der reinen Anschauung selbst und der Frage, ob es sich dabei um einen Widerspruch handelt.
- Begründung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“ bei Kant
- Analyse des Begriffs „reine Anschauung“ als möglicher Widerspruch
- Kants Argumentation zur Apriorität des Raumes
- Der Anschauungcharakter des Raumes und seine Bedeutung für geometrische Urteile
- Synthetische Urteile a priori in der Geometrie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie das Problem der Anwendbarkeit apriorischer mathematischer Sätze auf die reale Welt beschreibt. Sie stellt die Frage, wie reines Denken sichere Aussagen über die Außenwelt ermöglichen kann und führt Kants Konzept der reinen Anschauung als mögliche Lösung ein. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Schlüssigkeit dieses Konzepts und die damit verbundenen Probleme an.
2. Die Fundierung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“: Dieses Kapitel analysiert Kants Argumentation zur Einführung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“ in der Transzendentalen Ästhetik. Es wird gezeigt, wie Kant die Apriorität der Anschauungsformen begründet, und die Schwächen dieser Begründung werden aufgezeigt. Die Kritik konzentriert sich auf die unbewiesenen Prämissen und die mangelnde Klarheit in Kants Argumentation. Das Kapitel diskutiert auch die weitreichenden Implikationen der Unterscheidung von Form und Materie der Erscheinung und den damit verbundenen Abstraktionsprozess, der zur Herausarbeitung der reinen Anschauungsformen führt.
3. Reine Anschauung - ein Widerspruch in sich?: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der „reinen Anschauung“ auf mögliche Widersprüche. Es analysiert die Einzelbegriffe „rein“/„a priori“ und „Anschauung“ und diskutiert verschiedene Interpretationen, die versuchen, den scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Die Meinungsverschiedenheiten verschiedener Interpreten wie Vaihinger und Willaschek werden vorgestellt und kritisch bewertet. Die Frage, ob reine Anschauungen die Bedingungen von Anschauung im Allgemeinen erfüllen, wird ausführlich diskutiert.
Schlüsselwörter
Reine Anschauung, Anschauungsform, Immanuel Kant, Transzendentale Ästhetik, Apriorität, Raum, Zeit, Synthetische Urteile a priori, Geometrie, Empirische Anschauung, Erscheinung, Empfindung, Transzendentaler Idealismus.
Häufig gestellte Fragen zu: Kants Konzept der reinen Anschauung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Immanuel Kants Konzept der reinen Anschauung, insbesondere im Kontext seiner Transzendentalen Ästhetik. Der Fokus liegt auf der Begründung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“, der Untersuchung möglicher Widersprüche in diesem Konzept und der Rolle der reinen Anschauung für synthetische Urteile a priori in der Geometrie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Fundierung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“ bei Kant, analysiert den Begriff „reine Anschauung“ auf mögliche Widersprüche, untersucht Kants Argumentation zur Apriorität des Raumes, beleuchtet den Anschauungcharakter des Raumes und seine Bedeutung für geometrische Urteile und diskutiert schließlich synthetische Urteile a priori in der Geometrie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt das Problem der Anwendbarkeit apriorischer mathematischer Sätze auf die reale Welt vor. Kapitel 2 analysiert Kants Argumentation zur Einführung der Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“. Kapitel 3 untersucht den Begriff der „reinen Anschauung“ auf mögliche Widersprüche. Die Kapitel 4, 5 und 6 befassen sich mit der Apriorität des Raumes, seinem Anschauungcharakter und der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori in der Geometrie. Kapitel 7 bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Reine Anschauung, Anschauungsform, Immanuel Kant, Transzendentale Ästhetik, Apriorität, Raum, Zeit, Synthetische Urteile a priori, Geometrie, Empirische Anschauung, Erscheinung, Empfindung, Transzendentaler Idealismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Schlüssigkeit von Kants Konzept der reinen Anschauung und die damit verbundenen Probleme. Sie analysiert, wie Kant die Begriffe „Anschauungsform“ und „reine Anschauung“ begründet und welche Schwierigkeiten sich bei einer genaueren Betrachtung seiner Argumente ergeben. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob das Konzept der reinen Anschauung einen Widerspruch darstellt.
Werden unterschiedliche Interpretationen des Begriffs „reine Anschauung“ diskutiert?
Ja, die Arbeit diskutiert verschiedene Interpretationen des Begriffs „reine Anschauung“ und berücksichtigt dabei Meinungsverschiedenheiten verschiedener Interpreten wie Vaihinger und Willaschek. Es wird kritisch bewertet, ob reine Anschauungen die Bedingungen von Anschauung im Allgemeinen erfüllen.
Wie wird die Apriorität des Raumes behandelt?
Die Arbeit untersucht Kants Argumentation zur Apriorität des Raumes und analysiert seine Bedeutung für die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori in der Geometrie. Der Anschauungcharakter des Raumes und seine Rolle für geometrische Urteile werden ausführlich erörtert.
- Arbeit zitieren
- Dennis Hogger (Autor:in), 2015, Die reine Anschauung bei Kant. Zur Interpretation und Problematik eines zentralen Begriffs der Kantischen Transzendentalphilosophie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308905