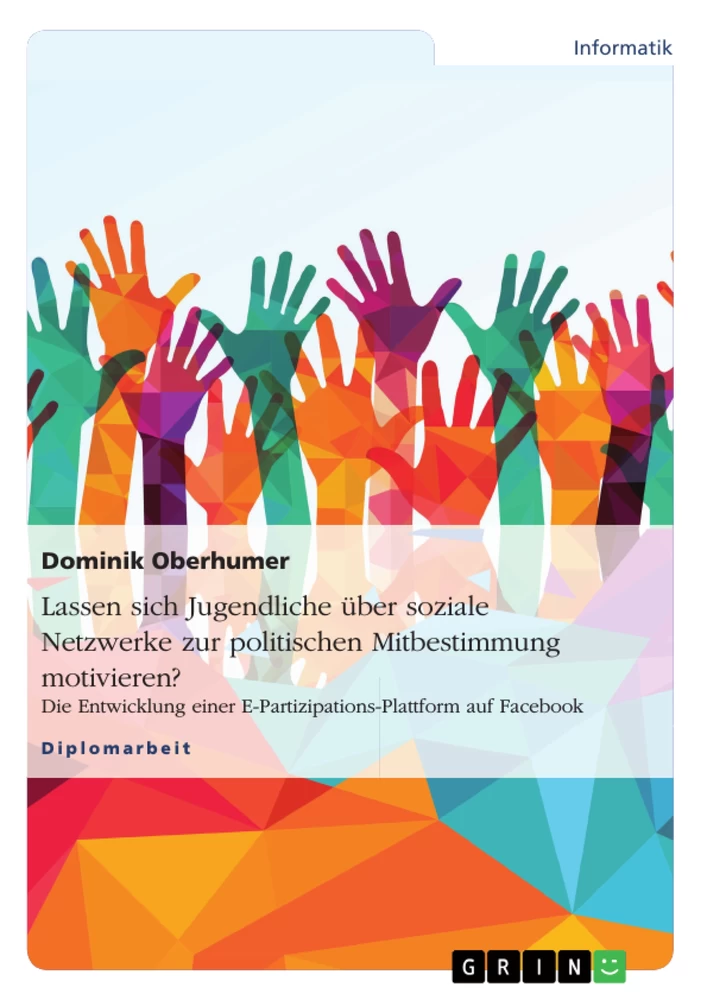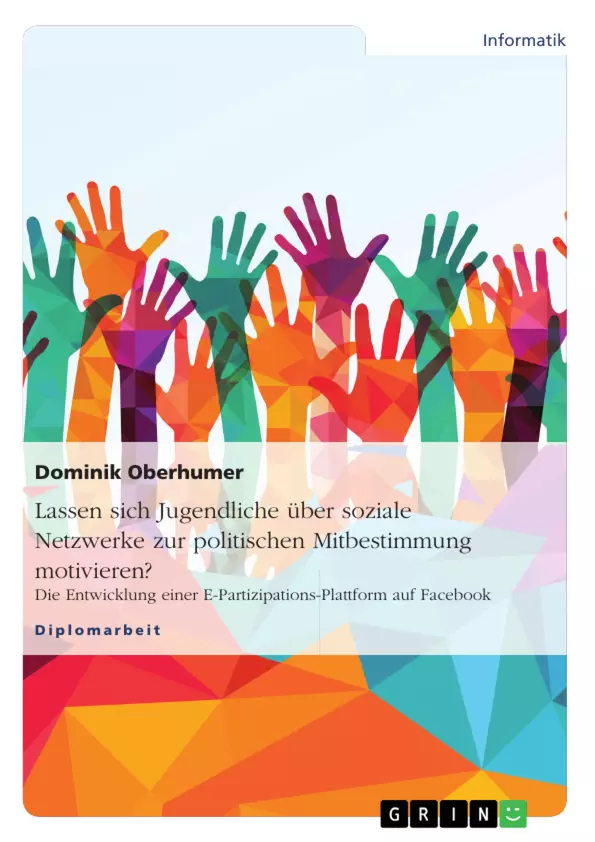Die Beteiligung an traditionellen demokratischen Prozessen, vor allem an Wahlen, nimmt stetig ab. Besonders bei jungen Personen ist eine Änderung im politischen Verständnis erkennbar. Um auch vermehrt Jugendliche zur Ausübung ihres demokratischen Grundrechts zu wählen zu motivieren, wird untersucht, inwieweit die Einbindung von modernen sozialen Medien die Wahlbeteiligung wieder erhöhen könnte.
Diese Arbeit untersucht im Besonderen, wie eine E-Partizipationsplattform in das soziale Netzwerk Facebook integriert werden kann. Dadurch können verschiedene Aspekte des Netzwerkes auch für die Plattform verwendet werden. Besonders deutlich ist dies beim Nutzerkonto, welches ident mit jenem von Facebook sein sollte. Ein besonderer Fokus liegt in dieser Arbeit auf der Fragestellung nach der Anwendbarkeit der Integration. Dazu wurde in dieser Arbeit zuerst theoretisches Grundwissen gesammelt und Beispielanwendungen aus den Domänen der sozialen Netzwerke und der E-Partizipation vorgestellt. Es wurden drei mögliche Szenarien für die E-Partizipation erarbeitet und verschiedene Integrationsmöglichkeiten diskutiert. Ein konkretes Fallbeispiel wurde prototypisch umgesetzt. Dieser Prototyp stellt eine einfache Partizipationsanwendung dar, welche sehr tiefgehend in das soziale Netzwerk integriert wurde.
Zum Abschluss wird der Prototyp in diversen Fragestellungen diskutiert. Diese Arbeit dient als Basis für eine kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Integration und vermittelt, unter welchen Bedingungen diese anwendbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Zielsetzung
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 Partizipationstheorie
- 2.1 E‐Demokratie
- 2.1.1 Der demokratische Prozess
- 2.1.2 Wahlgrundsätze
- 2.1.3 Das E‐Demokratie‐Framework
- 2.2 E‐Partizipation
- 2.2.1 Anwendbarkeit der E‐Partizipation
- 2.2.1 Vorteile der E‐Partizipation
- 2.2.2 Nachteile der E‐Partizipation
- 2.2.3 Einflussgrößen auf E‐Partizipation
- 2.2.4 Level der E‐Partizipation
- 2.2.5 Richtlinien für gute Partizipation
- 2.2.6 Voraussetzungen des Bürgers
- 2.2.7 Implementierung einer E‐Partizipations‐Plattform
- 2.3 E‐Government in Österreich
- 2.3.1 Der Online‐Amtsweg
- 2.3.2 Help.gv.at
- 2.3.3 RIS – Rechtsinformationssystem
- 2.3.4 FinanzOnline
- 2.4 E‐Voting
- 2.5 Rechtliche Herausforderungen der E‐Demokratie
- 2.6 Liquid Democracy
- 2.7 Jugendliche und Demokratie
- 2.8 Beispiele für Partizipationsanwendungen
- 2.8.1 Liquid Feedback
- 2.8.2 Kommunale Experimente
- 2.8.2.1 Hamburgs Ideen zu „Wachsende Stadt“
- 2.8.2.2 Budgetplanung in Esslingen
- 2.8.3 Nationale Experimente
- 2.8.3.1 E‐Demokratie in der Schweiz
- 2.8.3.2 Einbindung der Jugend in Österreich
- 3 Soziale Medien
- 3.1 Web 2.0 oder soziale Netze
- 3.2 Klassifikation sozialer Medien
- 3.3 Technologischer Wandel der Netzwerke
- 3.4 Social Security
- 3.5 Demografie in sozialen Medien
- 3.6 Jugendliche und soziale Medien
- 3.7 Beispiele für soziale Netzwerke
- 3.7.1 Facebook
- 3.7.2 Twitter
- 3.7.3 YouTube
- 3.7.4 Google Plus
- 3.7.5 LinkedIn
- 3.7.6 Xing
- 3.7.7 Pinterest
- 3.7.8 Blog
- 4 Integration
- 4.1 Integrationsmöglichkeiten in Facebook
- 4.2 Ziele der Integration
- 4.3 Voraussetzungen für eine gelungene Integration
- 4.4 Vorteile der Integration
- 4.5 Nachteile der Integration
- 4.6 Grenzen der Integration
- 4.7 Bestehende Integrationsansätze
- 4.7.1 Online‐Foren als Teil der Partizipation
- 4.7.2 Politische Verwendung sozialer Medien
- 4.7.3 Aktuelle Nutzung von sozialen Netzen zur E‐Partizipation
- 5 Partizipationsszenarien
- 5.1 Informationsseite
- 5.1.1 Umsetzung als Facebook‐Seite
- 5.1.2 Umsetzung dezentral über User‐Postings
- 5.1.3 Umsetzung als Facebook‐App
- 5.1.4 Umsetzung als Facebook‐Gruppe
- 5.1.1 Gewählter Ansatz
- 5.2 Bürgerinitiativen
- 5.2.1 Umsetzung als Facebook‐Seite
- 5.2.2 Umsetzung dezentral über User‐Postings
- 5.2.3 Umsetzung als Facebook‐App
- 5.2.4 Umsetzung als Facebook‐Gruppe
- 5.2.5 Gewählter Ansatz
- 5.3 Volksbefragung
- 5.3.1 Umsetzung als Facebook‐Seite
- 5.3.2 Umsetzung dezentral über User‐Postings
- 5.3.3 Umsetzung als Facebook‐App
- 5.3.4 Umsetzung als Facebook‐Gruppe
- 5.3.5 Gewählter Ansatz
- 6 Konzept des zu entwickelnden Prototyps
- 6.1 Use‐Case‐Diagramm
- 6.2 Domain‐Modell
- 6.2.1 Szenario 1: Informationsseite
- 6.2.2 Szenario 2: Bürgerinitiativen
- 6.2.3 Szenario 3: Volksbefragung
- 6.2.4 Gesamtmodell
- 6.3 UI‐Prototypen
- 6.3.1 Facebook‐Seite: Nationalrat
- 6.3.2 App: Informationen
- 6.3.3 App: Bestimme mit
- 6.4 Beschränkungen des Prototyps
- 7 Facebook‐Apps
- 7.1 Plattformen
- 7.2 Facebook‐API
- 7.3 Integration einer App on Facebook
- 7.4 Kommunikation
- 7.4.1 Login
- 7.4.2 Aktivitäten innerhalb der Plattform
- 7.4.3 Logout
- 8 Implementierung
- 8.1 The Big Picture
- 8.2 Facebook‐Seite: „Gesundheitsministerium“
- 8.3 Facebook‐Seite: „Nationalrat“
- 8.4 App „Informationen“
- 8.4.1 Vorgangsweise
- 8.4.2 Ergebnis
- 8.5 App „Bestimme mit“
- 8.5.1 Datenmodell
- 8.5.2 Architektur des Prototyps
- 8.5.3 Interaktion zwischen der App und Facebook
- 8.5.4 Probleme
- 8.5.4.1 App‐spezifische User‐ID
- 8.5.4.2 Social Plugin vs. App‐spezifische User‐ID
- 8.5.4.3 Verschlüsselte Übertragungspflicht
- 8.5.4.4 Begrenzte Höhe einer App
- 8.5.5 Ergebnis
- 9 Diskussion der Implementierung
- 9.1 User‐Interface
- 9.2 Security
- 9.3 Nutzbarkeit
- 9.4 Rechtliches
- 9.5 Weitere Integrationsmöglichkeiten in das Netzwerk
- 9.6 Integrationsmöglichkeiten in andere soziale Netzwerke
- 9.7 Anwendbarkeit der Integration
- 10 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Integration einer E‐Partizipations‐Plattform in ein soziales Netzwerk, insbesondere Facebook, um die politische Beteiligung, vor allem von Jugendlichen, zu fördern. Die Arbeit untersucht die technischen Möglichkeiten, Vor- und Nachteile der Integration und mögliche rechtliche Herausforderungen.
- E‐Partizipation und ihre Anwendungsmöglichkeiten
- Integration von Partizipationsfunktionen in soziale Netzwerke
- Datenschutz und Sicherheit bei E‐Partizipation
- Rechtliche Rahmenbedingungen für E‐Partizipation
- Entwicklung und Implementierung eines Prototyps
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Partizipationstheorie
- Kapitel 3: Soziale Medien
- Kapitel 4: Integration
- Kapitel 5: Partizipationsszenarien
- Kapitel 6: Konzept des zu entwickelnden Prototyps
- Kapitel 7: Facebook‐Apps
- Kapitel 8: Implementierung
- Kapitel 9: Diskussion der Implementierung
- Kapitel 10: Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Kapitel stellt das Thema der Arbeit und die Motivation für die Entwicklung einer E‐Partizipations‐Plattform vor. Es werden die Problemstellung, die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit erläutert.
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der E‐Demokratie, E‐Partizipation und E‐Government. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze der Bürgerbeteiligung diskutiert, sowie die rechtlichen Herausforderungen und die Bedeutung der Einbindung von Jugendlichen in demokratische Prozesse betrachtet.
Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von sozialen Medien und deren Funktionsweise. Es werden die Entwicklung von Web 2.0 zu sozialen Netzwerken, die Klassifikation von sozialen Medien, sowie die Bedeutung von Social Security und die Demografie in sozialen Medien beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Verwendung von sozialen Medien durch Jugendliche.
Dieses Kapitel befasst sich mit der Integration von E‐Partizipation in soziale Netzwerke, insbesondere Facebook. Es werden verschiedene Integrationsmöglichkeiten, deren Vor- und Nachteile sowie die Grenzen der Integration diskutiert. Außerdem werden bereits bestehende Integrationsansätze und deren Auswirkungen auf die politische Partizipation erläutert.
Dieses Kapitel präsentiert drei Szenarien für die Verwendung einer E‐Partizipations‐Plattform innerhalb von Facebook: Informationsseite, Bürgerinitiativen und Volksbefragung. Für jedes Szenario werden verschiedene Integrationsmöglichkeiten diskutiert und ein geeigneter Ansatz für die praktische Umsetzung im Prototyp gewählt.
Dieses Kapitel beschreibt das technische Konzept des Prototyps, der in den folgenden Kapiteln implementiert wird. Es werden das Use‐Case‐Diagramm, das Domain‐Modell und die UI‐Prototypen der einzelnen Anwendungen vorgestellt. Außerdem werden die Beschränkungen des Prototyps und die Gründe dafür erläutert.
Dieses Kapitel beleuchtet die Funktionsweise von Facebook‐Apps und die Facebook‐API. Es werden verschiedene Plattformen für Facebook‐Apps beschrieben und die Kommunikation zwischen der App, Facebook und dem Nutzer in einem Sequenzdiagramm dargestellt.
Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung des Prototyps mit den ausgewählten Integrationsansätzen. Es werden die Architektur des Prototyps, die Programmiersprache PHP und das Zend Framework erläutert. Die Interaktion zwischen der App und Facebook wird anhand von Programmcodebeispielen dargestellt. Außerdem werden die im Prototyp aufgetretenen Probleme und deren Lösungen beschrieben.
Dieses Kapitel diskutiert die Implementierung des Prototyps aus verschiedenen Perspektiven. Es werden die Vor- und Nachteile des gewählten User‐Interfaces, das Sicherheitskonzept und die Nutzbarkeit der Plattform betrachtet. Außerdem werden die rechtlichen Herausforderungen der E‐Partizipation und die Anwendbarkeit der Integration in ein soziales Netzwerk diskutiert.
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und Entwicklungen im Bereich der E‐Partizipation dar.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen E‐Government, E‐Partizipation und soziale Netzwerke. Dabei werden vor allem Facebook, E‐Demokratie, Analyse und Prototypen als zentrale Begriffe betrachtet.
Häufig gestellte Fragen
Können soziale Netzwerke die politische Beteiligung Jugendlicher steigern?
Die Arbeit untersucht, ob die Integration von E-Partizipations-Plattformen in Netzwerke wie Facebook Jugendliche stärker zur Ausübung ihrer demokratischen Rechte motivieren kann.
Was ist der Fokus des entwickelten Prototyps?
Es wurde eine Facebook-App entwickelt, die Funktionen für Informationen, Bürgerinitiativen und Volksbefragungen direkt in das soziale Netzwerk integriert.
Welche Vorteile bietet die Integration in Facebook?
Ein wesentlicher Vorteil ist die Nutzung bestehender Nutzerkonten, was die Hürde für die Teilnahme an politischen Prozessen senkt.
Welche rechtlichen Herausforderungen gibt es?
Die Arbeit diskutiert Datenschutz, Datensicherheit und die rechtlichen Rahmenbedingungen der E-Demokratie in Österreich und Deutschland.
Was versteht man unter "Liquid Democracy"?
Liquid Democracy ist ein Modell der Bürgerbeteiligung, das Elemente der direkten und repräsentativen Demokratie verbindet und in der Arbeit im Kontext von E-Partizipation beleuchtet wird.
- Quote paper
- Dominik Oberhumer (Author), 2015, Lassen sich Jugendliche über soziale Netzwerke zur politischen Mitbestimmung motivieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309262