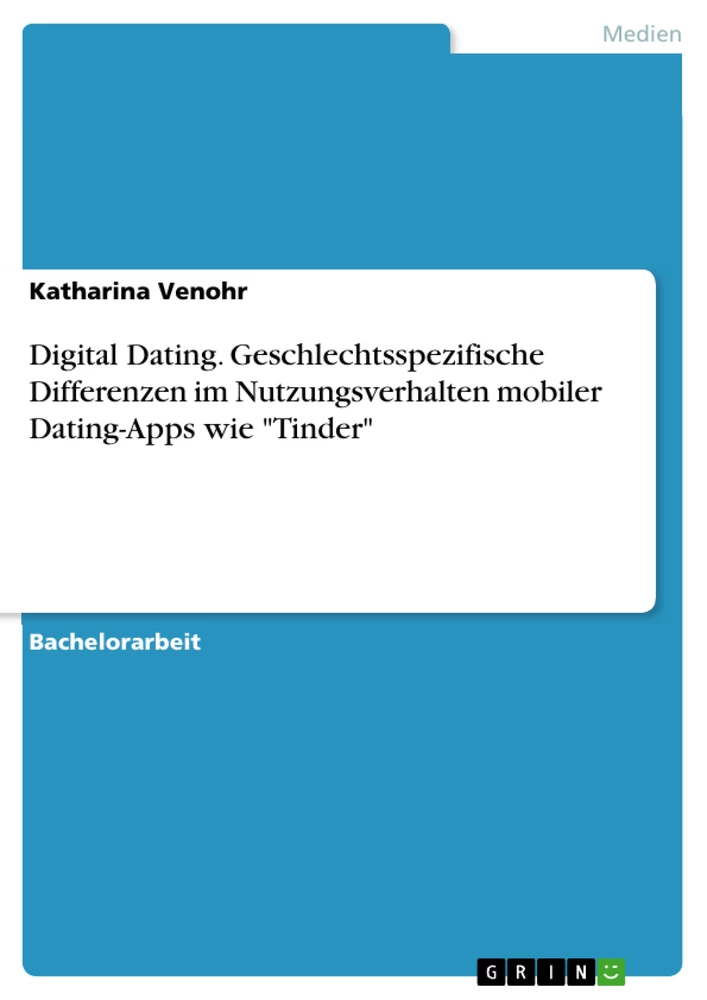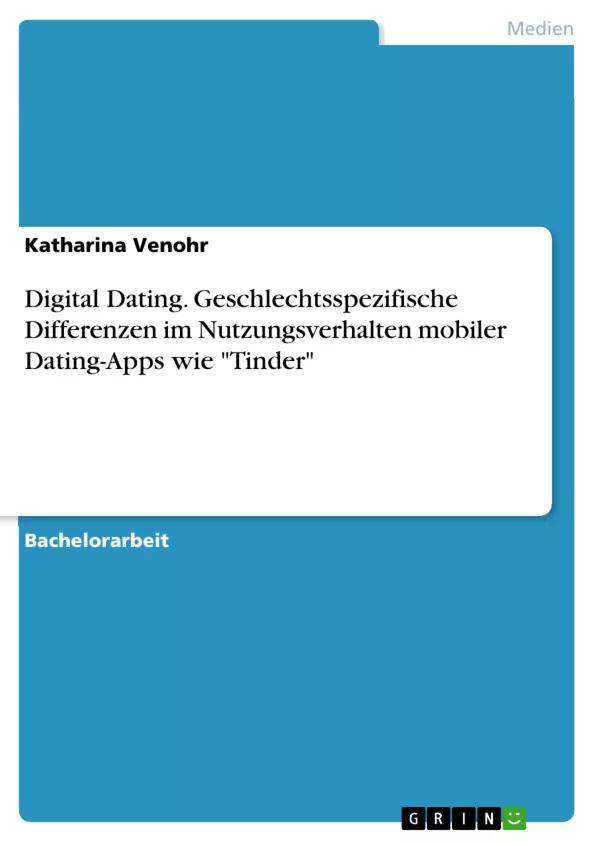„Tinder […] ist eine App für das Smartphone und das heiße Ding auf dem Markt der digitalen Paarungsmaschinen. Geschätzte 30 Millionen Menschen „tindern“ weltweit. In Deutschland tun dies mehr als eine Million, täglich kommen etwa 8000 neue Nutzer dazu.“
heißt es in einem aktuellen Artikel über die Veränderung des Liebeslebens durch die Nutzung von Smartphone-Apps im Stern (Bömelburg 2015, S. 1). Verwunderlich sind diese Nutzungszahlen nicht, denn heutzutage gib es so viele Singles wie noch nie. Viele von diesen verfolgen das Ziel dem Singleleben ein Ende zu setzen und endlich den perfekten Partner fürs Leben zu finden – aber wo und vor allem wie? (vgl. Bömelburg 2015, S. 1).
Ob über den Freundeskreis, in einer Bar, am Arbeitsplatz oder einfach unterwegs. Die Möglichkeiten neue Menschen und somit auch potenzielle Partner kennen zu lernen sind sehr vielfältig und durch das Phänomen der Mediatisierung häufig
digitalisiert. Waren früher beispielsweise noch Zeitungsannoncen eine Möglichkeit der Partnersuche, erlaubt die heutige digitale Vernetzung das Kennenlernen neuer Menschen überall. Sei es über unterschiedliche Partnervermittlungsdienste, Dating-Portale, Singlebörsen im Internet oder aber über Mobile Dating (vgl. Hogan / Li / Dutton 2011, S. ii). Mobile Dating beschreibt das Kennenlernen potenzieller neuer Partner über mobile Endgeräte, wie zum Beispiel das Smartphone (vgl. Neu.de GmbH 2014, S. 1). Mobile Dating fungiert zum einen als mobiles Endgerät für die herkömmliche Internetnutzung von klassischen Online-Dating-Portalen, zum anderen aber auch als standortbezogene Dating-Applikation für Smartphones (vgl. Neu.de GmbH 2014, S. 1). Vor allem Letzteres scheint für die heutige digitalisierte Gesellschaft von besonderem Interesse sowie stark revolutionär zu sein (vgl. Neu.de GmbH 2014, S. 3).
Die Gründe der Nutzung von Dating-Apps sind laut theoretischer Ausgangslage nur geringfügig erforscht.
Aufgrund dieser Forschungslücke wird sich die vorliegende Bachelorarbeit genauer mit eben diesen auseinandersetzen und der Forschungsfrage nachgehen, „Inwieweit hinsichtlich der Partnersuche via mobile Dating-Applikationen geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen“. Um die Frage wissenschaftlich korrekt beantworten zu können, wird innerhalb dieser Arbeit eine empirische Fallstudie zur mobilen Dating-Applikation Tinder in Form einer standardisierten Online-Befragung durchführt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Inhaltsverzeichnis
- ABSTRACT
- 1. Einführung
- 1.1 Thematische Einleitung und Fragestellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Mobile Partnersuche über Dating‐Applikationen
- 2.1 Partnersuche 2.0: Vom Online‐ hin zu Mobile Dating
- 2.2 Nutzungsmotive mobiler Dating‐Applikationen
- 2.2.1 Der Nutzen und Belohnungsansatz als Erklärung von Nutzungsmotiven
- 2.2.2 Nutzungserwartungen sowie Nutzungsmotive mobiler Dating‐ Applikationen
- 2.2.3 Nutzercharakteristika der mobilen Dating‐Applikation Tinder
- 2.3 Verschiedene mobile Dating‐Applikationen
- 2.3.1 Badoo – die Dating‐App mit dem Interessenfeature
- 2.3.2 LoVoo – die Dating‐App mit der zweifachen Umgebungssuche
- 2.3.3 Tinder – die Dating‐App nach dem „Hot‐or‐Not“‐Prinzip
- 3. Methodische Vorgehensweise
- 3.1 Hypothesenbildung und Operationalisierung
- 3.2 Die standardisierte Online‐Befragung als quantitative Erhebungs‐ methode
- 3.2.1 Erstellung des Fragebogens
- 3.2.2 Untersuchungssetting und Stichprobenauswahl
- 4. Ergebnisdarstellung
- 4.1 Unterschiedliche Nutzungshäufigkeit von Tinder innerhalb der Geschlechter
- 4.2 ‚Langeweile‘, ‚Flirten und Daten‘ sowie ‚neue Leute kennen lernen‘ als Hauptmotive der Tinder‐Nutzung
- 4.3 Matches, Chats, Dates und ernsthafte Beziehungen
- 4.4 Hypothese 1: Nutzungsmotiv „Sex“ und Geschlecht
- 4.5 Hypothese 2: Nutzungsmotiv „Beziehung“ und Geschlecht
- 4.6 Hypothese 3: Nutzungseinstellung „einfacher neue Leute kennenlernen“ und Geschlecht
- 4.7 Hypothese 4: Nutzungshäufigkeit und Beziehungsstatus
- 4.8 Hypothese 5: Kennengelernt und Date bei Tinder sowie Geschlecht
- 4.9 Hypothese 6: Vorstellung einer Partnerschaft mit jemanden der über Tinder kennen gelernt wurde und Geschlecht
- 5. Schlussfolgerungen
- 6. Fazit und Ausblick
- 7. Abbildungsverzeichnis
- 8. Symbolverzeichnis
- 9. Literaturverzeichnis
- 10. Anhang
- Fragebogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit untersucht das geschlechtsspezifische Nutzungsverhalten von mobilen Dating‐Applikationen, insbesondere Tinder. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, inwieweit es hinsichtlich der Partnersuche via mobiler Dating‐Applikationen geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Die Arbeit stützt sich auf bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse und führt eine empirische Fallstudie durch, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
- Mobile Dating als neuartiges Phänomen der Partnersuche
- Nutzungsmotive mobiler Dating‐Applikationen
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Nutzungsverhalten von Tinder
- Der Einfluss von Langeweile, Flirt und Dating, sowie der Suche nach neuen Bekanntschaften auf die Nutzung von Tinder
- Der Stellenwert von Tinder in der modernen Partnersuche
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Mobile Dating und stellt die Forschungsfrage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Partnersuche über Dating‐Apps. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen des Mobile Datings erläutert, darunter die Entwicklung vom Online‐ hin zum Mobile Dating, verschiedene Nutzungsmotive, die sich aus dem kommunikationswissenschaftlichen Nutzen und Belohnungsansatz sowie empirischen Studien ableiten, und eine Darstellung der drei beliebtesten Dating‐Apps Badoo, LoVoo und Tinder.
Kapitel 3 widmet sich der methodischen Vorgehensweise, die auf einem deduktiven Vorgehen basiert. Es werden sechs Hypothesen aufgestellt, die die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Nutzungsverhalten von Tinder untersuchen. Die standardisierte Online‐Befragung als quantitative Erhebungsmethode wird erläutert, wobei der Aufbau des Fragebogens, das Untersuchungssetting und die Stichprobenauswahl im Detail dargestellt werden.
Die Ergebnisdarstellung in Kapitel 4 zeigt die Ergebnisse der empirischen Datenauswertung. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung von Tinder als Unterhaltungsmedium und Plattform für unverbindliches Kennenlernen und Flirten. Darüber hinaus werden die sechs Hypothesen anhand von Mittelwertvergleichen und Chi²‐Tests überprüft.
Kapitel 5 fasst die Schlussfolgerungen der Arbeit zusammen. Es werden Parallelen und Unterschiede zwischen den empirischen Ergebnissen und der bestehenden Forschungslage aufgezeigt und die geschlechtsspezifischen Nutzungsunterschiede im Detail erläutert.
Das letzte Kapitel (6. Fazit und Ausblick) befasst sich mit dem Erkenntniswert der Arbeit und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsvorhaben im Bereich des Mobile Datings.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mobile Dating, Tinder, geschlechtsspezifisches Nutzungsverhalten, Nutzungsmotive, Online‐Befragung, quantitative Datenerhebung, empirische Fallstudie, Nutzungshäufigkeit, Beziehungsstatus, Partnerschaft.
- Quote paper
- Katharina Venohr (Author), 2015, Digital Dating. Geschlechtsspezifische Differenzen im Nutzungsverhalten mobiler Dating-Apps wie "Tinder", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309284