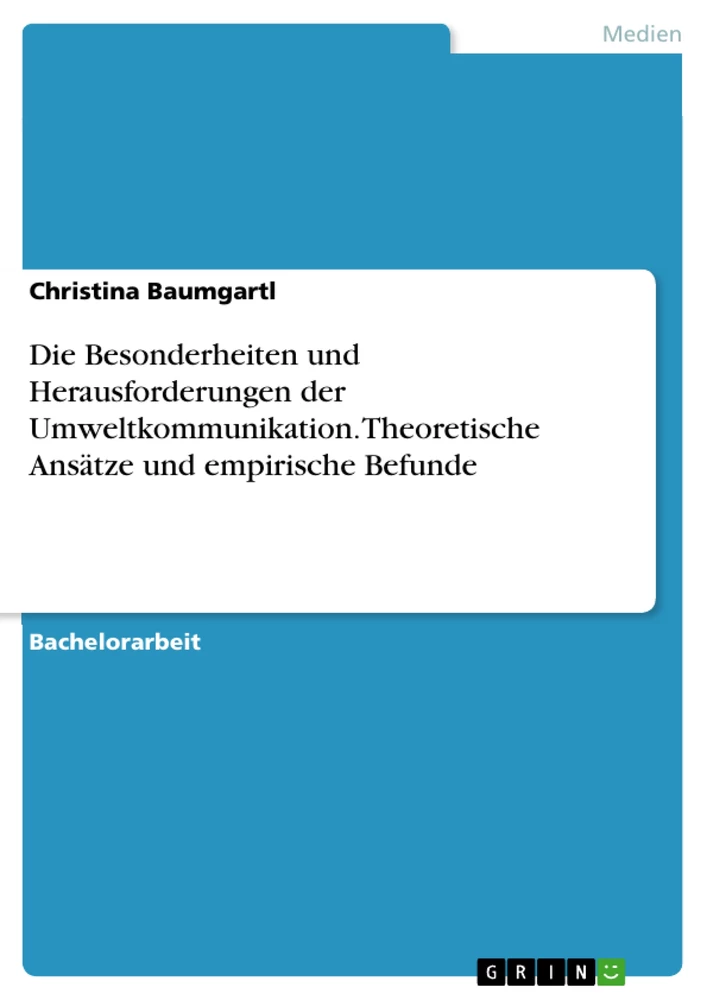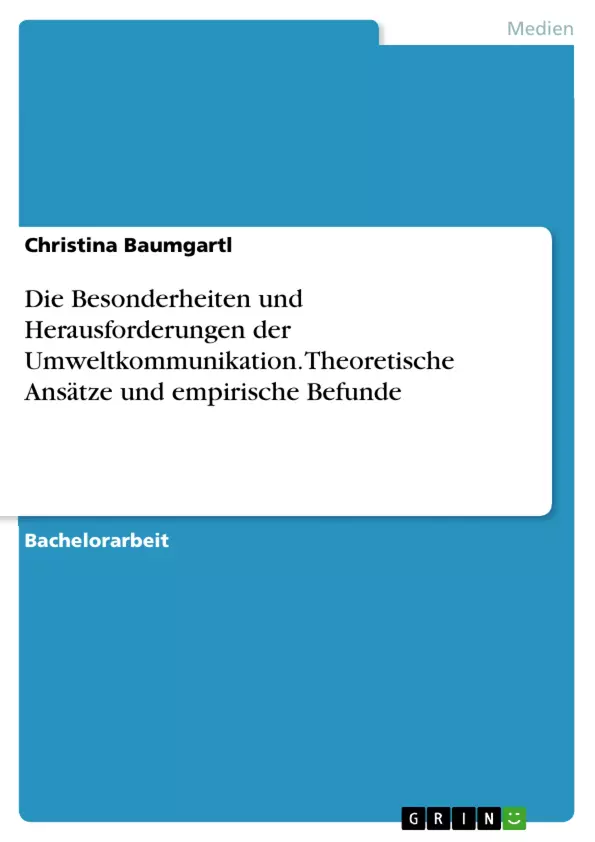In den 1980er Jahren wurde der Themenkomplex Umwelt - und damit auch Umweltkommunikation - intensiv beforscht. Heute ist das Thema nicht weniger relevant, dennoch liegen nur vereinzelt aktuelle Untersuchungen vor. Ziel der Arbeit ist es deshalb den Forschungsstand im Hinblick auf die Besonderheiten und Herausforderungen der Umweltkommunikation von Wirtschaftsunternehmen zu systematisieren und Verbindungen mit neueren Ansätzen aufzuzeigen.
Der Entwicklung einer Definition folgt die Darstellung der Auswirkungen grundlegender Strategien des Umweltmanagements auf die Unternehmenskommunikation sowie Ausführungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Kommunikationsbotschaften. Als zentrale Herausforderung wird die Bestimmung relevanter Zielgruppen identifiziert. Denn sie ergeben sich aus der Schnittmenge der Personen, die zum einen ein spezifisches Produktinteresse aufweisen und zum anderen durch ein verhaltenswirksames Umweltbewusstsein gekennzeichnet sind. Um diese Zielpublika zu ermitteln, wird vorgeschlagen das Lebensstilkonzept LOHAS in die Sinus-Milieus zu integrieren. Die Reglementierungen in Bezug auf umweltbezogene Begriffe und Kennzeichnungen sind eine Besonderheit der Umweltkommunikation. Innerhalb der Arbeit thematisiert werden insbesondere geschützte Begriffe und deren beschränkende Wirkung sowie Produktkennzeichnungen und Unternehmenszertifizierungssysteme, die wiederum als gefragte Werbemittel gelten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung und Überblick
- 2 Hinführung zur Forschungsfrage
- 2.1 Verhaltenswirksamkeit des Umweltbewusstseins
- 2.2 Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und umweltfreundlichem Verhalten
- 3 Grundlagen der Umweltkommunikation
- 3.1 Entwicklung einer Definition
- 3.2 Grundlegende Strategien
- 3.3 Inhaltliche Ausgestaltung
- 4 Besonderheiten und Herausforderungen der Umweltkommunikation
- 4.1 Herausforderung der Zielgruppenbestimmung
- 4.1.1 Problematik der Bestimmung relevanter Zielgruppen
- 4.1.2 LOHAS im Kontext der Sinus-Milieus
- 4.2 Umweltbezogene Begriffe und Kennzeichnungen
- 4.2.1 Geschützte Bezeichnungen mit Umweltbezug
- 4.2.2 Umweltbezogene Produktkennzeichnungen
- 4.2.3 Umweltbezogene Unternehmenszertifizierungssysteme
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Besonderheiten und Herausforderungen der Umweltkommunikation. Sie untersucht, wie Umweltbewusstsein im Verbraucherverhalten wirksam werden kann und welche Strategien Unternehmen im Bereich der ökologischen Kommunikation einsetzen können.
- Die Bedeutung des Umweltbewusstseins als Ausgangspunkt für die Umweltkommunikation
- Definition und grundlegende Strategien der ökologischen Kommunikation
- Die Herausforderung der Zielgruppenbestimmung in der Umweltkommunikation
- Die Verwendung umweltbezogener Begriffe und Kennzeichnungen in der Umweltkommunikation
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung von ökologischer Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 bietet einen einleitenden Überblick über die Entwicklung des Umweltbewusstseins und die Bedeutung der Umweltkommunikation.
Kapitel 2 befasst sich mit der Verhaltenswirksamkeit des Umweltbewusstseins. Es wird die Dreidimensionalität des Konstrukts Umweltbewusstsein erläutert und die Faktoren diskutiert, die das Umweltbewusstsein verhaltenswirksam machen.
Kapitel 3 geht auf die Grundlagen der Umweltkommunikation ein. Es wird eine Definition des Konzepts erarbeitet und grundlegende Strategien für ein umweltbewusstes Unternehmenshandeln vorgestellt.
Kapitel 4 analysiert die Besonderheiten und Herausforderungen der Umweltkommunikation. Es werden die Problematik der Zielgruppenbestimmung und die Besonderheiten bei der Verwendung umweltbezogener Begriffe und Kennzeichnungen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Umweltkommunikation, ökologische Kommunikation, Umweltbewusstsein, Zielgruppenbestimmung, Umweltbezogene Begriffe, Kennzeichnungen, Unternehmenszertifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Umweltkommunikation von Unternehmen?
Ziel ist es, ökologisches Handeln transparent zu machen, das Umweltbewusstsein der Kunden anzusprechen und Vertrauen in grüne Marken zu stärken.
Was versteht man unter dem LOHAS-Konzept?
LOHAS steht für „Lifestyle of Health and Sustainability“. Es bezeichnet eine Zielgruppe, die einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil pflegt und dies durch bewussten Konsum ausdrückt.
Warum ist die Zielgruppenbestimmung eine Herausforderung?
Es gibt oft eine Diskrepanz zwischen verbal geäußertem Umweltbewusstsein und tatsächlichem Kaufverhalten, was die Identifikation wirklich relevanter Käufergruppen erschwert.
Welche Rolle spielen Zertifizierungen wie EMAS oder ISO 14001?
Diese Systeme dienen als Nachweis für ein systematisches Umweltmanagement und werden in der Kommunikation als wichtiges Werbemittel und Vertrauensbeweis eingesetzt.
Was sind geschützte umweltbezogene Begriffe?
Es gibt Reglementierungen für Begriffe wie „Bio“ oder „Öko“, deren unbefugte Nutzung rechtliche Konsequenzen haben kann und die Umweltkommunikation einschränkt.
- Quote paper
- Christina Baumgartl (Author), 2011, Die Besonderheiten und Herausforderungen der Umweltkommunikation. Theoretische Ansätze und empirische Befunde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309442