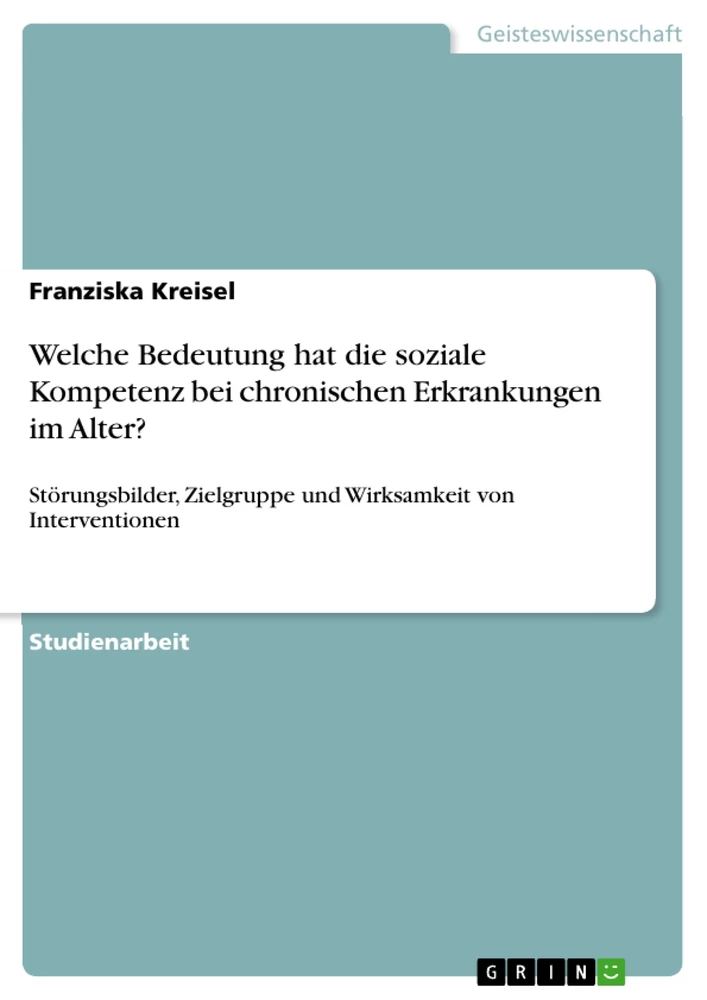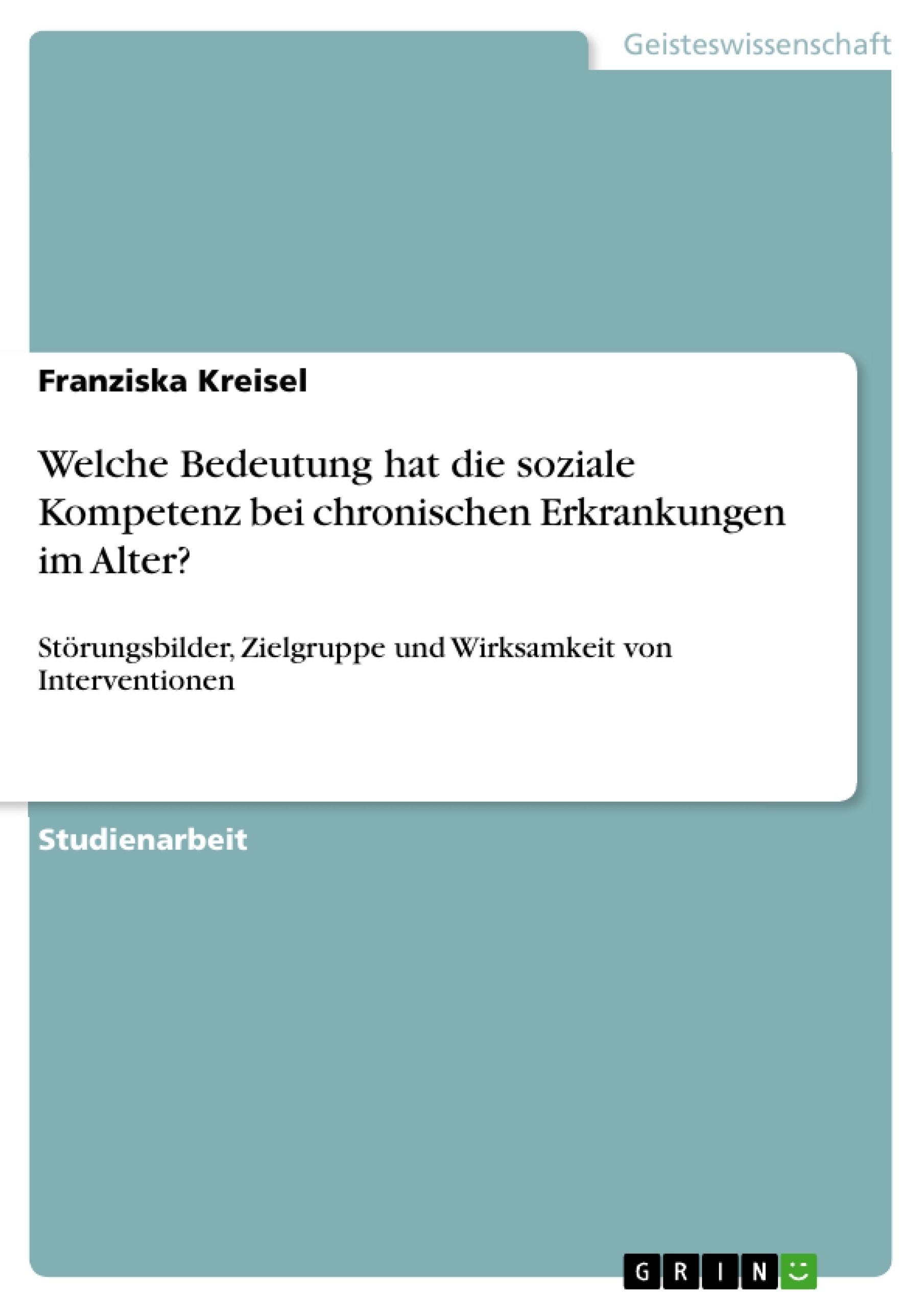Soziale Kompetenz oder insbesondere die Probleme, die entstehen können, wenn Personen defizitäre soziale Fähigkeiten aufweisen, sind bei vielen Störungsbildern von Bedeutung, mit denen sich die Klinische Psychologie befasst. Naheliegend sind hierbei psychische Erkrankungen, die sich direkt auf das soziale Verhalten auswirken, wie beispielsweise eine soziale Phobie.
Aber auch Erkrankungen, die nicht primär mit sozialer Kompetenz verknüpft zu sein scheinen, können von dem Themenkomplex beeinflusst sein. Dies soll im Folgenden anhand der Ausführungen zu vordergründig körperlichen Erkrankungen verdeutlicht werden. Die Hausarbeit beschäftigt sich mit chronischen Erkrankungen im Alter, genauer mit den Krankheitsbildern Morbus Parkinson und Chronischer Schmerz.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Was ist Soziale Kompetenz?
- Die Störungsbilder: Chronische Erkrankungen im Zusammenhang mit sozialer Kompetenz
- Ältere Menschen als besondere Herausforderung bei verhaltenstherapeutischen Interventionen
- U. Strehl & N. Birbaumer: Verhaltensmedizinische Intervention bei Morbus Parkinson
- B. Glier: Chronischen Schmerz bewältigen
- Empirische Belege für die Wirksamkeit psychologischer Interventionen bei chronischen Erkrankungen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit beleuchtet die Bedeutung sozialer Kompetenz bei chronischen Erkrankungen im Alter, mit besonderem Fokus auf die Krankheitsbilder Morbus Parkinson und Chronischer Schmerz. Sie untersucht, wie diese Erkrankungen soziale Kompetenzdefizite verursachen oder verstärken können und analysiert verhaltenstherapeutische Interventionsprogramme, die diesen Herausforderungen begegnen.
- Definition und Bedeutung von Sozialer Kompetenz
- Auswirkungen von Morbus Parkinson und Chronischem Schmerz auf die Soziale Kompetenz
- Spezifische Herausforderungen bei der Behandlung älterer Menschen mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen
- Empirische Evidenz für die Wirksamkeit psychologischer Interventionen bei chronischen Erkrankungen
- Vergleich und Bewertung von zwei Interventionsmodellen für Morbus Parkinson und Chronischen Schmerz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Das erste Kapitel definiert den Begriff der Sozialen Kompetenz und beleuchtet die Bedeutung des Konstrukts im Kontext von verschiedenen Störungsbildern, die in der Klinischen Psychologie behandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf körperlichen Erkrankungen, insbesondere im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen im Alter.
- Das zweite Kapitel beschreibt die Störungsbilder Morbus Parkinson und Chronischer Schmerz und erläutert, inwiefern diese Erkrankungen die Soziale Kompetenz der Betroffenen beeinflussen können. Parkinson-Patienten zeigen u.a. motorische Beeinträchtigungen, die von Außenstehenden als sozial inkompetent interpretiert werden können. Chronische Schmerzpatienten leiden unter sozialem Rückzug und Vermeidungsverhalten.
- Das dritte Kapitel widmet sich den Besonderheiten der verhaltenstherapeutischen Intervention bei älteren Menschen. Es werden wichtige Aspekte wie die geringere Erfahrung mit Psychotherapie, das ausgeprägte somatische Krankheitsverständnis, die Altersentwicklung und die Bedeutung der Ressourcenorientierung beleuchtet.
- Das vierte Kapitel präsentiert ein verhaltensmedizinisches Interventionsprogramm von Strehl und Birbaumer (1996) zur Behandlung von Morbus Parkinson. Das Programm umfasst Trainingsmodule für motorische und soziale Fähigkeiten, Entspannungstechniken sowie den Einsatz von EMG-Biofeedback.
- Das fünfte Kapitel stellt das Interventionsprogramm "Chronischen Schmerz bewältigen" von Glier (2002) vor, das auf der Steigerung der Problemlösekompetenz der Patienten basiert. Es umfasst u.a. funktionale Problem- und Verhaltensanalyse, Zielsetzung, konkrete Lösungsschritte und Verhaltensrecommendations für verschiedene soziale Situationen.
- Das sechste Kapitel analysiert empirische Studien zur Wirksamkeit psychologischer Interventionen bei chronischen Erkrankungen. Es werden u.a. Entspannungstechniken, Biofeedback, Operantes Konditionieren und Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bei chronischen Schmerzen untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Sozialer Kompetenz, chronischen Erkrankungen im Alter, Morbus Parkinson, Chronischem Schmerz, Verhaltenstherapie, Interventionsprogrammen, älteren Menschen, Ressourcenorientierung, EMG-Biofeedback, Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), Operantes Konditionieren, Entspannungstechniken, empirische Evidenz und Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter sozialer Kompetenz im Kontext chronischer Erkrankungen?
Soziale Kompetenz umfasst die Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche soziale Interaktion notwendig sind. Bei chronischen Erkrankungen können Defizite in diesem Bereich entstehen, die den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität negativ beeinflussen.
Wie wirkt sich Morbus Parkinson auf die soziale Kompetenz aus?
Parkinson-Patienten leiden häufig unter motorischen Beeinträchtigungen wie Mimikstarre oder Zittern. Diese Symptome können von Außenstehenden fälschlicherweise als soziale Inkompetenz oder Desinteresse interpretiert werden, was zu sozialer Isolation führen kann.
Welchen Einfluss hat chronischer Schmerz auf das Sozialverhalten?
Chronische Schmerzpatienten entwickeln oft Vermeidungsverhalten und ziehen sich aus sozialen Aktivitäten zurück, um Schmerzspitzen zu verhindern, was langfristig die sozialen Fähigkeiten schwächt.
Welche Rolle spielt die Verhaltenstherapie bei älteren Menschen mit chronischen Krankheiten?
Verhaltenstherapeutische Interventionen helfen dabei, soziale Kompetenzen zu trainieren, Entspannungstechniken zu erlernen und ein besseres Krankheitsverständnis zu entwickeln, wobei besonders auf die Ressourcenorientierung im Alter geachtet wird.
Was ist das Ziel des Interventionsprogramms von Strehl und Birbaumer?
Dieses Programm kombiniert motorisches und soziales Training mit Entspannungstechniken und EMG-Biofeedback, um Parkinson-Patienten eine bessere Bewältigung ihres Alltags zu ermöglichen.
Gibt es empirische Belege für die Wirksamkeit psychologischer Interventionen?
Ja, Studien zeigen, dass Methoden wie die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), Biofeedback und operantes Konditionieren die Lebensqualität bei chronischen Schmerzen und Parkinson signifikant verbessern können.
- Quote paper
- Franziska Kreisel (Author), 2012, Welche Bedeutung hat die soziale Kompetenz bei chronischen Erkrankungen im Alter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309628