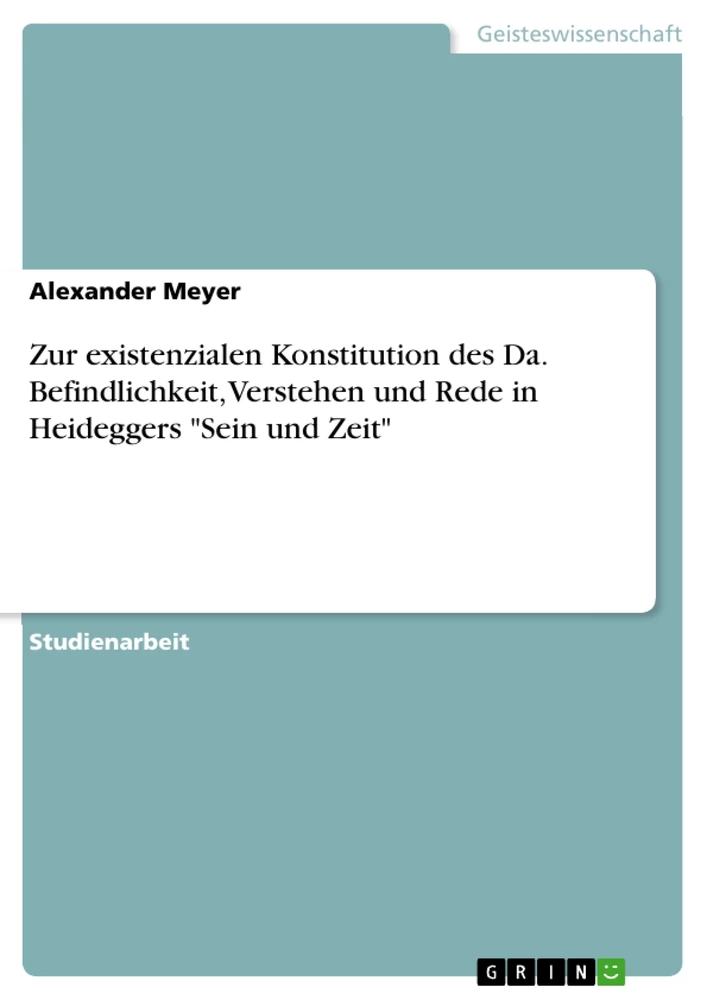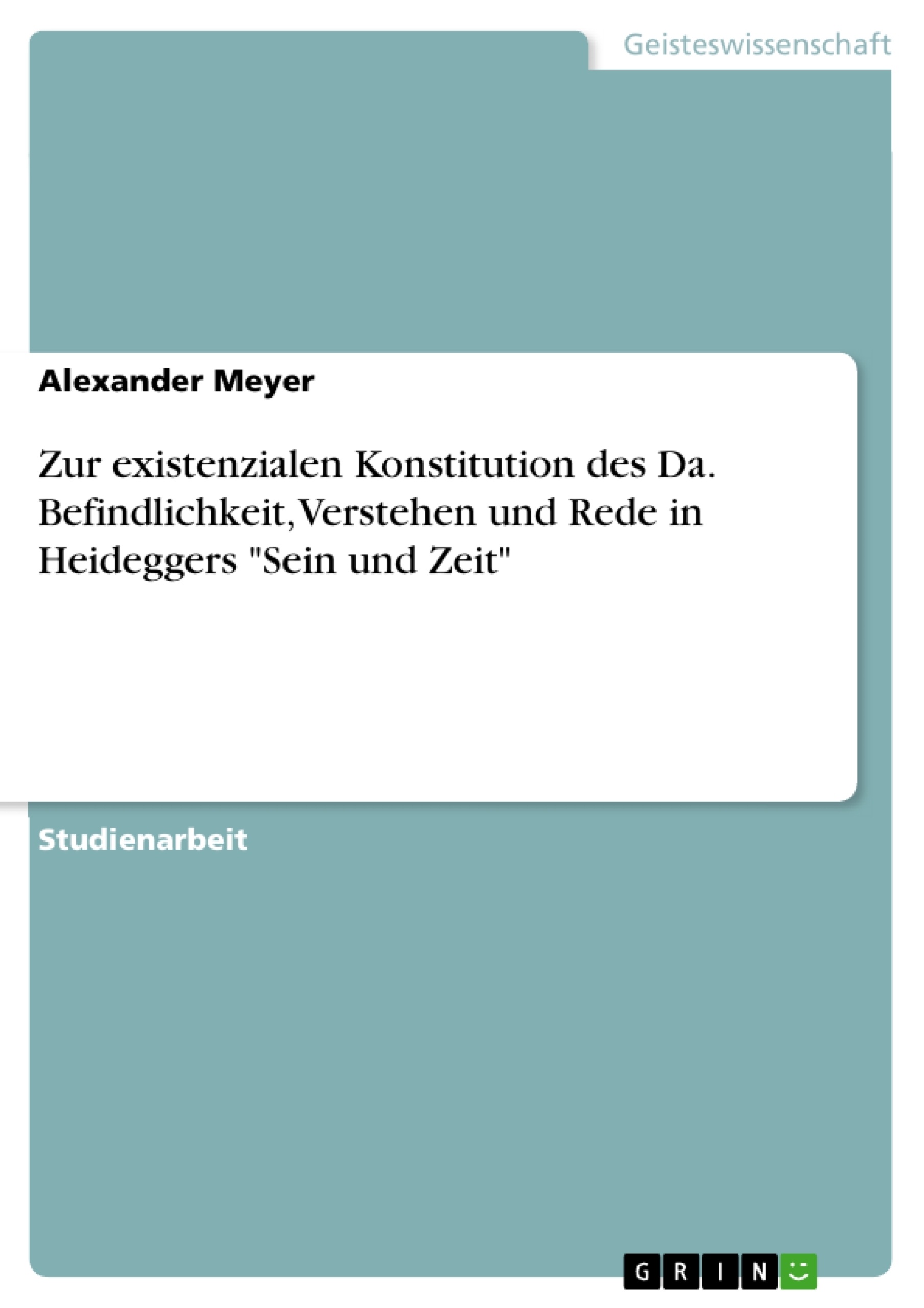„Das Dasein ist seine Erschlossenheit.“ Mit dieser Bestimmung von Dasein eröffnet Heidegger in seinem frühen Hauptwerk "Sein und Zeit" (1927) einen aufgeschlossenen Möglichkeitshorizont von Dasein. Dabei stellt sich aber bereits die Frage, was er damit genau im Einzelnen meint. Was meint Heidegger, wenn er von Erschlossenheit spricht? Wie ist diese strukturiert?
Um diese Fragen der von Heidegger aufgezeigten Formen der Erschlossenheit soll es im Folgenden gehen, also um die Befindlichkeit, das Verstehen und die Rede als existenziale Strukturen des Daseins, durch welche sich dieses in seiner Erschlossenheit zeigt. Da diese drei Strukturen nur zusammen die unmittelbare Erfahrung des eigenen Seins ausmachen, d.h. sie sind nicht als eigenständige Strukturen zu betrachten, werden sie auch hier nur zusammengehörig zur Sprache gebracht.
Zunächst soll also die Befindlichkeit im Sinne Heideggers betrachtet und anschließend anhand der Furcht deutlicher herausgestellt werden.
Anschließend soll aufgezeigt werden, was Heidegger als Verstehen bezeichnet und inwiefern sich dieses Moment der Erschlossenheit auf die Befindlichkeit beziehen lässt. Daraufhin soll diese zweite Struktur der Erschlossenheit anhand der Auslegung und der Aussage vertieft demonstriert werden. – Es ist also bereits deutlich zu erkennen, dass diese vorliegende Arbeit dem strukturellen Aufbau Heideggers in "Sein und Zeit" folgt und folglich dessen Denkweg hinsichtlich der drei Formen der Erschlossenheit versucht nachzuvollziehen oder besser: mitzuvollziehen.
Durch diese zweite Form der Erschlossenheit des Daseins, d.h. durch das Verstehen, wird deutlich werden, worauf sich das Dasein versteht, nämlich auf sein eigenstes Sein im Sinne eines entwerfenden Seinsvollzugs.
Als drittes Moment der Erschlossenheit wird anschließend die Rede thematisiert werden. Dadurch wird sich zeigen, dass das Dasein durch die Rede hindurch die beiden zuerst untersuchten Erschlossenheitsstrukturen artikuliert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Erstes Strukturmoment der Erschlossenheit: die Befindlichkeit
- 1. Da-sein als Befindlichkeit
- 2. Ein Modus der Befindlichkeit: die Furcht
- II. Zweites Strukturmoment der Erschlossenheit: das Verstehen
- 1. Da-sein als Verstehen
- 2. Auslegung
- 3. Ein Modus der Auslegung: die Aussage
- III. Drittes Strukturmoment der Erschlossenheit: die Rede
- 1. Rede und Sprache
- Schluss: Befindlichkeit, Verstehen und Rede – ein Dreigespann?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem frühen Hauptwerk von Martin Heidegger, „Sein und Zeit“, und analysiert die existenzielle Konstitution des „Da“ von Dasein. Der Fokus liegt auf den drei strukturellen Momenten der Erschlossenheit: Befindlichkeit, Verstehen und Rede. Der Text zielt darauf ab, das Denken Heideggers zu diesen zentralen Begriffen zu erläutern und deren Bedeutung für die Philosophie Heideggers aufzuzeigen.
- Die Erschlossenheit von Dasein als ein Dreigespann aus Befindlichkeit, Verstehen und Rede
- Die Rolle der Stimmung und der Furcht in der existenzialen Befindlichkeit
- Das Verstehen als ein aktives Moment der Erschlossenheit, welches sich auf Möglichkeiten hin entwirft
- Die Auslegung als ein wesentliches Moment des Verstehens, welches durch Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff strukturiert ist
- Die Rede als das existenzial-ontologische Fundament der Sprache und als die Artikulation von Befindlichkeit und Verstehen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die zentralen Fragen, die im Folgenden behandelt werden. Sie führt den Leser in die Begrifflichkeit von Erschlossenheit und Dasein ein, wie sie von Heidegger in „Sein und Zeit“ definiert wird.
Kapitel I beleuchtet die Befindlichkeit als erstes Strukturmoment der Erschlossenheit von Dasein. Es wird herausgestellt, dass sich Dasein je schon gestimmt in der Welt befindet und dass die Geworfenheit des Daseins durch die Befindlichkeit hindurch erschlossen wird. Anhand der Furcht als einem Modus der Befindlichkeit wird die jeweilige Struktur von Stimmung verdeutlicht.
Kapitel II analysiert das Verstehen als ein weiteres konstitutives Strukturmoment der Erschlossenheit von Dasein. Es wird gezeigt, dass Verstehen gleichursprünglich mit Befindlichkeit ist und dass sich Dasein auf Möglichkeiten hin entwerfen kann. Dieser Entwurfscharakter des Verstehens wird mittels der Auslegung und der Aussage vertieft beleuchtet.
Kapitel III thematisiert die Rede als das dritte fundamentale Strukturmoment der Erschlossenheit von Dasein. Es wird herausgestellt, dass die Rede die Verständlichkeit artikuliert und als das ontologische Fundament der Sprache fungiert. Es wird der Zusammenhang von Rede, Befindlichkeit und Verstehen näher beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen aus der Philosophie Heideggers, insbesondere mit den Themen Dasein, Erschlossenheit, Befindlichkeit, Verstehen, Rede und Sprache. Im Fokus stehen die existenzialen Strukturen des Daseins, die in Heideggers „Sein und Zeit“ dargestellt werden. Die Arbeit befasst sich mit der ontologischen Konstitution des „Da“ von Dasein, der Geworfenheit, der Möglichkeit, dem Entwurf, der Auslegung, der Aussage, dem Hören und dem Verhältnis zwischen Rede und Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Heidegger mit der "Erschlossenheit" des Daseins?
Erschlossenheit bedeutet, dass das Dasein sich selbst und seine Welt immer schon in einer bestimmten Weise zugänglich macht. Sie ist die grundlegende Struktur des "Da" im Dasein.
Was sind die drei Säulen der Erschlossenheit in "Sein und Zeit"?
Heidegger nennt Befindlichkeit (Stimmung), Verstehen (Entwurf auf Möglichkeiten) und Rede (artikulierter Sinn) als die drei gleichursprünglichen Strukturen.
Welche Rolle spielt die "Furcht" in Heideggers Analyse?
Die Furcht wird als ein spezifischer Modus der Befindlichkeit untersucht, um zu verdeutlichen, wie Stimmungen das In-der-Welt-sein des Daseins prägen.
Wie hängen Rede und Sprache zusammen?
Die Rede ist das existenzial-ontologische Fundament. Sie ist die Artikulation der Verständlichkeit, während die Sprache die äußere, lautliche Äußerung dieser Rede darstellt.
Was versteht Heidegger unter "Auslegung"?
Auslegung ist die Ausarbeitung des Verstehens. Sie macht das Verstandene explizit und ist durch die Strukturen Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff gekennzeichnet.
- Quote paper
- Alexander Meyer (Author), 2011, Zur existenzialen Konstitution des Da. Befindlichkeit, Verstehen und Rede in Heideggers "Sein und Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309750