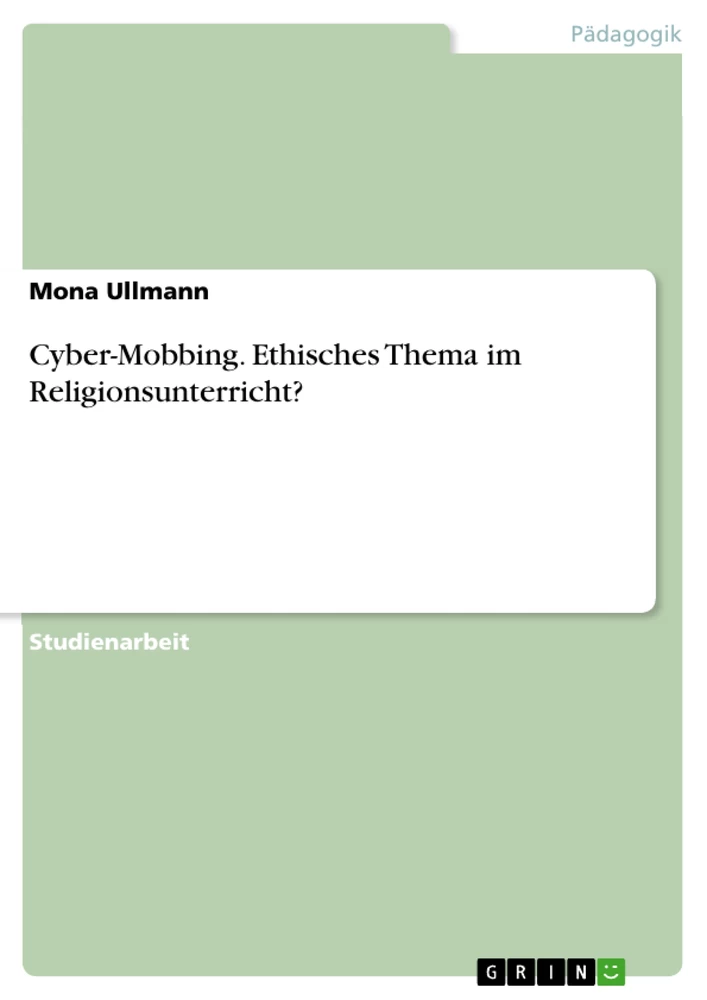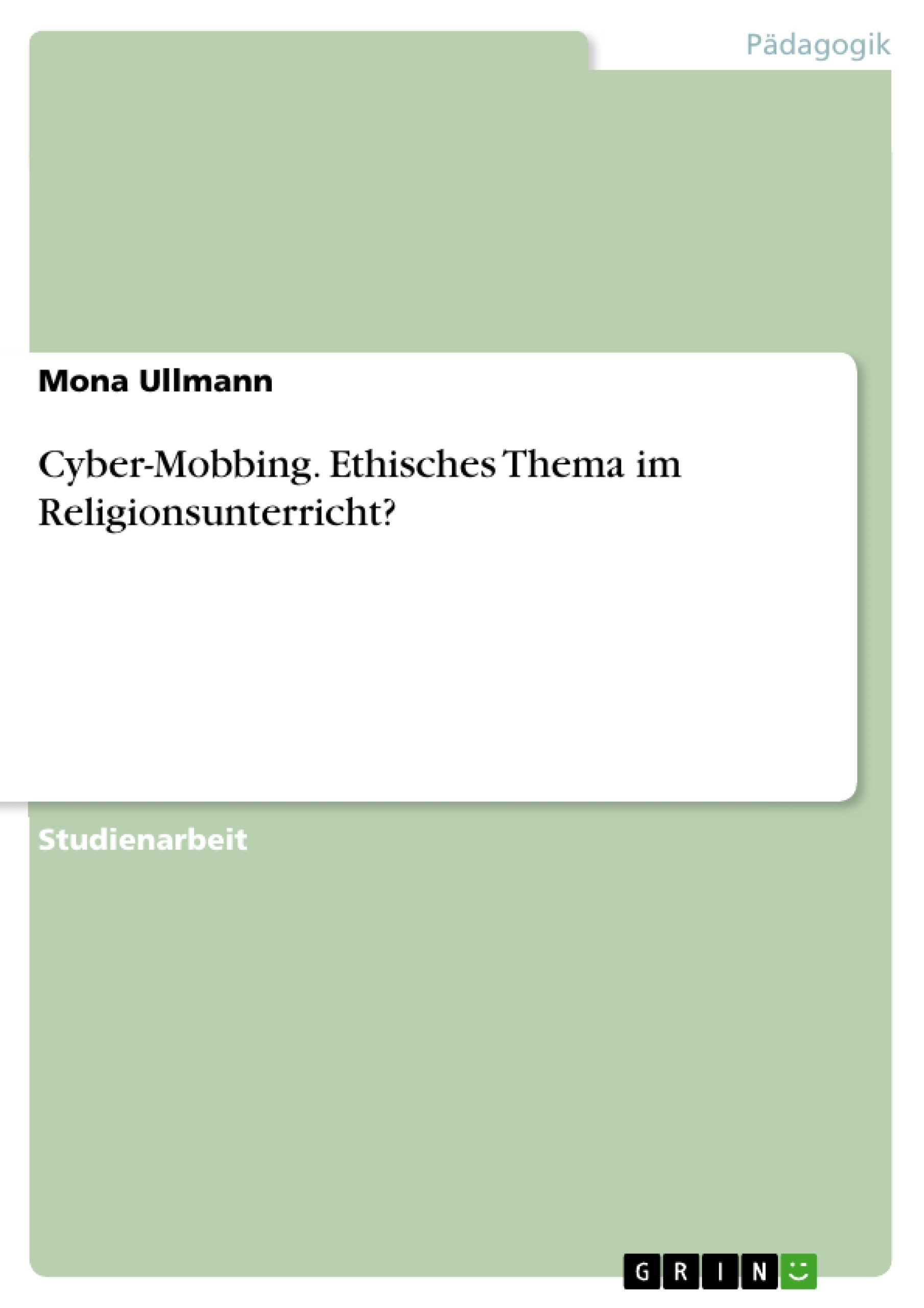Das Ziel dieser Arbeit soll es sein zu erklären, warum sich Religionsunterricht mit dem Thema Cyber-Mobbing beschäftigen muss. Es soll ein besonderer Fokus auf Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr liegen. Um auf das Thema Mobbing einzugehen, bedarf es einem Einblick in das alltägliche Leben jugendlicher Menschen. Dazu gehören Medien, wie das Internet: Gehört es zur Alltäglichkeit? Wozu nutzen Jugendliche dieses Medium?
Als Folge dieses Mediums möchte ich darauf eingehen, inwieweit diese den heutigen Religionsunterricht beeinflussen und wie sich die Thematiken des heutigen Religionsunterrichts angepasst haben.
Da speziell auf Cyber-Mobbing eingegangen wird, müssen einige Fakten erläutert werden: Was ist Cyber-Mobbing? Welche Gefahren stecken hinter dieser Thematik? Was können Schulen tun, um gegen dieses Thema vorzugehen?
Darauffolgend liegt der Fokus auf der ethischen Bedeutung von Cyber-Mobbing im Religionsunterricht. In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, warum es wichtig ist, unangenehme Themen im Religionsunterricht anzusprechen und welchen religiösen Ansichten Cyber-Mobbing widerspricht. Im Vordergrund stehen biblische Normen, die gegen Gewalt und Unruhe sprechen und an die sich der christliche Mensch halten soll.
Letztlich soll diese Thematik anhand eines groben praktischen Unterrichtsbeispiels mit Angabe von Grob – und Feinzielen und einem Vergleich mit dem Kerncurriculum des Faches Religion für die Realschule Klasse 5-10 veranschaulicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internet - Ein alltägliches Medium
- Der veränderte Religionsunterricht als Konsequenz
- Cyber-Mobbing
- Definition
- Gefahren
- Präventive Maßnahmen
- Warum Mobbing im Religionsunterricht? Ethischer Hintergrund
- Der Dekalog
- Nächstenliebe
- Die goldene Regel
- Der kategorische Imperativ
- Unterrichtsbeispiel
- Einordnung in das Kerncurriculum
- Grob- und Feinziele einer Unterrichtseinheit
- Konkretisierung am Beispiel einer Unterrichtsdoppelstunde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Relevanz von Cyber-Mobbing als ethisches Thema im Religionsunterricht, insbesondere für Jugendliche ab 15 Jahren. Sie beleuchtet den Einfluss des Internets auf das Leben Jugendlicher und die Notwendigkeit einer Anpassung des Religionsunterrichts an diese neuen Gegebenheiten. Die Arbeit analysiert die ethischen Dimensionen von Cyber-Mobbing im Lichte biblischer und philosophischer Normen.
- Der Einfluss des Internets auf das Leben Jugendlicher
- Die Anpassung des Religionsunterrichts an die neuen Medien
- Definition und Gefahren von Cyber-Mobbing
- Ethische Aspekte von Cyber-Mobbing im Kontext religiöser Werte
- Didaktische Konzepte zur Behandlung von Cyber-Mobbing im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Cyber-Mobbing und seine ethische Relevanz im Religionsunterricht ein. Sie betont die Bedeutung von Nächstenliebe und friedlichem Miteinander und begründet die Notwendigkeit, sich mit diesem Thema im Kontext der religiösen Bildung auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt auf Jugendlichen ab 15 Jahren und der Integration des Themas in den Religionsunterricht.
Internet – Ein alltägliches Medium: Dieses Kapitel beschreibt das Internet als allgegenwärtiges Medium im Leben Jugendlicher. Es beleuchtet die zunehmende Nutzung des Internets für Kommunikation, Informationsbeschaffung und soziale Interaktion und zeigt auf, wie stark das Internet die Lebenswelt Jugendlicher prägt und traditionelle Medien ersetzt. Die Studie JIM 2008 wird herangezogen, um die hohe Internetnutzung bei Jugendlichen zu belegen.
Der veränderte Religionsunterricht als Konsequenz: Dieses Kapitel argumentiert, dass der Religionsunterricht auf die veränderte Lebenswelt der Jugendlichen reagieren und sich an die neuen Gegebenheiten, insbesondere den Einfluss des Internets, anpassen muss. Es diskutiert die Notwendigkeit eines zeitgemäßen, weltoffenen Religionsunterrichts, der die Probleme und Herausforderungen Jugendlicher im Mittelpunkt stellt und biblische Geschichten mit aktuellen Themen verbindet. Die Arbeiten von Jutta Siemann und Volker Pfeiffer werden als Belege für einen praxisbezogenen und gegenwartsbezogenen Religionsunterricht herangezogen.
Cyber-Mobbing: Dieses Kapitel definiert Cyber-Mobbing als elektronische Belästigung, die sowohl direkt als auch indirekt erfolgen kann. Es werden die Gefahren von Cyber-Mobbing herausgestellt und die Bedeutung der Prävention betont. Es wird auf die potenziell große Reichweite von beleidigenden Kommentaren in sozialen Netzwerken hingewiesen, sowie der Unterschied zu "normalem" Mobbing und die Häufigkeit erläutert.
Schlüsselwörter
Cyber-Mobbing, Religionsunterricht, Ethik, Internet, Jugendliche, Nächstenliebe, Dekalog, goldene Regel, kategorischer Imperativ, Prävention, Medienpädagogik, Kerncurriculum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Cyber-Mobbing im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz von Cyber-Mobbing als ethisches Thema im Religionsunterricht für Jugendliche ab 15 Jahren. Sie analysiert den Einfluss des Internets auf das Leben Jugendlicher und die Notwendigkeit, den Religionsunterricht an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung der ethischen Dimensionen von Cyber-Mobbing anhand biblischer und philosophischer Normen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Einfluss des Internets auf das Leben Jugendlicher; die Anpassung des Religionsunterrichts an neue Medien; Definition und Gefahren von Cyber-Mobbing; ethische Aspekte von Cyber-Mobbing im Kontext religiöser Werte; didaktische Konzepte zur Behandlung von Cyber-Mobbing im Religionsunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet folgende Kapitel: Einleitung; Internet – Ein alltägliches Medium; Der veränderte Religionsunterricht als Konsequenz; Cyber-Mobbing (mit Unterkapiteln zu Definition, Gefahren und Prävention); Warum Mobbing im Religionsunterricht? Ethischer Hintergrund (mit Unterkapiteln zu Dekalog, Nächstenliebe, Goldener Regel und Kategorischem Imperativ); Unterrichtsbeispiel (mit Unterkapiteln zur Einordnung ins Kerncurriculum, Grob- und Feinziele, und Konkretisierung an einem Beispiel); Fazit.
Wie wird Cyber-Mobbing definiert?
Cyber-Mobbing wird als elektronische Belästigung definiert, die sowohl direkt als auch indirekt erfolgen kann. Die Arbeit hebt die Gefahren hervor und betont die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen.
Welche ethischen Grundlagen werden betrachtet?
Die ethischen Aspekte von Cyber-Mobbing werden im Kontext religiöser Werte beleuchtet. Dabei werden der Dekalog, die Nächstenliebe, die goldene Regel und der kategorische Imperativ als Bezugspunkte herangezogen.
Wie soll Cyber-Mobbing im Religionsunterricht behandelt werden?
Die Hausarbeit schlägt didaktische Konzepte zur Behandlung von Cyber-Mobbing im Religionsunterricht vor und liefert ein konkretes Unterrichtsbeispiel, inklusive Einordnung ins Kerncurriculum und Definition von Grob- und FeinZielen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Studie JIM 2008 (zur Internetnutzung Jugendlicher) und die Arbeiten von Jutta Siemann und Volker Pfeiffer (zu einem praxisbezogenen und gegenwartsbezogenen Religionsunterricht).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Cyber-Mobbing, Religionsunterricht, Ethik, Internet, Jugendliche, Nächstenliebe, Dekalog, goldene Regel, kategorischer Imperativ, Prävention, Medienpädagogik, Kerncurriculum.
Für welche Altersgruppe ist die Hausarbeit relevant?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf Jugendliche ab 15 Jahren.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
Das Fazit der Hausarbeit wird im letzten Kapitel präsentiert und fasst die Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammen (dieser Inhalt ist im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben).
- Quote paper
- Mona Ullmann (Author), 2014, Cyber-Mobbing. Ethisches Thema im Religionsunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310014