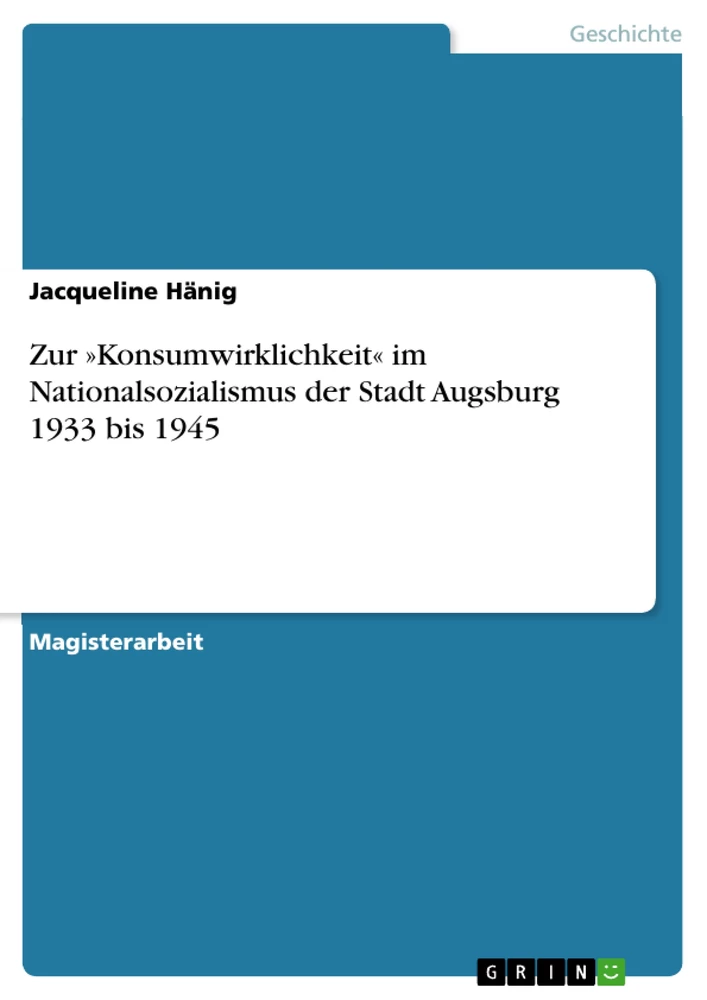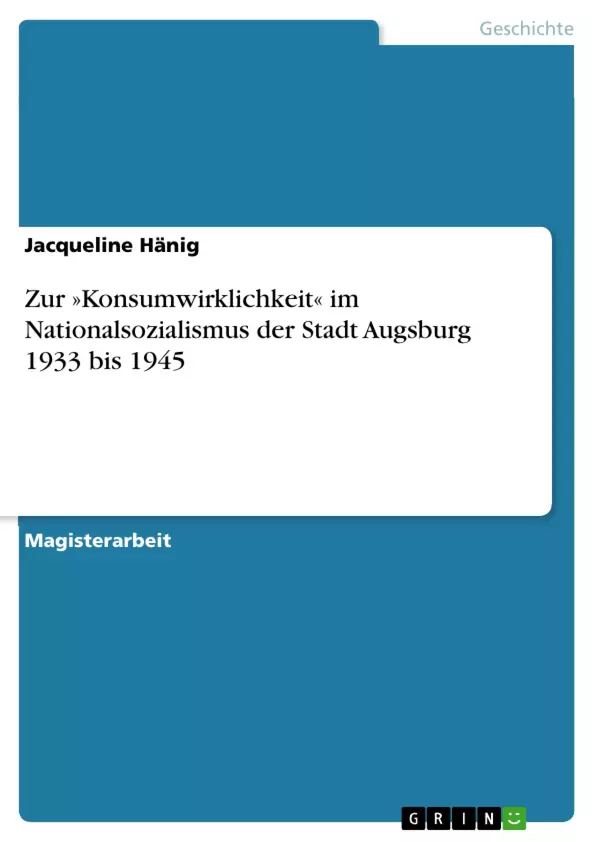Lange Zeit diente die Geheime Staatspolizei als zentrale Überwachungs- und Verfolgungsinstanz des »Dritten Reiches« dem Nachkriegsdeutschland zur Rechtfertigung der eigenen Beteiligung am Nationalsozialismus. Die „Einordnung in die ‚Volksgemeinschaft‛“ war solchen Erklärungsmustern zufolge durch die Erzeugung eines allgegenwärtigen Klimas der Angst und Bedrohung erzwungen worden.
In den 1980er und 1990er Jahren unternommene, retrospektive Befragungen von bis zu 3000 Zeitzeugen gaben allerdings mehr als drei Viertel der Befragten an, sich während der Zeit des Nationalsozialismus niemals von der Staatsgewalt bedroht gefühlt zu haben. Dass sich das NS-Regime entgegen einstiger Rechtfertigungsversuche insgesamt auf eine weitreichende Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung stützte, zeigen ferner auch andere sozialwissenschaftlich angelegte Studien.
Mit Götz Alys „Hitlers Volksstaat“ geriet im Jahr 2005 nun ein Buch in den Blick der Öffentlichkeit, das die „Symbiose von Volksstaat und Verbrechen“ thematisiert und damit einen anderen, nämlich die Perspektive wechselnden Forschungsansatz „von der Elitenverantwortung“ hin „zum Nutznießertum des Volkes“ vollzieht. Die darin aufgestellte These von einer »Gefälligkeitsdiktatur«, die ihre Bürger mit steuer- und sozialpolitischen Konzessionen sowie mittels der Verbreitung des „Gefühl[s] von ökonomischer Erholung“ oder besser gesagt durch die in Aussichtstellung „einer nahen Zukunft, in der das Geld [quasi] auf der Straße liegen“ bzw. „in der Milch und Honig fließen“ würde, bestochen habe, erfährt am Ende des Buches ihre Zuspitzung in einem Zitat eines britischen Offiziers namens Julius Posener, der im April 1945 festgestellt haben soll: „Die Leute entsprachen der Zerstörung nicht. Sie sahen gut aus, rosig, munter, gepflegt und recht gut gekleidet. Ein ökonomisches System, das von Millionen fremder Hände und mit dem Raube des ganzen Erdteiles bis zum Ende aufrechterhalten wurde“ – so heißt es weiter –, zeige „hier seine Ergebnisse.“
Angesichts solch pointierter Aussagen, die eine materielle Anhebung der Versorgungslage der breiten Bevölkerung behaupten, hat es sich diese Arbeit, die das Lied der Augsburger Wohlfahrtserwerbslosen zum Titel hat, zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des Lebensstandards der Bevölkerung im Nationalsozialismus einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- 1 ZUM WIRTSCHAFTSAUFSCHWUNG IM NATIONALSOZIALISMUS
- 1.1 DIE WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG DEUTSCHLANDS ANFANG DER 1930ER JAHRE
- 1.2 FORSCHUNGSKONTROVERSE: DIE THESE VOM „KOMA VOR DER »MACHTERGREIFUNG<<\" VERSUS DIE THESE VOM „KRISENWENDEPUNKT IM HERBST 1932“
- 1.2.1 Über die Wirkung der NS-Konjunkturprogramme des Jahres 1933.
- 1.2.2 Über die Wirkungen des „,Neuen Plans“ von 1934....
- 1.2.3 Über die Wirkung des „, Vierjahresplans“ von 1936.
- 1.3 ZUSAMMENFASSENDES ZWISCHENFAZIT
- 2 ZUM KONSUM IM NATIONALSOZIALISMUS
- 2.1 DEFINITION: KONSUM/KONSUMGESELLSCHAFT (C. KEINSCHMIDT)
- 2.2 MABNAHMEN ZUR VEREINBARKEIT VON RÜSTUNGSWIRTSCHAFT & KONSUMAUSWEITUNG AUFGEZEIGT AM BEISPIEL AUGSBURGS
- 2.2.1 Produktions- & distributionspolitische Maßnahmen
- 2.2.1.1 Eingriffe in die unternehmerische Freiheit...
- 2.2.1.2 „Hurrah, die Butter ist alle!“ – Zur Verwaltung des Mangels.
- 2.2.1.3 Die Lage auf dem Markt: Ein Zwischenfazit
- 2.2.2 Lohn- & Preispolitik: Eine Betrachtung im Spiegel der amtlichen Statistik.....
- 2.2.2.1 Die Entwicklung der Löhne & Gehälter..\n
- 2.2.2.2 Die Entwicklung der Preise.
- 2.2.3 Vom Volksempfänger zum Volkswagen – Zur Rolle der „, Volksprodukte“.
- 2.2.3.1 ,,Radio für jeden Stand!“.
- 2.2.3.2 Massentourismus durch »Kraft durch Freude<
- 2.2.3.3 Die Technisierung des Haushalts.
- 3 ZUSAMMENFASSENDES FAZIT UND AUSBLICK..
- Der Wirtschaftsaufschwung im Nationalsozialismus
- Die Rolle des Konsums in der NS-Gesellschaft
- Konsumlenkende und -beschränkende Maßnahmen
- Die Funktion von „Volksprodukten“
- Die Frage nach der „Gefälligkeitsdiktatur“
- Kapitel 1 beleuchtet die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands Anfang der 1930er Jahre und untersucht die Forschungskontroverse um die These eines „Wirtschaftswunders“ im Nationalsozialismus. Es werden verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen der NS-Regierung und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft analysiert.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Konsum im Nationalsozialismus. Es werden die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Rüstungswirtschaft und Konsumausweitung, insbesondere am Beispiel Augsburgs, erläutert. Der Fokus liegt auf produktions- und distributionspolitischen Eingriffen, der Lohn- und Preispolitik sowie der Rolle von „Volksprodukten“.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung des Lebensstandards der Bevölkerung im Nationalsozialismus am Beispiel der Stadt Augsburg zu untersuchen. Sie analysiert die Frage nach der Existenz eines spezifischen NS-„Wirtschaftswunders“ und beleuchtet die konsumlenkenden und -beschränkenden Maßnahmen des NS-Regimes. Darüber hinaus wird die Rolle von „Volksprodukten“ und die Frage nach der Etablierung einer „Gefälligkeitsdiktatur“ durch die Regierung Hitler untersucht.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nationalsozialismus, Wirtschaftsentwicklung, Konsum, „Wirtschaftswunder“, Rüstungswirtschaft, „Volksprodukte“, „Gefälligkeitsdiktatur“, Lebensstandard, Augsburg.
Häufig gestellte Fragen
Gab es im Nationalsozialismus wirklich ein "Wirtschaftswunder"?
Die Arbeit untersucht kritisch die These einer "Gefälligkeitsdiktatur", die Bürger durch materielle Vorteile und das Versprechen auf Wohlstand bestochen habe.
Wie war die Konsumwirklichkeit in Augsburg zwischen 1933 und 1945?
Trotz Rüstungswirtschaft versuchte das Regime, durch Lohn- und Preispolitik sowie "Volksprodukte" einen gewissen Lebensstandard vorzutäuschen oder zu halten.
Was versteht man unter "Volksprodukten"?
Dazu gehörten der Volksempfänger, der Volkswagen und Angebote von "Kraft durch Freude" (KdF) für den Massentourismus.
Wie wurde der Mangel im Alltag verwaltet?
Durch produktions- und distributionspolitische Maßnahmen griff der Staat massiv in die unternehmerische Freiheit ein, um Engpässe (z. B. bei Butter) zu kontrollieren.
Stützte sich das NS-Regime auf die Akzeptanz der Bevölkerung?
Studien zeigen, dass viele Bürger sich nicht bedroht fühlten, sondern als "Nutznießer" des Systems agierten, solange die materielle Versorgung stabil schien.
- Quote paper
- Jacqueline Hänig (Author), 2013, Zur »Konsumwirklichkeit« im Nationalsozialismus der Stadt Augsburg 1933 bis 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310069