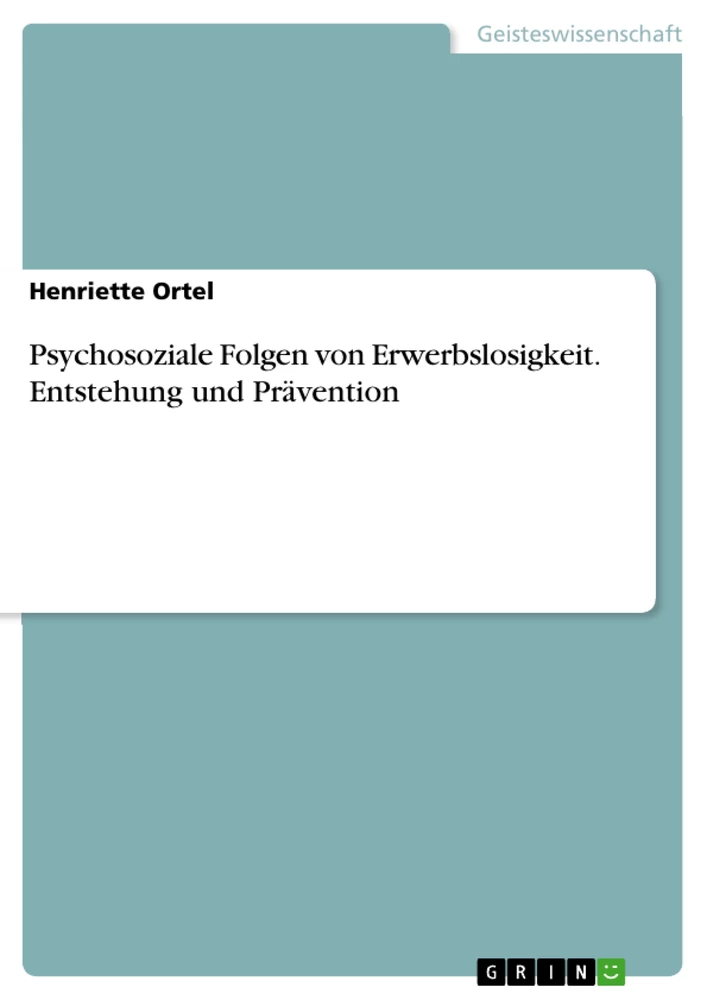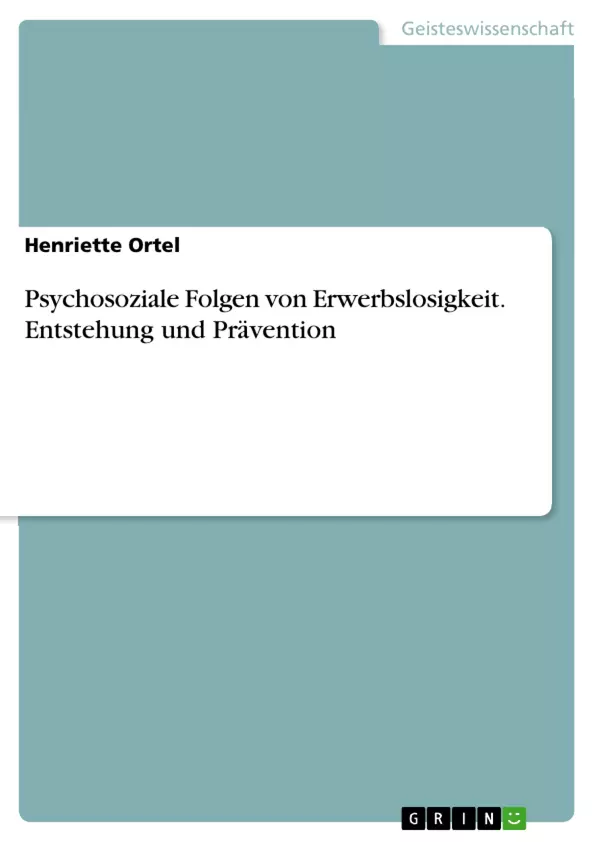Weltweit kommt es seit diversen Jahren zu beispielhaften und nachhaltigen Demonstrationen in mehreren Industrieländern, als Antwort auf die massiven Wirtschaftskrisen und die damit verbunden anhaltenden Staatsverschuldungen, die eine weltweite soziale Zwangslage verursacht haben. In 11 von 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) existieren nach wie vor Erwerbslosenquoten über der 10 Prozentmarke (vgl. DESTATIS). Auch wenn Deutschland im November 2014 mit 5,0 % die zweitniedrigste Erwerbslosenquote der EU besaß, vermitteln die vielen Betroffenen die hinter dieser Erwerbslosenquote stecken, dieser oben benannten Krise das menschliche Angesicht (vgl. DESTATIS).
Diese gravierenden individuellen Beeinträchtigungen werden zunehmend Gegenstand in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Forschungszweigen, auch wenn festzuhalten ist, dass diesbezüglich noch deutliche Forschungslücken existieren. Die Mehrheit der vorhandenen Untersuchungen wie zum Beispiel die Marienthal-Studie geht aus den Gebieten der gesundheitspsychologischen und sozialmedizinischen Forschung hervor und benennt als mögliche Auswirkungen von Erwerbslosigkeit die Endqualifizierung, die gesellschaftlich-kulturelle und soziale Isolation unter anderem durch Stigmatisierung, innerfamiläre Tensionen und Konflikte, Schuldgefühle, Depressionen, Aggressivität und trotz der bestehenden Grundsicherung auch die Verarmung. (vgl. Oschmiansky 2010).
Aber warum führt die Gegebenheit „Erwerbslosigkeit“ eigentlich zu gesundheitlichen Risiken und in der Konsequenz zu psychosozialen Folgen, während man doch denken könnte „endlich ausschlafen“, „endlich Dinge erledigen zu denen ich sonst keine Zeit hatte“, „endlich besitze ich Zeit für mich“? Die Antworten auf diese Fragen lassen sich nicht allein mit dem Fakt der Abwesenheit von Erwerbsarbeit begründen, sondern liegen in den besonderen Lebensumständen, die sich aus den diversen Gegebenheiten und Veränderungen ergeben, die die Situation der Arbeitslosigkeit mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Problemlage in der Bundesrepublik Deutschland
- 1.1. Bedeutung von Erwerbsarbeit
- 1.1.1. Soziale Aspekte
- 1.1.2. Finanzielle Aspekte
- 1.1.3. Lebensperspektive
- 1.1. Bedeutung von Erwerbsarbeit
- 2. Psychosoziale Folgen der Erwerbslosigkeit
- 2.1. Isolation/ Depression
- 2.2. Substanzmittelabusus
- 2.3. Selbstwert/ Selbstvertrauen/ Selbstachtung
- 2.4. Psychosomatische Erkrankungen
- 2.5. erhöhte Mortalität/ Suizidalität als Folge der (Dauer-) Erwerbslosigkeit.
- 3. Begünstigende Faktoren psychischer Folgen
- 3.1. Vulnerabilität / Persönlichkeitseigenschaften
- 3.2. Familie/Soziales Netzwerk/ Integration in Gesellschaft.
- 3.3. Bildungsniveau/ Gesellschaftsschicht
- 3.4. Alter
- 4. Präventionsmaßnahmen
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Ausarbeitung befasst sich mit den psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Entstehung dieser Folgen zu beleuchten und Präventionsmaßnahmen aufzuzeigen. Dabei werden die Folgen der Erwerbslosigkeit auf die individuelle Psyche und das soziale Umfeld des Betroffenen untersucht.
- Die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die soziale Integration und das Selbstverständnis des Einzelnen
- Die psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit wie Isolation, Depression, Substanzmissbrauch und psychosomatische Erkrankungen
- Faktoren, die die Entstehung psychosozialer Folgen begünstigen, wie Vulnerabilität, familiäre Strukturen, Bildungsniveau und Alter
- Mögliche Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung psychosozialer Folgen von Erwerbslosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 analysiert die Problemlage von Erwerbslosigkeit in Deutschland vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise. Es beleuchtet die Bedeutung von Erwerbsarbeit für soziale Integration, Selbstverständnis und finanzielle Stabilität. Kapitel 2 erörtert die psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit, die von Isolation und Depression über Substanzmissbrauch bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen und erhöhter Mortalität reichen. In Kapitel 3 werden Faktoren untersucht, die die Entstehung psychosozialer Folgen begünstigen, wie etwa Vulnerabilität, familiäre Strukturen, Bildungsniveau und Alter. Abschließend werden in Kapitel 4 mögliche Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung dieser Folgen aufgezeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Erwerbslosigkeit, Psychosoziale Folgen, Isolation, Depression, Substanzmissbrauch, Selbstwert, Selbstvertrauen, Psychosomatische Erkrankungen, Vulnerabilität, Präventionsmaßnahmen, Soziale Integration, Lebensqualität, Armut, Lebenskrise.
Häufig gestellte Fragen
Welche psychosozialen Folgen hat Erwerbslosigkeit?
Zu den Folgen zählen soziale Isolation, Depressionen, vermindertes Selbstwertgefühl, Substanzmissbrauch sowie psychosomatische Erkrankungen und eine erhöhte Suizidalität.
Warum ist Erwerbsarbeit so wichtig für die Psyche?
Arbeit bietet nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch soziale Kontakte, eine feste Tagesstruktur und ein Gefühl der gesellschaftlichen Zugehörigkeit und Anerkennung.
Welche Faktoren begünstigen psychische Probleme bei Arbeitslosigkeit?
Faktoren wie das Alter, ein niedriges Bildungsniveau, mangelnde familiäre Unterstützung und die individuelle Vulnerabilität (Persönlichkeitsstruktur) spielen eine entscheidende Rolle.
Was ist die Marienthal-Studie?
Die Marienthal-Studie ist eine klassische Untersuchung, die bereits früh die verheerenden Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit auf die psychische Gesundheit und das soziale Leben dokumentierte.
Gibt es Präventionsmaßnahmen gegen diese Folgen?
Ja, Präventionsmaßnahmen zielen darauf ab, die soziale Integration zu fördern, psychologische Unterstützung anzubieten und die Lebensperspektive der Betroffenen durch Qualifizierung zu stärken.
- Arbeit zitieren
- Henriette Ortel (Autor:in), 2015, Psychosoziale Folgen von Erwerbslosigkeit. Entstehung und Prävention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310094