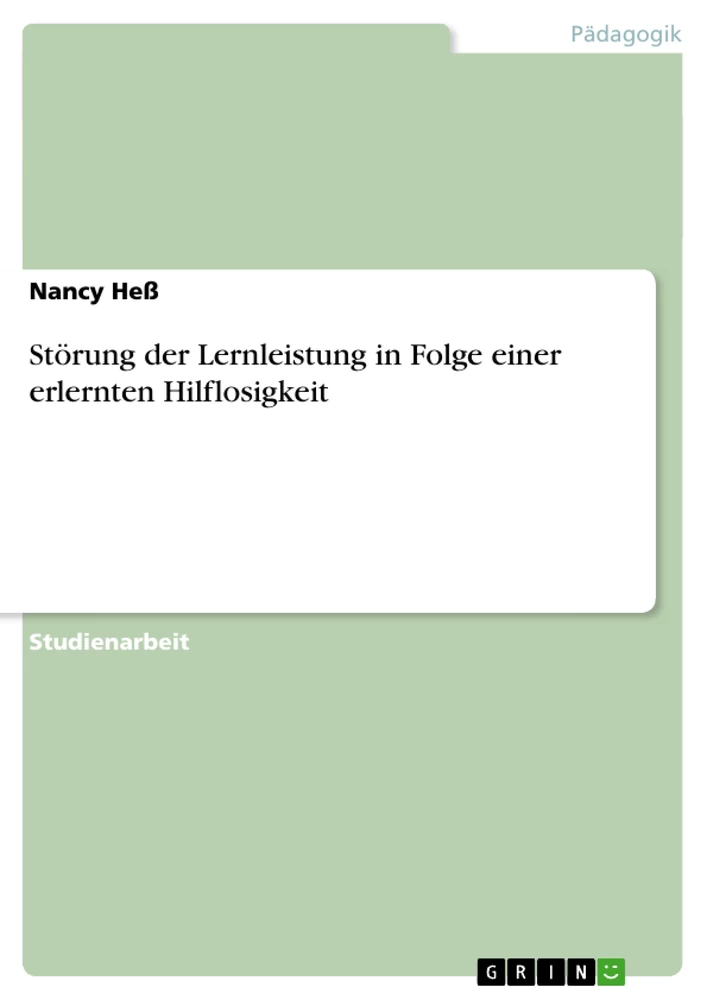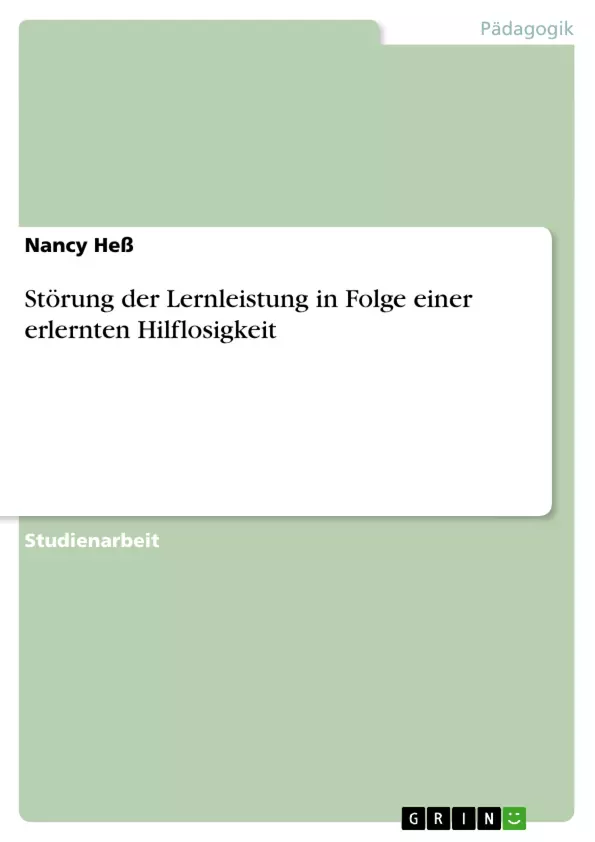Einleitung
Das Phänomen der Lernbeeinträchtigung ist ein aktuelles und vielseitig diskutiertes. Zunehmend füllen sich die Schulen mit Kindern, die den Anforderungen einer Regel- oder Hauptschule nur noch in den seltensten Fällen gerecht werden. Erhebungen des statistischen Bundesamtes zeigen im Vergleich (zweier Schuljahre) der Schuljahre 2000/01 und 2002/03, dass im Schuljahr 2002/03 insgesamt 8.900 Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2000/01 eine Sonderschule besuchten. Dies ist ein Anstieg von rund 2%. Obwohl diese Statistik alle verschiedenen Arten von Sonderschulen zusammengefasst betrachtet, so verdeutlicht sie doch den steigenden Bedarf an Sonderschulen. Besonders die statistische Erhebung über die Anzahl der Schulen zeigt eine steigende Tendenz im Sonderschulbereich auf und eine eher sinkende im Bereich anderer Schularten. Im Schuljahr 2000/01 gab es noch 3.380 Sonderschulen. Im Schuljahr 2002/03 hingegen sind 107 Sonderschulen mehr tätig. Das bedeutet einen Zuwachs von 3% (Statistisches Bundesamt 2004).
In der Schule für Lernbehinderte verspricht man Hilfe für die Kinder. Ein geregelter Tagesablauf und damit eine Grundlage für eine angenehmere Lernsituation soll geschaffen werden. Doch bleibt die Frage offen, ob alle didaktischen Bemühungen ihren Sinn erfüllen. Um dies zu klären, ist es von zentraler Bedeutung, von den Schülern zu erfahren, warum sie in eine Förderschule eingeschult oder in diese versetzt wurden. Nicht die Noten bilden die Basis der Versetzung, sondern der Grund, warum Noten schlecht sind und das Lernen verweigert wird. In Anbetracht dessen untersucht man mehrere Bereiche, die für die Situation der Schüler verantwortlich sind. Lernbehinderung lässt sich somit aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Zum einen kann man eine Störung des Lernens als ein von der Schule geschaffenes Konstrukt ansehen, das ohne die Anforderungen einer Schule niemals existieren würde. Auch könnte man es als ein im Kinde liegendes Defizit beschreiben. Diese Theorie ist jedoch fragwürdig, da sie eine eher stigmatisierende Art der Erklärung ist. Wesentlich verständlicher scheint die Erklärung von Lernschwächen über sozial benachteiligende Faktoren. Nach Kanter (1980) gibt es im psychosozialen Bereich Bedingungen, wie Zuwendung, Anerkennung, Familienstruktur usw., die im Kindesalter nicht ausreichend vorhanden sind und eine gestörte Entwicklung zur Folge haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ursprüngliche Fassung der Theorie der „Erlernten Hilflosigkeit“
- Das Konzept
- Definitionen und Merkmale
- Folgen der Hilflosigkeit
- Hauptteil
- Motivation als eine Lernbedingung
- Was ist Motivation?
- Motivationale Bedingungen des Lernens
- Mangelnde Lernmotivation
- Lernbeeinträchtigung als Folge mangelnder Lernmotivation (erlernter Hilflosigkeit)
- Auswirkungen auf die Lernfähigkeiten
- Auswirkungen im schulischen Kontext
- Motivation als eine Lernbedingung
- Schlussteil
- Eigene Meinung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Lernbehinderung, das im Kontext der erlernten Hilflosigkeit untersucht wird. Die Arbeit will die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (1975) vorstellen und deren Relevanz für die Lernbehindertenpädagogik erörtern. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Auswirkungen der erlernten Hilflosigkeit auf die Motivation und die Attribuierung von Misserfolgen gelegt.
- Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit
- Motivation als Lernbedingung
- Lernbeeinträchtigung durch mangelnde Motivation
- Die Auswirkungen von Attribuierungen auf den Lernerfolg
- Die Bedeutung von individuellen Voraussetzungen im Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beschäftigt sich mit dem aktuellen Problem der Lernbeeinträchtigung und dem steigenden Bedarf an Sonderschulen. Sie diskutiert verschiedene Blickwinkel auf das Phänomen der Lernbehinderung und stellt den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Lernschwierigkeiten her. Die Arbeit fokussiert auf motivationale Störungen als mögliche Ursache für Lernbehinderung.
Die ursprüngliche Fassung der Theorie der „Erlernten Hilflosigkeit“
Dieses Kapitel präsentiert Seligmans Theorie der erlernten Hilflosigkeit, die auf tierexperimentellen Studien basiert. Es beschreibt die Entstehung des Konzepts und erklärt die Auswirkungen der erlernten Hilflosigkeit auf das Verhalten und die Motivation von Lebewesen. Die Arbeit stellt die zentralen Elemente der Theorie dar, wie z.B. die Unkontrollierbarkeit von Reizen und die daraus resultierende Passivität.
Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Motivation als eine Lernbedingung. Es wird erläutert, welche Faktoren die Lernmotivation beeinflussen und wie sich mangelnde Motivation auf den Lernerfolg auswirken kann. Der Zusammenhang zwischen erlernter Hilflosigkeit und Lernbeeinträchtigung wird im Detail untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „erlernter Hilflosigkeit“?
Nach Seligman (1975) ist erlernte Hilflosigkeit ein Zustand, in dem Lebewesen die Überzeugung entwickeln, dass sie unangenehme Situationen nicht kontrollieren können. Dies führt zu Passivität und einem Mangel an Motivation.
Wie hängen erlernte Hilflosigkeit und Lernbehinderung zusammen?
Viele Schüler in Förderschulen zeigen Symptome erlernter Hilflosigkeit. Aufgrund ständiger Misserfolge im Regelschulsystem glauben sie, dass Anstrengung nichts bringt, was ihre Lernleistung weiter blockiert.
Welche Rolle spielt die Motivation beim Lernen?
Motivation ist eine zentrale Lernbedingung. Wenn sie durch erlernte Hilflosigkeit gestört ist, verweigern Kinder das Lernen, was oft fälschlicherweise als mangelnde Intelligenz interpretiert wird.
Was sind psychosoziale Faktoren für Lernschwierigkeiten?
Faktoren wie mangelnde Zuwendung, familiäre Instabilität oder fehlende soziale Anerkennung können die Entwicklung eines Kindes stören und die Basis für Lernbeeinträchtigungen schaffen.
Warum steigen die Schülerzahlen an Sonderschulen?
Statistiken zeigen einen wachsenden Bedarf an Förderschulen, was oft auf komplexe motivationale und soziale Probleme zurückzuführen ist, die im Regelschulsystem nicht ausreichend aufgefangen werden können.
- Citar trabajo
- Nancy Heß (Autor), 2004, Störung der Lernleistung in Folge einer erlernten Hilflosigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31016