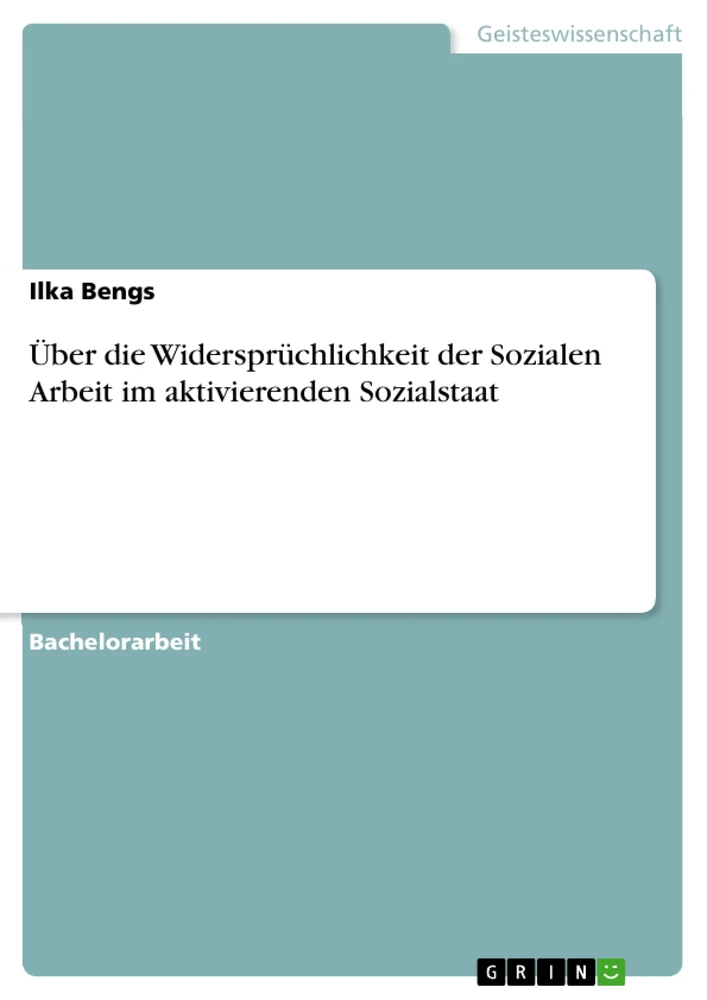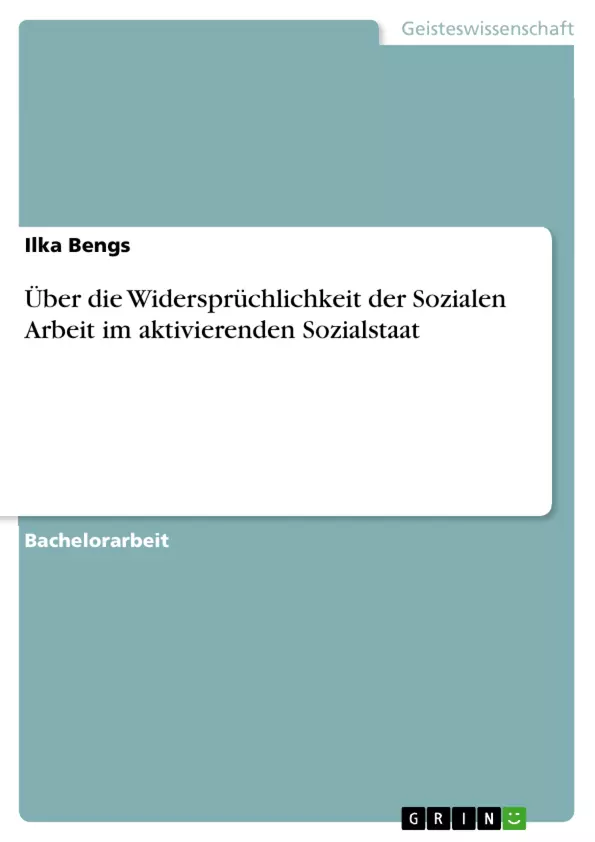Die deutsche Gesellschaft ist in den letzten Jahren einem enormen Wandel unterzogen worden. Durch Globalisierung, Finanzmisere, stetig steigender Staatsverschuldung, hoher Arbeitslosigkeit und anderen Problemen, sah der Staat enormen Handlungsbedarf. Auf die Empfehlungen der Europäischen Union in der Lissabon-Erklärung hin, Deutschland zu einem „aktiven und dynamischen Wohlfahrtsstaat“ zu modernisieren, wurde in Deutschland ab 2003 die „Agenda 2010“ eingeführt. Diese begründete maßgeblich die Transformation vom versorgenden Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Sozialstaat. Die Pfeiler des aktivierenden Sozialstaates sind die Aktivierung des Arbeitsmarktes, der öffentlichen Verwaltung und der Bürger. Durch diese Aktivierungen, die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die steigende soziale Unsicherheit verändert sich die Gesellschaft.
Im Zuge dieses Aktivierungssprozesses hat sich auch die Soziale Arbeit in ihrer Funktion, ihrer Struktur und der Professionalisierung gewandelt. Während die Zahl der Hilfsbedürftigen und die durch eben jene Krisen hervorgerufenen Komplexität der Fälle zunehmen (vgl. Seithe 2010, S. 98), wurde durch den aktivierenden Sozialstaat eine Ökonomisierung der Sozialen Arbeit eingeleitet. Im Zuge dessen wurden marktliche Instrumente wie Kontraktmanagement und Budgetierung, sowie der Wettbewerb untereinander implementiert. Dies an sich ist schon widersprüchlich, da die Soziale Arbeit "gerade als Antwort auf die Verwerfungen und Nebenwirkungen einer Marktgesellschaft ent¬standen" ist (Galuske 2007, S. 22). Damit werden „grundlegende Voraussetzungen und Basisorientierungen“ (Hering/Münchmeier 2000, S. 227) der Sozialen Arbeit in Frage gestellt, die während des sogenannten „sozialpädagogischen Jahrhunderts“ (Galuske 2008, S. 9) erarbeitet wurden. Die „vertrauten Denk- und Interpretationsfiguren, an denen sich die Soziale Arbeit über fast 130 Jahre ausrichten und ihr Funktionsbild bestimmen konnte“ (Hering/ Münchmeier 2000, S. 22), wurden damit aufgelöst (vgl. ebd.), so dass Galuske sogar so weit geht, das „Ende des sozialpädagogischen Jahrhunderts“ (Galuske 2007) einzuläuten.
Mit dem Ende des „sozialpädagogischen Jahrhunderts“ wird auch offenbar, dass „jene Widersprüche wieder neu aufbrechen, die ihre Geschichte von Anfang an begleitet haben“ (Hering/ Münchmeier 2000, S. 227). Damit meinen Hering/Münchmeier z.B. den „Widerspruch zwischen sozialpädagogischer Ausrichtung und sozialpolitischer Inpflichtnahme“ (ebd.), sowie den „Konflikt...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über den aktivierenden Sozialstaat
- Über den Begriff „aktivierender Sozialstaat“
- Über die Transformation zum aktivierenden Sozialstaat
- Über ökonomische Gründe
- Über politische Gründe
- Über die deutsche Unterschichtsdebatte
- Über den Neoliberalismus
- Über die Grundzüge des aktivierenden Sozialstaates
- Über die Aktivierung des Arbeitsmarktes
- Über die Aktivierung der Bürger
- zu mehr bürgerschaftlichem Engagement
- zur eigenverantwortlichen Integration in den Arbeitsmarkt
- zwischen Befähigung und Zwang
- Über die Aktivierung der Verwaltung
- Über die Aktivierungslogik der aktivierenden Sozialen Arbeit
- Über den Bürger im aktivierenden Sozialstaat
- Über die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat
- Über die Soziale Arbeit
- ... und das Ende des „sozialpädagogischen Jahrhunderts“
- ... als personenbezogene Dienstleistung
- ... und die Verbreitung der Aktivierungslogik
- ... und ihre Anerkennung
- Über den Wandel der Funktion
- Über den Wandel der Struktur
- Über den Wandel der Professionalisierung
- Über die Soziale Arbeit
- Fazit - Über die Widersprüchlichkeit der Sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Wandel der Sozialen Arbeit im Kontext des aktivierenden Sozialstaates und analysiert die daraus resultierenden Widersprüche. Ziel ist es, die Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Angesicht der ökonomischen und politischen Veränderungen zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Transformation des Sozialstaates von einem versorgenden zu einem aktivierenden Modell
- Wandel der Sozialen Arbeit in ihrer Funktion, Struktur und Professionalisierung
- Widersprüche zwischen den Zielen der Sozialen Arbeit und den Anforderungen des aktivierenden Sozialstaates
- Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und ihre Auswirkungen
- Herausforderungen für die professionelle Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Widersprüchlichkeit der Sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat ein. Sie beschreibt Widersprüche als logisch sich ausschließende Zustände und verortet diese sowohl im menschlichen Leben als auch in der Sozialen Arbeit. Der Wandel der deutschen Gesellschaft, geprägt von Globalisierung, Finanzkrise und steigender Arbeitslosigkeit, wird als Hintergrund für die Transformation zum aktivierenden Sozialstaat dargestellt. Die „Agenda 2010“ und die damit einhergehende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit werden als zentrale Auslöser für die Herausforderungen an die Profession benannt. Das „Ende des sozialpädagogischen Jahrhunderts“ und das Aufbrechen alter Widersprüche werden thematisiert, was die Notwendigkeit einer Analyse der aktuellen Situation unterstreicht.
Über den aktivierenden Sozialstaat: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „aktivierender Sozialstaat“ und seine Entstehung. Es beschreibt die Transformation vom versorgenden zum aktivierenden Modell, die sowohl aus ökonomischen als auch aus politischen Gründen resultiert. Die deutsche Unterschichtsdebatte und der Einfluss des Neoliberalismus werden als wichtige politische Faktoren genannt. Die Grundzüge des aktivierenden Sozialstaates werden anhand der Aktivierung des Arbeitsmarktes, der Bürger (mit Fokus auf bürgerschaftliches Engagement und eigenverantwortliche Integration) und der Verwaltung detailliert erklärt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Aktivierungslogik der Sozialen Arbeit gewidmet, die die Interaktion zwischen Bürger und Staat prägt.
Über die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat: Dieses Kapitel analysiert den Wandel der Sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat. Es behandelt die Veränderungen in der Funktion, der Struktur und der Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Das Ende des „sozialpädagogischen Jahrhunderts“ und die zunehmende Ökonomisierung mit marktlichen Instrumenten wie Kontraktmanagement und Budgetierung werden eingehend diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die Widersprüche zwischen den traditionellen Zielen der Sozialen Arbeit und den neuen ökonomischen Vorgaben, die grundlegende Voraussetzungen und Basisorientierungen der Profession in Frage stellen.
Schlüsselwörter
Aktivierender Sozialstaat, Soziale Arbeit, Agenda 2010, Ökonomisierung, Professionalisierung, Widersprüchlichkeit, Wandel, Aktivierung, Bürger, Verwaltung, Arbeitsmarkt, sozialpädagogisches Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: "Widersprüchlichkeit der Sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat"
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Wandel der Sozialen Arbeit im Kontext des aktivierenden Sozialstaates und analysiert die daraus resultierenden Widersprüche. Sie beleuchtet die Herausforderungen für die Soziale Arbeit aufgrund ökonomischer und politischer Veränderungen und diskutiert mögliche Lösungsansätze.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Transformation des Sozialstaates, den Wandel der Sozialen Arbeit in ihrer Funktion, Struktur und Professionalisierung, die Widersprüche zwischen den Zielen der Sozialen Arbeit und den Anforderungen des aktivierenden Sozialstaates, die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und ihre Auswirkungen sowie die Herausforderungen für die professionelle Praxis der Sozialen Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über den aktivierenden Sozialstaat, ein Kapitel über die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Wandel der deutschen Gesellschaft als Hintergrund. Das Kapitel über den aktivierenden Sozialstaat beleuchtet den Begriff, seine Entstehung und Grundzüge. Das Kapitel über die Soziale Arbeit analysiert den Wandel der Funktion, Struktur und Professionalisierung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Widersprüchlichkeiten.
Was wird unter „aktivierender Sozialstaat“ verstanden?
Der „aktivierende Sozialstaat“ ist ein Modell, das im Gegensatz zum versorgenden Sozialstaat die Eigenverantwortung und Aktivierung der Bürger betont. Die Transformation zu diesem Modell ist sowohl auf ökonomische als auch politische Gründe zurückzuführen, darunter die deutsche Unterschichtsdebatte und der Einfluss des Neoliberalismus. Er umfasst die Aktivierung des Arbeitsmarktes, der Bürger (durch bürgerschaftliches Engagement und eigenverantwortliche Integration) und der Verwaltung.
Wie hat sich die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat verändert?
Die Soziale Arbeit hat im aktivierenden Sozialstaat einen Wandel in ihrer Funktion, Struktur und Professionalisierung erfahren. Das „Ende des sozialpädagogischen Jahrhunderts“ und die zunehmende Ökonomisierung mit marktlichen Instrumenten wie Kontraktmanagement und Budgetierung sind wichtige Aspekte dieser Veränderung. Die Arbeit beleuchtet die Widersprüche zwischen den traditionellen Zielen der Sozialen Arbeit und den neuen ökonomischen Vorgaben.
Welche Widersprüche werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit identifiziert und analysiert die Widersprüche zwischen den traditionellen Zielen der Sozialen Arbeit (z.B. Unterstützung und Empowerment von Menschen) und den Anforderungen des aktivierenden Sozialstaates (z.B. Ökonomisierung, Eigenverantwortlichkeit und Aktivierung). Diese Widersprüche werden als logisch sich ausschließende Zustände betrachtet, die sowohl im menschlichen Leben als auch in der Sozialen Arbeit vorkommen.
Welche Rolle spielt die „Agenda 2010“?
Die „Agenda 2010“ wird als zentraler Auslöser für die Herausforderungen an die Soziale Arbeit genannt. Die damit einhergehende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit hat die traditionellen Ziele und Arbeitsweisen der Profession in Frage gestellt und zu neuen Widersprüchen geführt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Soziale Arbeit im aktivierenden Sozialstaat mit erheblichen Widersprüchen konfrontiert ist. Diese Widersprüche resultieren aus dem Spannungsfeld zwischen den traditionellen Zielen der Sozialen Arbeit und den ökonomischen und politischen Anforderungen des aktivierenden Sozialstaates. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Widersprüchen und die Suche nach Lösungsansätzen für eine zukunftsfähige Soziale Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Aktivierender Sozialstaat, Soziale Arbeit, Agenda 2010, Ökonomisierung, Professionalisierung, Widersprüchlichkeit, Wandel, Aktivierung, Bürger, Verwaltung, Arbeitsmarkt, sozialpädagogisches Jahrhundert.
- Citation du texte
- B.A. Ilka Bengs (Auteur), 2012, Über die Widersprüchlichkeit der Sozialen Arbeit im aktivierenden Sozialstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310177