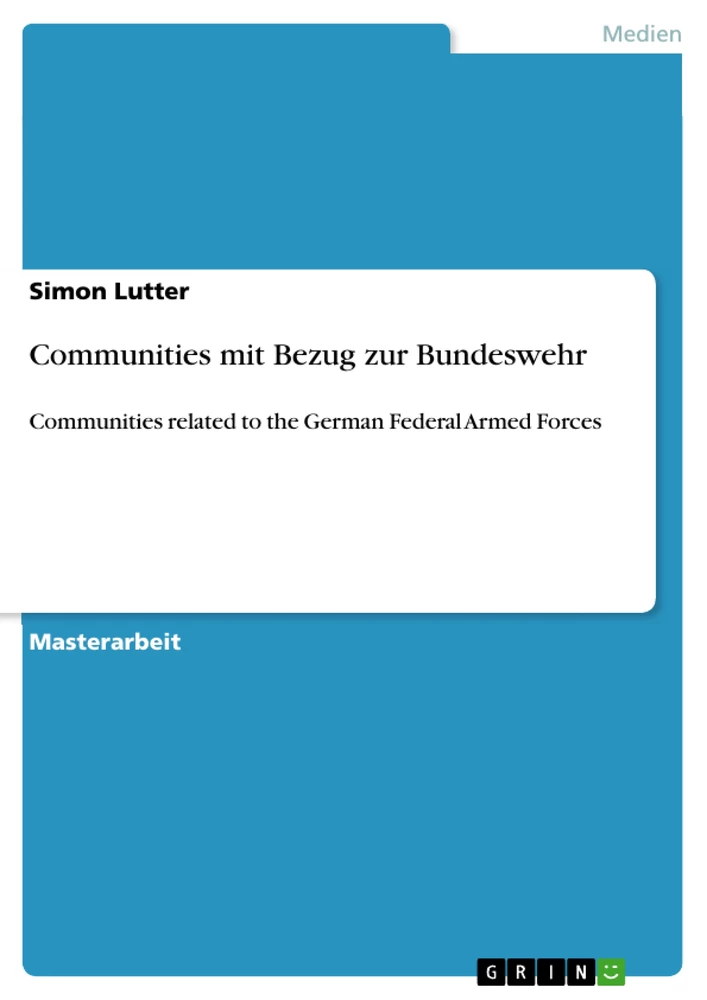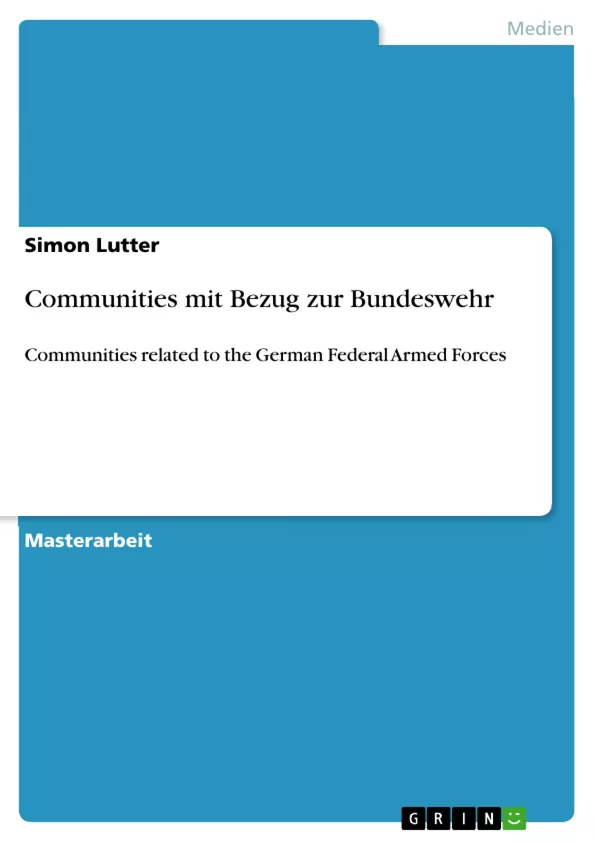„Without knowledge, an organization could not organize itself; it would be unable to maintain itself as a functioning enterprise.“
Mit dieser Aussage machten DAVENPORT/PRUSAK bereits vor über 10 Jahren darauf aufmerksam, dass Wissen einen, wenn nicht den entscheidenden Faktor für ein gut funktionierendes Unternehmen darstellt. „Wissen und Informationen gewinnen vor dem Hintergrund zum Teil rasanter gesellschaftlicher Veränderungen auch in der Bundeswehr – als Spiegelbild der Gesellschaft – eine immer größere Bedeutung“. Bedingt durch den demografischen Wandel, die zunehmende weltweite technische Vernetzung sowie die Abschaffung bzw. Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht sieht sich auch die Bundeswehr als Unternehmen einem zunehmenden Wettbewerb mit der zivilen Wirtschaft um adäquaten Nachwuchs ausgesetzt. Dies trifft besonders für den Bereich der jungen, fitten und motivierten Bewerber zu, die später z.T. auch wichtige Führungspositionen einnehmen sollen. Erschwerend hinzu kommt, dass sich die Bundeswehr dieser Herausforderung mitten in einer Reform- bzw. Transformationsphase mit signifikanter Personalreduzierung stellen muss.
Die Bundeswehr hat das strukturelle Defizit, dass gerade die akademisch gebildeten Führungskräfte im Durchschnitt alle zwei bis drei Jahre eine neue Verwendung bzw. einen neuen Dienstposten antreten. Und in nicht wenigen Fällen geschieht dies ohne eine ordentliche Übergabe an den Nachfolger, meist weil dieser, aus unterschiedlichsten Gründen, noch nicht verfügbar ist. Mit dem wegversetzten Offizier geht jedoch auch das auf dem ursprünglichen Dienstposten aufgebaute Wissen zu einem Großteil verloren. Der Nachfolger muss sich oft für dieselben Probleme, die sein Vorgänger hatte, nochmals Lösungen einfallen lassen.
Die Frage ist, wie das vorhandene Wissen zum einen für einen Dienstposten unabhängig von der bekleidenden Person gespeichert und zugänglich gemacht werden kann und zum anderen, auf welche Art und Weise die Vorgänger für ihre Nachfolger als Anlaufstelle bei Fragen erhalten werden können, auch wenn sich diese nicht mehr am Standort befinden. An diesem Punkt setzen die 2010 erlassenen Konzeptionellen Grundvorstellungen Wissensmanagement Bundeswehr (KGvWiMgmtBw) an. Die Bundeswehr hat mit dem Erlass der KGvWiMgmtBw die Bedeutung eines ganzheitlichen Wissensmanagements innerhalb der Streitkräfte erkannt und deutlich gemacht sowie ferner auch erste Forderungen und Weichenstellungen für dessen Implementierung [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Terminologische Verortung und Abgrenzung des Forschungsgegenstandes
- 2.1 Definition Online Community
- 2.2 Abgrenzung von Online Communities zu Netzwerken
- 3. Vorüberlegungen zur empirischen Erhebung
- 3.1 Vorgehensweise der Recherche
- 3.2 Überblick Communities mit Bezug zur Bundeswehr
- 3.2.1 Kriterien für die Auswahl der Erhebungseinheiten
- 3.2.2 Ergebnisse der Recherche
- 3.3 Ermittlung der Fragebedarfe
- 4. Empirische Erhebung
- 4.1 Methodisches Vorgehen
- 4.1.1 Wahl der Forschungsmethode
- 4.1.2 Methode der Online-Befragung
- 4.1.3 Auswahl der Stichprobe
- 4.1.4 Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums
- 4.1.4.1 Design des Fragebogens
- 4.1.4.2 Inhaltliche Bestandteile des Fragebogens
- 4.1.4.3 Grundlagen zur Durchführung der Online-Befragung
- 4.2 Ergebnisse der Online-Befragung
- 4.2.1 Soziodemografische Merkmale
- 4.2.2 Organisation der Community
- 4.2.3 Aktivität in der Community
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Masterarbeit untersucht die Rolle von Online-Communities mit Bezug zur Bundeswehr. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und den Einfluss dieser Communities auf die Bundeswehr zu gewinnen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Interaktion zwischen den Mitgliedern der Community, den Kommunikationsformen und den Auswirkungen dieser Communities auf die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr.
- Definition und Abgrenzung von Online-Communities mit Bezug zur Bundeswehr
- Analyse der Funktionsweise und des Einflusses dieser Communities
- Untersuchung der Interaktion und Kommunikation innerhalb der Communities
- Bewertung der Auswirkungen auf die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr
- Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Bundeswehr im Umgang mit Online-Communities
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 bietet eine einführende Darstellung des Forschungsgegenstandes und der Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert und grenzt den Begriff der Online-Community ab und stellt die verschiedenen Arten von Online-Communities mit Bezug zur Bundeswehr vor. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Vorüberlegungen zur empirischen Erhebung und beschreibt die Methodik der Recherche sowie die Auswahl der Erhebungseinheiten. Kapitel 4 erläutert die Ergebnisse der empirischen Erhebung, die mithilfe einer Online-Befragung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die soziodemografischen Merkmale der Befragungsteilnehmer, die Organisation der Communities und die Aktivität der Mitglieder analysiert. Kapitel 5 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Online-Community, Bundeswehr, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Kommunikation, Interaktion, Forschung, empirische Erhebung, Online-Befragung, Mitglieder, Aktivität, Funktionsweise, Einfluss.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Forschungsgegenstand dieser Masterarbeit?
Die Arbeit untersucht Online-Communities mit Bezug zur Bundeswehr und deren Einfluss auf die Organisation sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Warum ist Wissensmanagement für die Bundeswehr so wichtig?
Da Führungskräfte in der Bundeswehr oft alle zwei bis drei Jahre versetzt werden, droht ohne systematisches Wissensmanagement ein erheblicher Informationsverlust für die Nachfolger.
Welche methodische Vorgehensweise wurde gewählt?
Es wurde eine empirische Erhebung in Form einer Online-Befragung durchgeführt, um soziodemografische Merkmale, Organisation und Aktivität der Community-Mitglieder zu analysieren.
Wie unterscheiden sich Online-Communities von Netzwerken?
Die Arbeit widmet sich in Kapitel 2 der terminologischen Abgrenzung, um die spezifischen Merkmale von Online-Communities gegenüber allgemeinen Netzwerken herauszuarbeiten.
Welche Ziele verfolgt die Bundeswehr mit Wissensmanagement-Konzepten?
Ziel ist es, Wissen personunabhängig zu speichern und Vorgänger als Anlaufstellen für Nachfolger auch nach einer Versetzung verfügbar zu halten.
Gibt die Arbeit Handlungsempfehlungen für die Bundeswehr?
Ja, ein Ziel der Arbeit ist die Erstellung von Handlungsempfehlungen für den Umgang der Bundeswehr mit Online-Communities und Social Media.
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Simon Lutter (Autor:in), 2013, Communities mit Bezug zur Bundeswehr, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310270