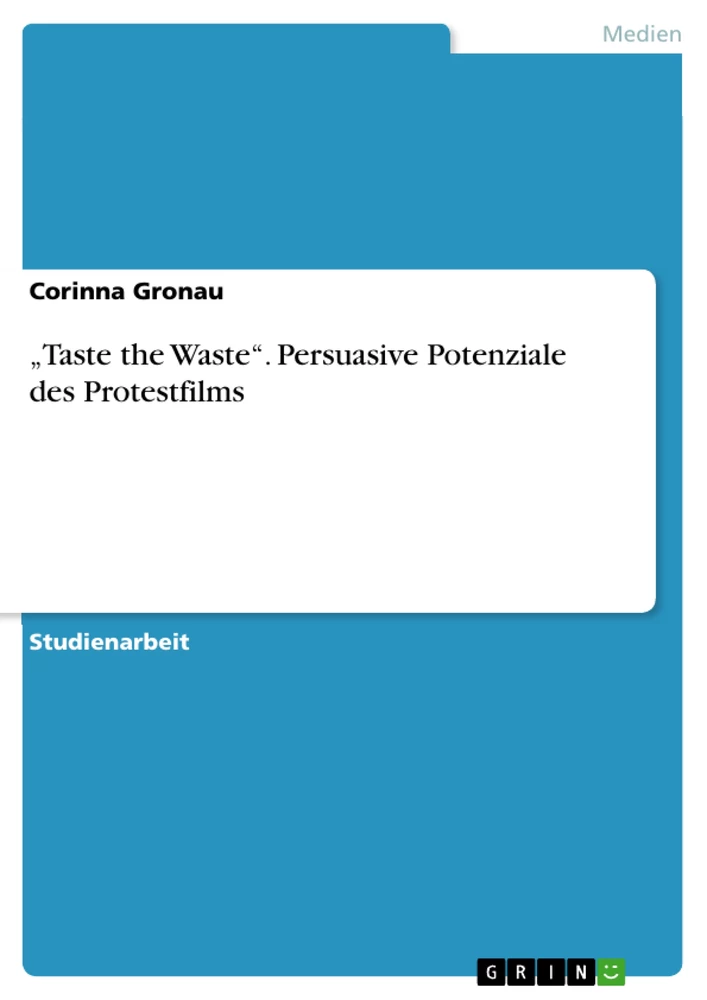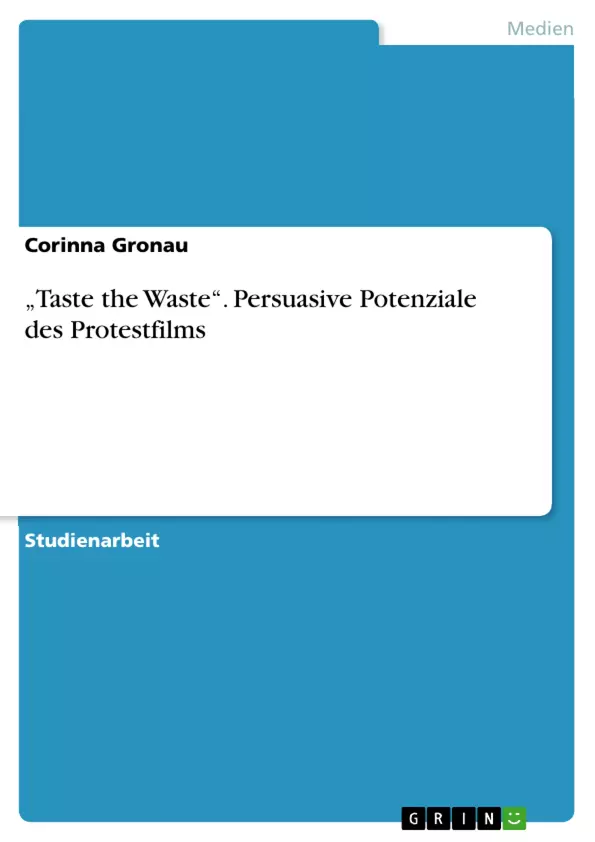Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Taste the Waste“ von Valentin Thurn ist mit über 120.000 Zuschauern in Deutschland der meistgesehene Dokumentarfilm 2011. Er handelt von der globalen Lebensmittelverschwendung der im Überfluss lebenden Industriegesellschaften.
Den Umwelt-Medienpreis 2011 der Deutschen Umwelthilfe erhielt „Taste the Waste“ mit der Begründung, dass der Film seit seinem Kinostart eine intensive bundesweite Debatte über den Umgang mit unserer Nahrung ausgelöst habe; mehr könne eine Dokumentation kaum erreichen.
Die große mediale Aufmerksamkeit und die hohen Besucherzahlen drängen auch hier die Frage auf: Wie überzeugt der Film die Zuschauer? Welche Mittel werden zur Persuasion eingesetzt? Wie entsteht mit Nichols gesprochen die einzigartige „Stimme“ von „Taste the Waste“? Dafür sollen die Bilder bzw. Einstellungen, die Montage und der Einsatz von Musik im Film näher betrachtet werden; auch im Vergleich zur Fernsehreportage „Frisch auf den Müll. Die globale Lebensmittelverschwendung“, die dasselbe Thema behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Dokumentarfilm
- TASTE THE WASTE
- Filmfakten und Hintergründe
- Filmanalyse: Persuasive Potentiale
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die persuasiven Potentiale des Dokumentarfilms am Beispiel von Valentin Thurns „Taste the Waste“. Ziel ist es, die Überzeugungsmittel des Films zu analysieren und zu verstehen, wie er die Zuschauer beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Filmanalyse hinsichtlich der Bildsprache, Montage und Musik.
- Der Dokumentarfilm als persuasives Medium
- Analyse der Bildsprache in „Taste the Waste“
- Die Rolle der Musik und der Montage in der persuasiven Wirkung
- Globale Lebensmittelverschwendung als zentrales Thema
- Vergleich mit der Fernsehreportage „Frisch auf den Müll“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dokumentarfilm: Die Einleitung beleuchtet den Dokumentarfilm als kommerziell erfolgreiches Genre, das über umstrittene Sachverhalte aufklären möchte. Sie diskutiert die Debatte um Objektivität und Authentizität in Dokumentationen und hebt die persuasive Funktion des Mediums hervor. Der Text verweist auf Bernward Wember's Kritik an der Illusion der Objektivität und betont die Bedeutung der Stimme und des Arrangements (Bilder, Sound, Montage) eines Films als Mittel der Überzeugung. Die Arbeit will die persuasiven Potentiale von Dokumentarfilmen anhand von „Taste the Waste“ untersuchen.
TASTE THE WASTE: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Dokumentarfilm "Taste the Waste" von Valentin Thurn, seinem Erfolg und seiner Auswirkung auf die öffentliche Debatte um Lebensmittelverschwendung. Es beschreibt den Film als den meistgesehenen Dokumentarfilm des Jahres 2011 in Deutschland und erläutert den Kontext des Films im Hinblick auf Thurns frühere Arbeit ("Gefundenes Fressen"). Die große mediale Aufmerksamkeit und der Erfolg des Films werfen erneut die Frage nach der persuasiven Wirkung von Dokumentarfilmen auf. Im folgenden Kapitel wird die Filmanalyse erfolgen, um die Mittel der Persuasion im Film zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Dokumentarfilm, Persuasion, „Taste the Waste“, Filmanalyse, Bildsprache, Montage, Musik, Lebensmittelverschwendung, Überzeugungsmittel, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen zu "Analyse der persuasiven Potentiale des Dokumentarfilms 'Taste the Waste'"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die persuasiven Potentiale des Dokumentarfilms "Taste the Waste" von Valentin Thurn. Sie untersucht, wie der Film seine Zuschauer beeinflusst und welche Mittel er hierfür einsetzt.
Welche Aspekte des Films werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Bildsprache, die Montage und die Musik des Films. Es wird untersucht, wie diese Elemente zur persuasiven Wirkung beitragen.
Welche Themen werden neben der Filmanalyse behandelt?
Neben der Filmanalyse wird der Dokumentarfilm als persuasives Medium im Allgemeinen behandelt. Die Arbeit beleuchtet auch das Thema der globalen Lebensmittelverschwendung und stellt einen Vergleich mit der Fernsehreportage "Frisch auf den Müll" an.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung zum Dokumentarfilm als Genre, ein Kapitel über den Film "Taste the Waste" inklusive seiner Hintergründe und seines Erfolgs, eine detaillierte Filmanalyse und ein Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung diskutiert den Dokumentarfilm als kommerziell erfolgreiches Genre, die Debatte um Objektivität und Authentizität und die persuasive Funktion des Mediums. Sie bezieht sich auf Bernward Wember's Kritik an der Illusion der Objektivität und betont die Bedeutung von Bild, Ton und Montage als Überzeugungsmittel.
Was wird im Kapitel über "Taste the Waste" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Erfolg des Films "Taste the Waste", seinen Kontext im Hinblick auf Thurns frühere Arbeit ("Gefundenes Fressen") und die damit verbundene Frage nach der persuasiven Wirkung von Dokumentarfilmen. Es dient als Grundlage für die folgende Filmanalyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dokumentarfilm, Persuasion, "Taste the Waste", Filmanalyse, Bildsprache, Montage, Musik, Lebensmittelverschwendung, Überzeugungsmittel, Medienwirkung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Überzeugungsmittel des Films "Taste the Waste" zu analysieren und zu verstehen, wie er die Zuschauer beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Analyse der Bildsprache, Montage und Musik.
- Quote paper
- Corinna Gronau (Author), 2013, „Taste the Waste“. Persuasive Potenziale des Protestfilms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310292