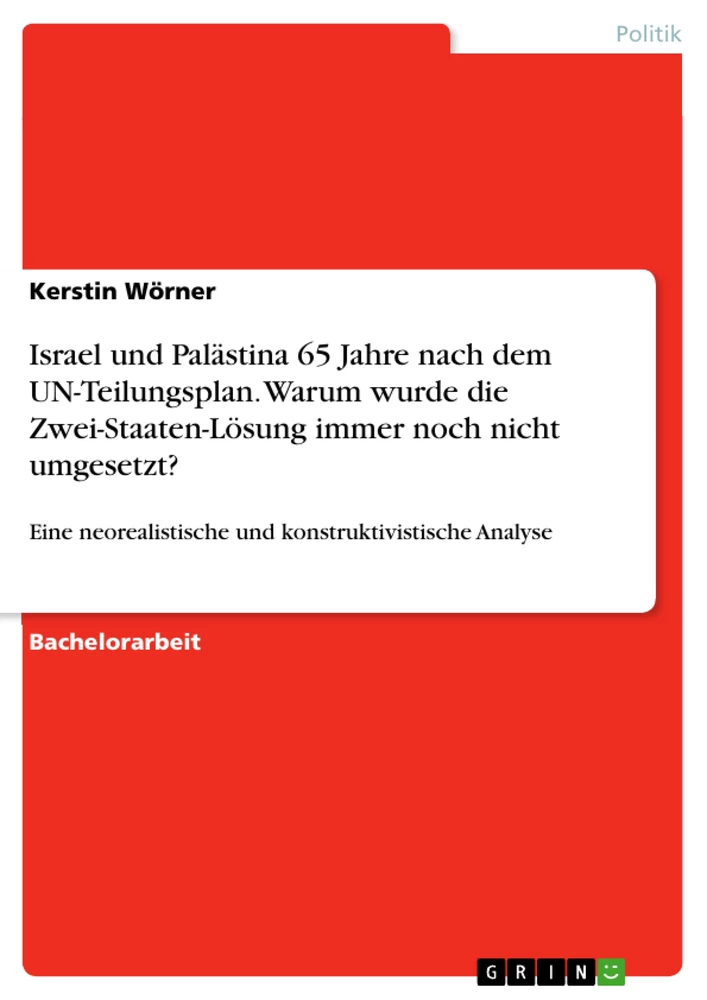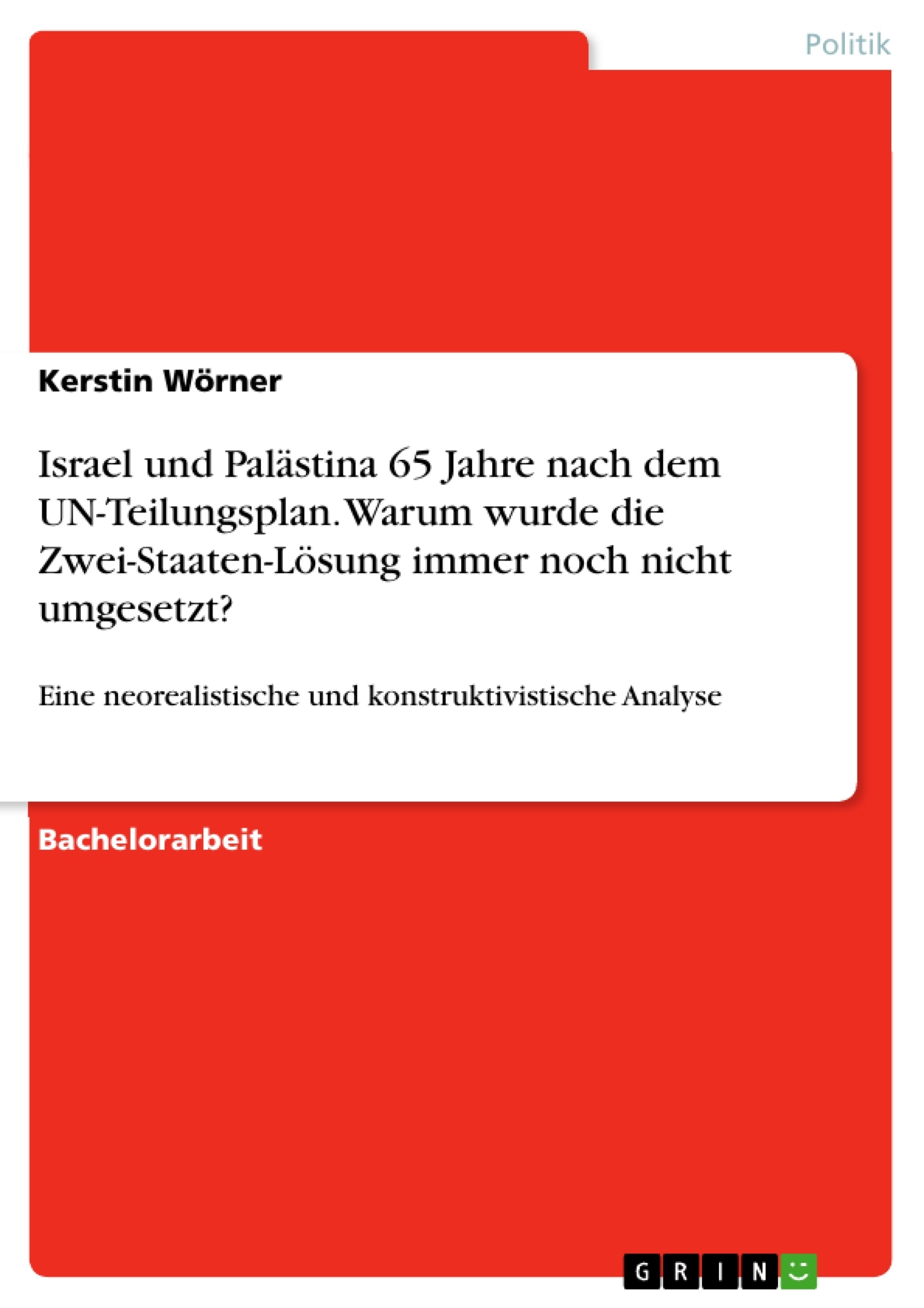Die Ursache sowie die Lösung für den Nahostkonflikt, genauer dem israelisch-palästinensischen Konflikt, lassen sich an dem UN Teilungsplan vom 29. November 1947 bereits erkennen: Das ehemalige britische Mandatsgebiet Palästina soll in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufgeteilt werden (vgl. UNITED NATIONS official documents 1947: 131ff.). Über 65 Jahre später ist dieser Konflikt einer der längsten, nicht gelösten Konflikte der Welt und die vorgeschlagene Zwei-Staaten-Lösung ist, trotz kollektiven Bemühungen der Weltgemeinschaft, bisher nicht umgesetzt worden. Dies führt zur Leitfrage dieser Arbeit: Welches Interesse hat Israel und welches Interesse hat Palästina an der Zwei-Staaten-Lösung?
Diese Frage soll unter Bezugnahme auf zwei Theorien der Internationalen Beziehungen untersucht werden: dem Neorealismus und dem Konstruktivismus. Die zentrale Analyseeinheit in beiden Theorien: „Staaten“, die in einem Zustand der Anarchie leben, in der es keine übergeordnete Instanz gibt, die für verbindliches Recht und Sicherheit sorgt. Zu den Primärzielen eines Staates zählen Sicherheit, Autonomie und wirtschaftliches Wohl – diese Ziele können durch Macht erreicht werden – Macht ist aber kein Ziel an sich.
Im Neorealismus, geprägt durch Kenneth N. Walz, konditioniert die materielle Struktur das Verhalten der Staaten. Im Konstruktivismus, geprägt durch Alexander Wendt wird dies nur bedingt angenommen. Im Neorealismus sind die Beziehungen zwischen Staaten feindlicher Natur und auf den Erhalt im System ausgerichtet, was ein sich permanent erneuerndes Machtgleichgewicht bedeutet (vgl. WALZ 1979: 128). Im Konstruktivismus interagieren Staaten in einem historischen, kulturellen und sozialen Kontext – geprägt von Ideen, Normen und Vorstellungen über die Identität eines Akteurs sowie dessen Verhältnis zu anderen Akteuren (vgl. WENDT 1992: 389).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erklärungsstrategien Internationaler Beziehungen
- Neorealismus
- Konstruktivismus
- Historischer Abriss des israelisch-palästinensischen Konflikts und Status Quo der Zwei-Staaten-Lösung
- Land für Frieden? Israelischer Siedlungsbau im Westjordanland und Ost-Jerusalem
- „Gespaltenes“ Palästina: Hamas in Gaza, PLO/Fatah im Westjordanland
- Neorealistische Analyse
- Israel
- Palästina
- Konstruktivistische Analyse
- Israel
- Palästina
- Auswertung der Analysen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, warum die Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt trotz des UN-Teilungsplans von 1947 immer noch nicht umgesetzt wurde. Sie analysiert die Interessen Israels und Palästinas an dieser Lösung unter Verwendung neorealistischer und konstruktivistischer Theorien der Internationalen Beziehungen. Die Analyse berücksichtigt die Rolle von Machtstrukturen und konstruierten Identitäten im Konflikt.
- Analyse des israelisch-palästinensischen Konflikts unter Anwendung neorealistischer und konstruktivistischer Perspektiven.
- Untersuchung der Interessen Israels und Palästinas bezüglich der Zwei-Staaten-Lösung.
- Bewertung des Einflusses von Machtstrukturen (Neorealismus) auf den Konflikt.
- Analyse der Rolle von Ideen, Normen und Identität (Konstruktivismus) im Konflikt.
- Beurteilung des Status Quo der Zwei-Staaten-Lösung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des israelisch-palästinensischen Konflikts ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Interessen Israels und Palästinas an der Zwei-Staaten-Lösung. Sie begründet die Wahl des neorealistischen und konstruktivistischen Ansatzes zur Analyse und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Erklärungsstrategien Internationaler Beziehungen: Dieses Kapitel präsentiert die neorealistische und konstruktivistische Theorie der Internationalen Beziehungen. Es erläutert die Kernannahmen beider Theorien, den Fokus auf die Staaten als zentrale Akteure in einem anarchischen System, und hebt die Unterschiede in ihren Erklärungsmustern für zwischenstaatliches Verhalten hervor, insbesondere bezüglich der Rolle von Macht und Identität.
Historischer Abriss des israelisch-palästinensischen Konflikts und Status Quo der Zwei-Staaten-Lösung: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über den Konflikt, beginnend mit dem UN-Teilungsplan von 1947. Es beleuchtet wichtige Entwicklungsetappen und den aktuellen Status Quo, mit besonderem Fokus auf den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und Ost-Jerusalem sowie die politische Spaltung Palästinas zwischen Hamas in Gaza und der PLO/Fatah im Westjordanland. Der Abschnitt stellt den historischen Kontext für die anschließenden Analysen dar.
Schlüsselwörter
Zwei-Staaten-Lösung, Israelisch-Palästinensischer Konflikt, Neorealismus, Konstruktivismus, Internationale Beziehungen, Macht, Identität, Siedlungsbau, UN-Teilungsplan, Hamas, PLO/Fatah.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des israelisch-palästinensischen Konflikts
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Gründe für das Scheitern der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt, trotz des UN-Teilungsplans von 1947. Es untersucht die Interessen Israels und Palästinas an dieser Lösung unter Anwendung neorealistischer und konstruktivistischer Theorien der Internationalen Beziehungen.
Welche Theorien werden angewendet?
Das Dokument verwendet den Neorealismus und den Konstruktivismus als theoretische Rahmen, um die Interessen und Handlungen von Israel und Palästina zu analysieren. Der Neorealismus konzentriert sich auf Machtstrukturen, während der Konstruktivismus die Rolle von Ideen, Normen und Identitäten betont.
Welche Aspekte des Konflikts werden behandelt?
Das Dokument behandelt den historischen Kontext des Konflikts, beginnend mit dem UN-Teilungsplan von 1947. Es analysiert den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und Ost-Jerusalem, die politische Spaltung Palästinas zwischen Hamas und PLO/Fatah, und den aktuellen Status Quo der Zwei-Staaten-Lösung.
Wie wird der Konflikt analysiert?
Der Konflikt wird sowohl aus neorealistischer als auch aus konstruktivistischer Perspektive analysiert. Es werden die jeweiligen Interessen Israels und Palästinas unter Berücksichtigung von Machtstrukturen (Neorealismus) und konstruierten Identitäten (Konstruktivismus) untersucht.
Welche Kapitel enthält das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, Kapitel zu den Erklärungsstrategien Internationaler Beziehungen (Neorealismus und Konstruktivismus), einen historischen Abriss des Konflikts und den Status Quo der Zwei-Staaten-Lösung, neorealistische und konstruktivistische Analysen (für Israel und Palästina jeweils), eine Auswertung der Analysen, und ein Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung ist es, die Interessen Israels und Palästinas an der Zwei-Staaten-Lösung zu verstehen und zu analysieren, warum diese trotz des UN-Teilungsplans bis heute nicht umgesetzt wurde. Der Einfluss von Machtstrukturen und konstruierten Identitäten auf den Konflikt wird dabei untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Zwei-Staaten-Lösung, Israelisch-Palästinensischer Konflikt, Neorealismus, Konstruktivismus, Internationale Beziehungen, Macht, Identität, Siedlungsbau, UN-Teilungsplan, Hamas, PLO/Fatah.
- Quote paper
- Kerstin Wörner (Author), 2013, Israel und Palästina 65 Jahre nach dem UN-Teilungsplan. Warum wurde die Zwei-Staaten-Lösung immer noch nicht umgesetzt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310322