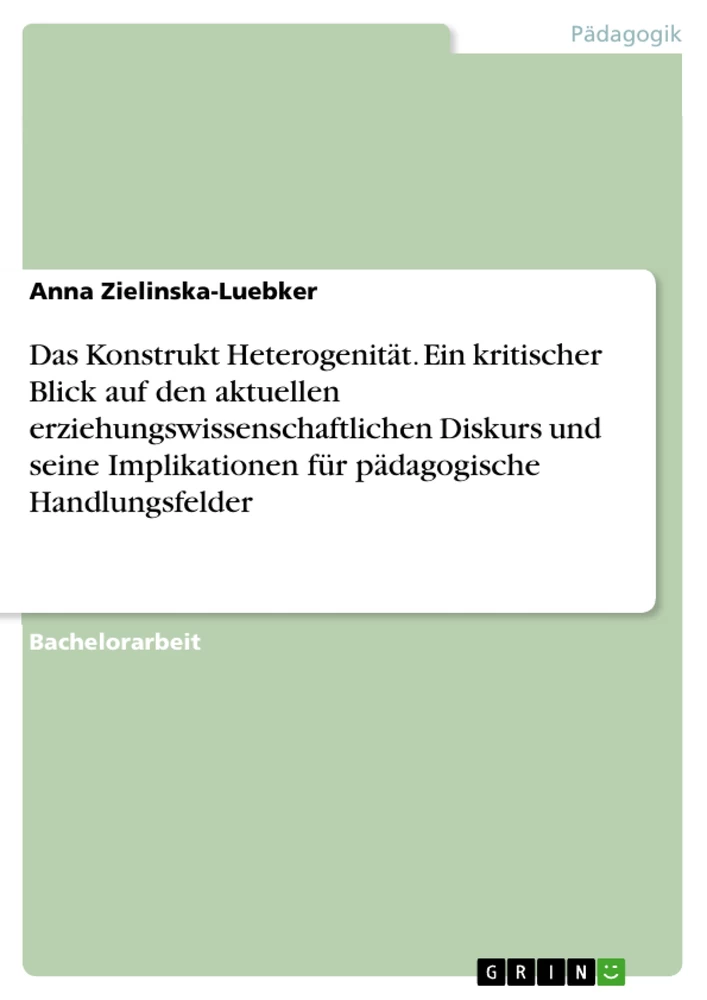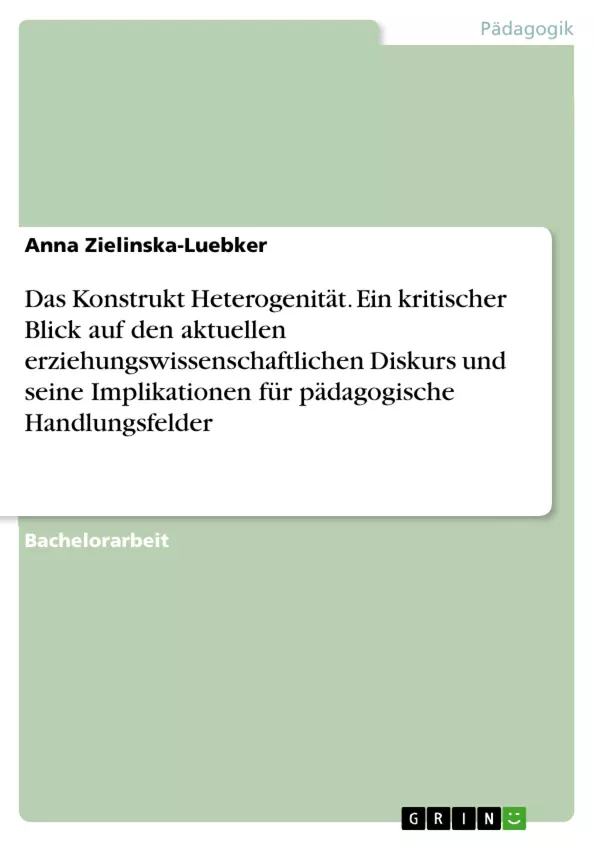Heterogenität und der Umgang damit kann als pädagogisches Dauerthema der letzten Jahrzehnte bezeichnet werden. Der Diskurs beinhaltet sowohl (erziehungs-)wissenschaftliche, als auch (praxis-)pädagogische Beiträge, aber auch detaillierte „Anleitungen“, wie mit Verschiedenheit umzugehen sei. Die Betrachtung von Heterogenität in pädagogischen Handlungsfeldern leitet sich ab vom „Diversity Management“, einem aus den USA stammenden Personalmanagement-Konzept, das Differenzen von Mitarbeitern produktiv nutzen und eine Art Leitsatz für Gleichstellungsarbeit darstellt.
Damit soll einerseits die Effizienz und Wirtschaftlichkeit gesteigert werden, indem noch nicht erschlossene, verborgene Ressourcen der Mitarbeiter ermittelt werden, andererseits soll aber auch die Benachteiligung sozialer Grupper (durch Mechanismen des Rassismus oder Sexismus) verhindert werden (vgl. Heidsiek 2009). Die Parallelen zum schulpädagogischen Heterogenitätsdiskurs sind unübersehbar.
In dieser Arbeit soll ein kritischer Blick auf diesen Diskurs über Heterogenität in pädagogischen Feldern geworfen werden. Viele Autoren machen auf Dissonanzen in der Auseinandersetzung mit Heterogenität im pädagogischen Diskurs aufmerksam; Dissonanzen, die sowohl für die pädagogischen Akteure, als auch für andere Bereiche des Bildungssystems und der Gesellschaft zahlreiche Folgen mit sich bringen. Der Frage nach diesen Folgen geht diese Arbeit aus zweierlei Perspektiven nach: der pädagogischen und der soziologischen, insbesondere unter der Berücksichtigung systemtheoretischer Annahmen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Heterogenität? Die Frage ohne abschließende Antwort
- 2.1 Das Konglomerat der Differenzlinien, Merkmale, Eigenschaften und Dimensionen
- 2.2 Theorien rund um Heterogenität
- 2.2.1 Heterogenität und Konstruktivismus
- 2.2.2 Exkurs: Konstruktivismus vs. Essentialismus
- 2.2.3 Intersektionalität
- 3. Das Bildungssystem in soziologischer Perspektive und Schultheorie
- 3.1 Systemtheoretische Perspektiven
- 3.2 Schule als Organisation und als Institution und Schultheorie
- 4. Der Umgang mit Heterogenität in der Pädagogik früher und heute
- 4.1 Früher
- 4.1.1 Exkurs zum Problem der Moral
- 4.2 Heute
- 4.2.1 Maßnahmen des Umgangs mit Heterogenität – Makroebene
- 4.2.2 Maßnahmen des Umgangs mit Heterogenität – Mesoebene
- 4.2.3 Maßnahmen des Umgangs mit Heterogenität - Mikroebene
- 5. Folgen des Heterogenitätsdiskurses für pädagogische Handlungsfelder
- 5.1 Pädagogische Akteure in unauflösbaren Handlungswidersprüchen
- 5.2 Verlagerung der äußeren Differenzierung nach innen – Verschiebung oder Lösung der Probleme?
- 5.3 Pädagogische und gesellschaftliche Realität und die Notwendigkeit der Spezialdisziplinen
- 5.4 Gesamtgesellschaftliche Folgen: Soziale Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit
- 5.5 Das Normkind
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert den aktuellen Diskurs über Heterogenität in pädagogischen Handlungsfeldern. Ziel ist es, die Definition und Thematisierung von Heterogenität in diesem Diskurs kritisch zu beleuchten und die Auswirkungen auf pädagogisches Handeln zu erforschen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Dissonanzen im Diskurs gewidmet, die sowohl für pädagogische Akteure als auch für andere Bereiche des Bildungssystems und der Gesellschaft weitreichende Folgen haben.
- Die Definition und Thematisierung von Heterogenität im aktuellen pädagogischen Diskurs
- Die Folgen des Heterogenitätsdiskurses für pädagogisches Handeln
- Die Rolle von Konstruktivismus und Intersektionalität in der Auseinandersetzung mit Heterogenität
- Die Relevanz von Systemtheorie und Schultheorie für die Analyse des Bildungssystems im Kontext von Heterogenität
- Die Auswirkungen des Heterogenitätsdiskurses auf die Überwindung von Spezialdisziplinen in der Erziehungswissenschaft und auf die Förderung von Bildungsgerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 widmet sich der Frage nach der Definition von Heterogenität und stellt fest, dass der Begriff über die bloße Feststellung der Unterschiedlichkeit von Schülern hinausgeht. Kapitel 3 beleuchtet das Bildungssystem aus soziologischer Perspektive und betrachtet die Systemtheorie und Schultheorie als relevante theoretische Rahmen für die Analyse des Umgangs mit Heterogenität. Kapitel 4 verfolgt die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität in der Pädagogik, von früheren Ansätzen der Homogenisierung bis hin zu aktuellen Forderungen nach einem produktiven Umgang mit Vielfalt. Kapitel 5 untersucht die Folgen des Heterogenitätsdiskurses für pädagogische Handlungsfelder, insbesondere die Rolle von pädagogischen Akteuren, die Verlagerung von Differenzierungsprozessen und die Bedeutung von Spezialdisziplinen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Heterogenität, Pädagogik, Bildungssystem, Diskursanalyse, Konstruktivismus, Intersektionalität, Systemtheorie, Schultheorie, Bildungsgerechtigkeit, Soziale Ungleichheit, Spezialdisziplinen, Pädagogische Akteure, Handlungswidersprüche.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Heterogenität im pädagogischen Kontext?
Heterogenität bezeichnet die Verschiedenartigkeit von Lernenden hinsichtlich Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht, Begabung oder sozialem Status.
Was ist Diversity Management?
Ein ursprünglich aus den USA stammendes Konzept, das personelle Vielfalt als Ressource nutzt, um Effizienz zu steigern und gleichzeitig Diskriminierung zu verhindern.
Was bedeutet Intersektionalität?
Intersektionalität beschreibt die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen oder Differenzlinien (z. B. Rasse und Klasse) in einer Person.
Welche Kritik gibt es am aktuellen Heterogenitätsdiskurs?
Kritiker bemängeln Dissonanzen, wie etwa den Widerspruch zwischen der Forderung nach Individualität und dem gleichzeitigen Festhalten an Leistungsnormen („Normkind“).
Wie wirkt sich der Diskurs auf die soziale Ungleichheit aus?
Die Arbeit untersucht, ob die Maßnahmen zur Förderung von Heterogenität tatsächlich zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen oder bestehende Ungleichheiten lediglich verschieben.
- Citar trabajo
- Anna Zielinska-Luebker (Autor), 2013, Das Konstrukt Heterogenität. Ein kritischer Blick auf den aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskurs und seine Implikationen für pädagogische Handlungsfelder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310356