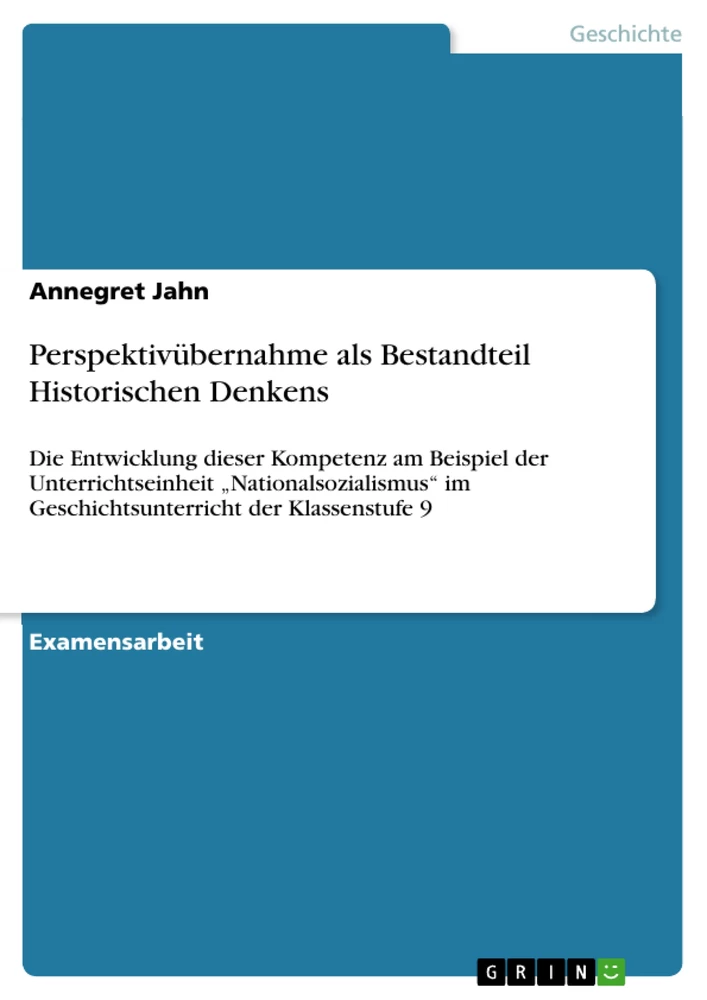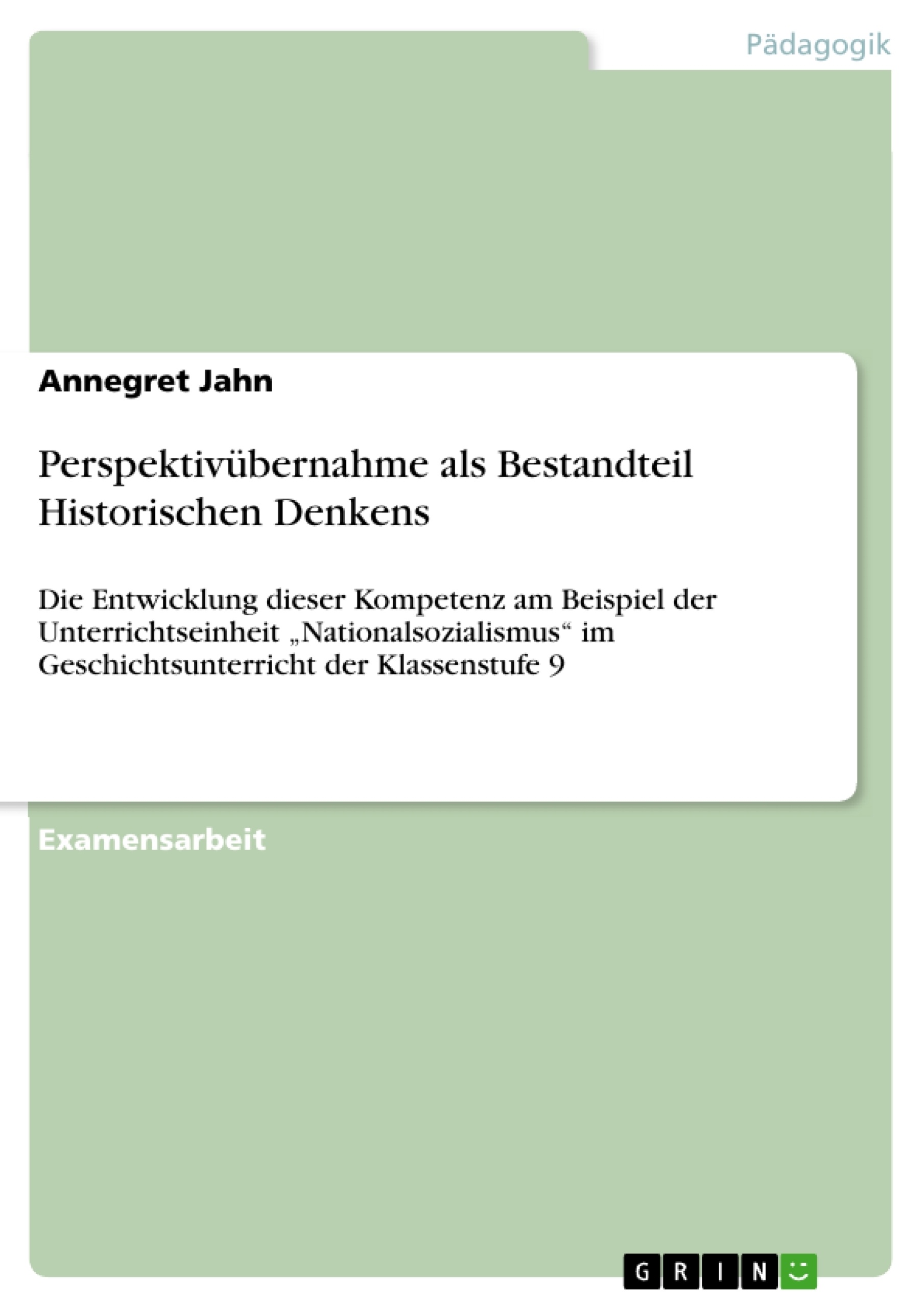Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme stellt eine wichtige, aber auch sehr komplexe Kompetenz im Geschichtsunterricht dar. Die Schüler sollen befähigt werden, die Menschen in der Geschichte nicht abzuwerten oder zu diffamieren, sondern ihnen offen und tolerant gegenüber zu treten sowie deren Handlungen und Entscheidungen auf dem Hintergrund von Informationen zu den jeweiligen Rahmenbedingungen der Menschen in der Geschichte sachlich zu beurteilen.
Die Fähigkeit der Perspektivübernahme besitzen die Schüler nicht von vornherein, denn erst ein entwicklungspsychologischer Prozess steuert die unterschiedlichen Stufen dieser Fähigkeit. Zudem ist die Ausbildung dieser Fähigkeit auf eine Förderung angewiesen. Hierbei spielen der Geschichtsunterricht und die Fachlehrer eine wichtige Rolle: Sie sind angehalten, mit multiperspektivischen Materialien und geeigneten Sachinformationen den Schülern die Perspektivübernahme zu erleichtern. Wie zu zeigen sein wird, ist die Perspektivübernahme im Geschichtsunterricht eine besondere Herausforderung.
Im Geschichtsunterricht der Klasse 9.5 hatte ich die Gelegenheit, die eventuell bereits ausgebildete Fähigkeit der Schüler vorerst zu überprüfen und diese im Anschluss daran weiterzuentwickeln. Die Fachlehrerin stellte mir dafür im Rahmen meines begleiteten Unterrichts in dieser Klasse einige Doppelstunden zur Verfügung.
Der durchgeführte Unterrichtsversuch wird in der vorliegenden Arbeit nun reflektiert. Dabei werden in einem ersten großen Teil Überlegungen zum Thema Perspektivübernahme als Bestandteil Historischen Denkens angestellt (Kapitel 2), anschließend wird in einem zweiten Teil die empirische Untersuchung selbst beschrieben (Kapitel 3). Einen letzten großen Teil bildet die Auswertung dieser Untersuchung (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorüberlegungen und Begründung des Themas
- 2.1 Themenwahl, Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2.2 Einordnung des Themas in den Lehrplan und Lernziele
- 2.3 Diskussion theoretischer Erkenntnisse
- 2.4 Empirische Gesamtplanung und experimentelle Fragestellungen
- 2.5 Variantendiskussion des methodischen Vorgehens
- 3 Darstellung der empirischen Untersuchung
- 3.1 Beschreibung und Eingrenzung der Lerninhalte
- 3.2 Beschreibung der Lerngruppe
- 3.3 Begründung, Darstellung und Reflexion einer ausgewählten Unterrichtssequenz
- 4 Zusammenfassung
- 4.1 Vergleich von Zielsetzung und Ergebnissen
- 4.2 Theoretische Reflexion und Aussagen zur Untersuchung
- 4.3 Eignung der angewandten Methoden
- 4.4 Auswertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
- 4.5 Konsequenzen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kompetenz der Perspektivübernahme im Geschichtsunterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum Nationalsozialismus in der Klassenstufe 9. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Perspektivübernahme zu diskutieren und Rückschlüsse auf die Gestaltung des Geschichtsunterrichts zu ziehen. Die Untersuchung soll verallgemeinerbare Erkenntnisse liefern, die auch auf andere Themengebiete anwendbar sind.
- Perspektivübernahme als Bestandteil historischen Denkens
- Entwicklung der Perspektivübernahme bei Schülern
- Einordnung der Perspektivübernahme in den Lehrplan und Lernziele
- Gestaltung des Geschichtsunterrichts zur Förderung der Perspektivübernahme
- Reflexion einer empirischen Untersuchung zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Perspektivübernahme im Geschichtsunterricht ein und beschreibt die Bedeutung dieser Kompetenz für ein tolerantes und sachliches Verständnis historischer Ereignisse. Sie skizziert den Ablauf der Arbeit, der aus theoretischen Überlegungen, der Beschreibung der empirischen Untersuchung und deren Auswertung besteht.
2 Vorüberlegungen und Begründung des Themas: Dieses Kapitel erläutert die Themenwahl, die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Es ordnet das Thema in den Lehrplan und die Lernziele ein und diskutiert relevante theoretische Erkenntnisse zur Perspektivübernahme. Besonderes Augenmerk liegt auf entwicklungspsychologischen Aspekten und der Einordnung der Kompetenz in das historische Denken. Schließlich wird die empirische Gesamtplanung und das methodische Vorgehen dargelegt.
3 Darstellung der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die sich mit der Entwicklung der Perspektivübernahme bei Schülern im Geschichtsunterricht befasst. Es beinhaltet die Beschreibung der Lerninhalte, der Lerngruppe und eine detaillierte Darstellung und Reflexion einer ausgewählten Unterrichtssequenz. Der Fokus liegt auf der Methodik und der Durchführung der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Perspektivübernahme, Historisches Denken, Geschichtsunterricht, Nationalsozialismus, Empirische Untersuchung, Lehrplan, Lernziele, Entwicklungspsychologie, Toleranz, Bildungsstandards.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Perspektivübernahme im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kompetenz der Perspektivübernahme im Geschichtsunterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit zum Nationalsozialismus in der Klassenstufe 9. Sie zielt darauf ab, theoretische Grundlagen der Perspektivübernahme zu diskutieren und daraus Rückschlüsse auf die Gestaltung des Geschichtsunterrichts zu ziehen. Die Ergebnisse sollen verallgemeinerbar und auf andere Themengebiete anwendbar sein.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Perspektivübernahme als Bestandteil historischen Denkens, der Entwicklung der Perspektivübernahme bei Schülern, ihrer Einordnung in Lehrplan und Lernziele, der Gestaltung des Geschichtsunterrichts zur Förderung der Perspektivübernahme und der Reflexion einer empirischen Untersuchung zu diesem Thema.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Vorüberlegungen und Begründung des Themas, Darstellung der empirischen Untersuchung und Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein. Kapitel 2 erläutert die Themenwahl, Problemstellung, Zielsetzung, ordnet das Thema in den Lehrplan ein, diskutiert theoretische Erkenntnisse und beschreibt die empirische Planung. Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung inklusive Lerninhalte, Lerngruppe und einer Unterrichtssequenz. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen, vergleicht Zielsetzung und Ergebnisse, reflektiert die angewandten Methoden und zieht Schlussfolgerungen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Überlegungen mit einer empirischen Untersuchung. Die genaue Methodik der empirischen Untersuchung wird in Kapitel 3 detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Beobachtung und Reflexion einer ausgewählten Unterrichtssequenz.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Zusammenfassung (Kapitel 4) präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, vergleicht diese mit der Zielsetzung und reflektiert die Eignung der angewandten Methoden. Es werden Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Perspektivübernahme, Historisches Denken, Geschichtsunterricht, Nationalsozialismus, Empirische Untersuchung, Lehrplan, Lernziele, Entwicklungspsychologie, Toleranz, Bildungsstandards.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrer*innen des Geschichtsunterrichts, Lehramtsstudierende, Bildungswissenschaftler*innen und alle, die sich mit der Förderung von historischem Denken und der Entwicklung von Perspektivübernahme bei Schülern beschäftigen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit. Die Arbeit selbst enthält eine ausführliche Darstellung der theoretischen Grundlagen und der empirischen Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- Annegret Jahn (Autor:in), 2012, Perspektivübernahme als Bestandteil Historischen Denkens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310407