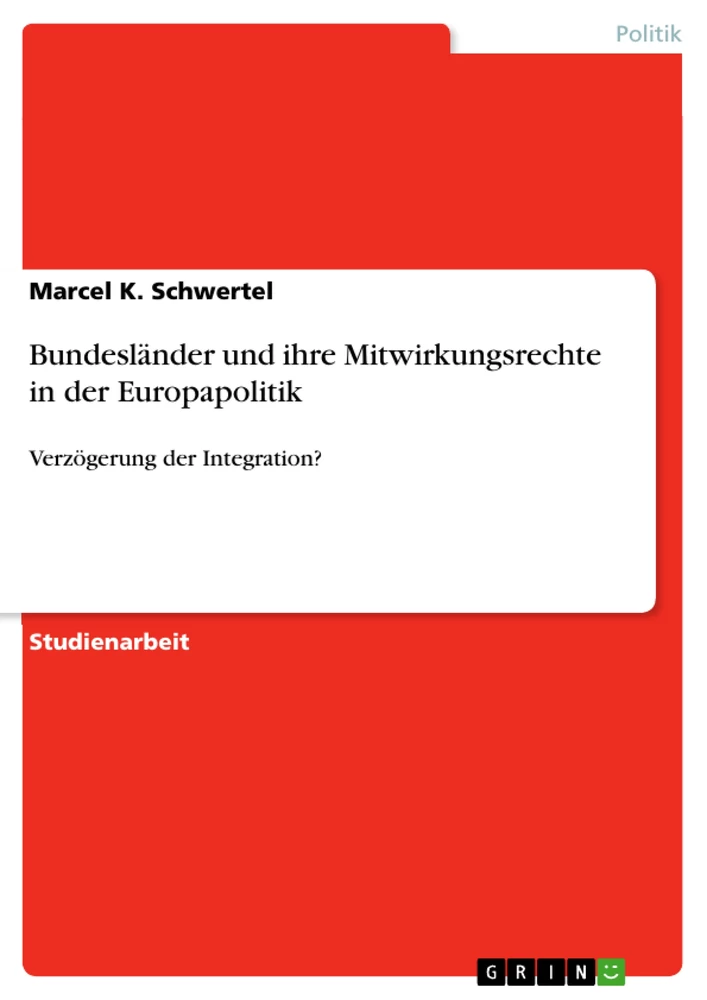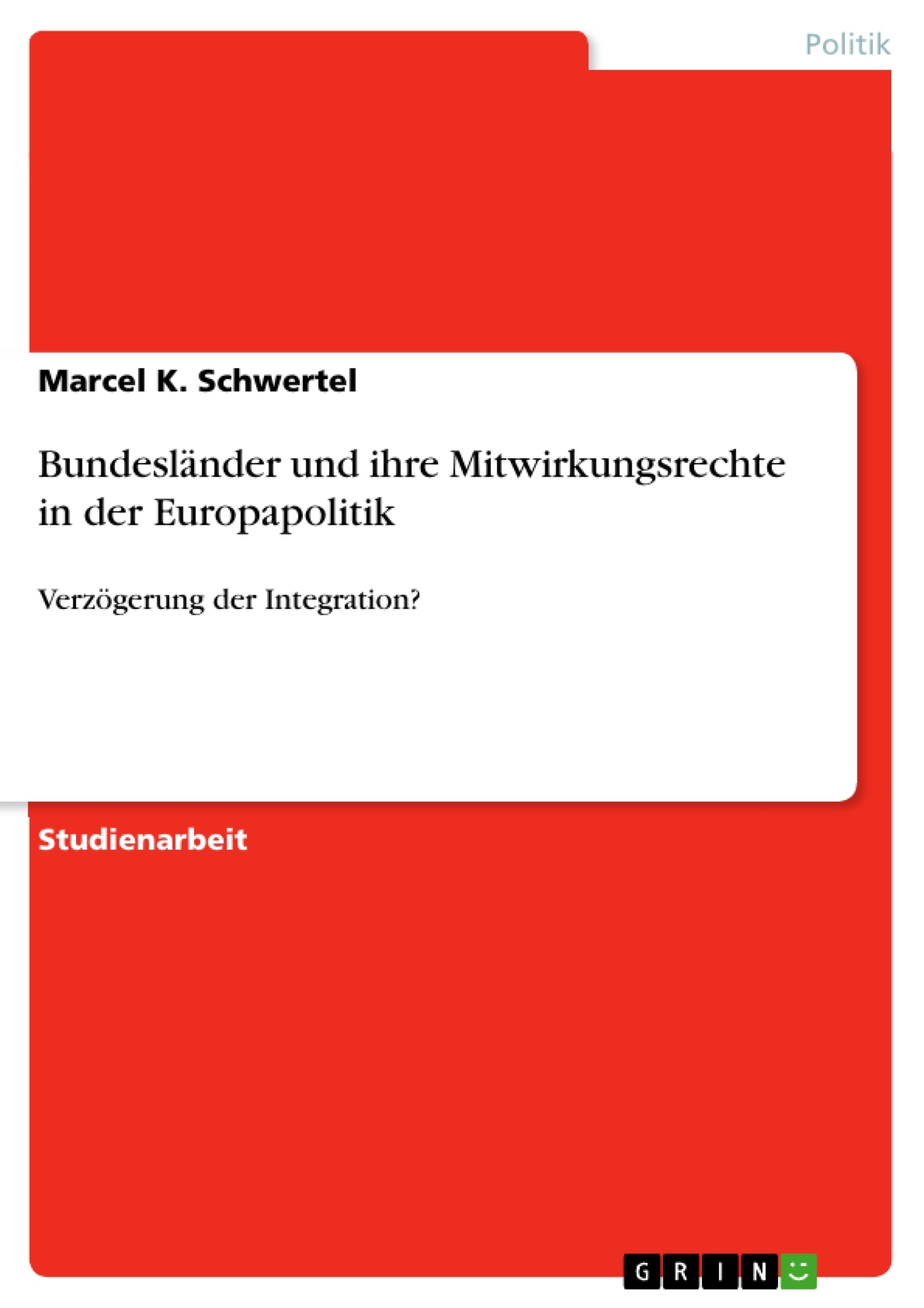Diese Arbeit möchte die Mitwirkung und Kompetenzen der sechzehn deutschen Bundesländer innerhalb der Europäischen Union näher beleuchten. Dabei wird ein Überblick über die verschiedenen Abschnitten der europäischen Integration gegeben, welche die deutschen Bundesländer betreffen. Die aufgezeigten Abschnitte sind dabei die Einheitliche Europäische Akte (EEA, 1986), sowie die später folgenden und zusammenhängenden Verfassungswerke von Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2003) und Lissabon (2009).
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, setzten die Staaten Europas alles daran, eine neue und friedlichere Ordnung, in West-, sowie später auch in Mittel- und Osteuropa aufzubauen. Besonders zu Beginn förderten die beiden Nachbarstaaten Frankreich und Deutschland gemeinsam den Prozess der wirtschaftlichen und geldpolitischen Einigung der europäischen Staaten. Der erste Schritt war die EGKS, die durch Robert Schuman und Jean Monnet mitbegründet wurde (Weidenfeld 2012: 103). Der voranschreitende Prozess dieser Vereinigung, führte zu sehr komplexen und interdependenten Strukturen innerhalb der Europäischen Union. Ein Teil davon ist unter anderem die Mitwirkung auf regionaler Ebene. Für diese regionale Ebene stehen in der Bundesrepublik Deutschland die verschiedenen Bundesländer.
Dabei ist Deutschland ein Sonderfall. Bis in das Jahr 1995 hinein war die Bundesrepublik das einzige Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft, das, eine föderale Struktur (mit der Verbindung von Bundestag und Bundesrat) aufwies.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einleitung
- II. Domestizierungsansatz nach Sebastian Harnisch
- III. Relevanz und Fragestellung
- IV. Grundlagen der Beziehungen zwischen den Bundesländern und Europäischer Union
- V. Die Einheitliche Europäische Akte (1985-87)
- VI. Der Vertrag von Maastricht (1992/93)
- VII. Der Vertrag von Amsterdam (1997-99)
- VIII. Der Vertrag von Nizza (2000-2001)
- IX. Der Vertrag von Lissabon (2009)
- X. Schlussbetrachtung
- XI. Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Rolle der deutschen Bundesländer innerhalb der Europäischen Union und analysiert, ob ihre Forderungen nach mehr Mitwirkungsrechten in der Europapolitik von 1986 bis 2009 zu einer Verzögerung der europäischen Integration führten. Der Fokus liegt dabei auf der Kompetenzverteilung zwischen den Bundesländern und der EU, insbesondere im Kontext der verschiedenen Verträge und der damit verbundenen Änderungen.
- Die Auswirkungen der europäischen Integration auf den deutschen Föderalismus.
- Der Domestizierungsansatz von Sebastian Harnisch und seine Anwendung auf die deutsche Europapolitik.
- Die Rolle des Europaartikels 23 im Grundgesetz und des Subsidiaritätsprinzips.
- Die Analyse der Verträge von Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon in Bezug auf die Kompetenzen der Bundesländer.
- Die Hypothese, dass die Einbindung der Forderungen der Bundesländer die europäische Integration verlangsamte.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt die Fragestellung ein. Sie beleuchtet die Entwicklung der europäischen Integration und die Rolle der deutschen Bundesländer in diesem Prozess.
- Domestizierungsansatz nach Sebastian Harnisch: Dieses Kapitel erläutert die Theorie des Domestizierungsansatzes von Sebastian Harnisch und zeigt auf, wie dieser Ansatz zur Analyse der Kompetenzveränderungen der deutschen Bundesländer im Kontext der europäischen Integration verwendet werden kann.
- Relevanz und Fragestellung: Dieses Kapitel unterstreicht die Relevanz der Arbeit und leitet aus dieser die konkrete Fragestellung ab. Es beleuchtet auch die verschiedenen Perspektiven auf das Thema, wie sie von verschiedenen Forschern vertreten werden.
- Grundlagen der Beziehungen zwischen den Bundesländern und Europäischer Union: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Grundlagen der Beziehungen zwischen den deutschen Bundesländern und der Europäischen Union, wobei wichtige Konzepte wie der Europaartikel 23 im Grundgesetz und das Subsidiaritätsprinzip beleuchtet werden.
- Die Einheitliche Europäische Akte (1985-87): Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Einheitlichen Europäischen Akte auf die Kompetenzen der Bundesländer und untersucht, ob diese Auswirkungen eine Verzögerung der europäischen Integration bewirkten.
- Der Vertrag von Maastricht (1992/93): Dieses Kapitel setzt sich mit den Auswirkungen des Vertrags von Maastricht auf die Kompetenzen der Bundesländer auseinander und betrachtet, inwiefern dieser Vertrag zu einer Verzögerung der europäischen Integration beigetragen hat.
- Der Vertrag von Amsterdam (1997-99): Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen, die der Vertrag von Amsterdam für die Kompetenzen der Bundesländer brachte, und untersucht, ob diese Veränderungen eine Verzögerung der europäischen Integration verursachten.
- Der Vertrag von Nizza (2000-2001): Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Vertrags von Nizza auf die Kompetenzen der Bundesländer und betrachtet, ob dieser Vertrag eine Verzögerung der europäischen Integration verursachte.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der europäischen Integration, dem deutschen Föderalismus, der Kompetenzverteilung zwischen den Bundesländern und der Europäischen Union, dem Domestizierungsansatz, dem Europaartikel 23, dem Subsidiaritätsprinzip und den Verträgen von Maastricht, Amsterdam, Nizza und Lissabon. Die Arbeit untersucht, ob die Forderungen der deutschen Bundesländer nach mehr Mitwirkungsrechten in der Europapolitik von 1986 bis 2009 zu einer Verzögerung der europäischen Integration führten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen die deutschen Bundesländer in der EU?
Die Bundesländer wirken über den Bundesrat an der Europapolitik mit. Deutschland ist ein Sonderfall, da es lange das einzige EU-Mitglied mit einer stark ausgeprägten föderalen Struktur war.
Was besagt der Artikel 23 des Grundgesetzes?
Der sogenannte „Europaartikel“ regelt die Mitwirkung der Bundesländer und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union und sichert ihre Kompetenzen ab.
Was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip im EU-Kontext?
Es besagt, dass Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen werden sollen. Die EU darf nur tätig werden, wenn die Ziele auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht ausreichend erreicht werden können.
Wie beeinflusste der Vertrag von Maastricht die Länderrechte?
Mit Maastricht (1992) erhielten die Bundesländer erweiterte Mitwirkungsrechte, um den Kompetenzverlust durch die Übertragung von Befugnissen auf die EU auszugleichen.
Was ist der Domestizierungsansatz nach Sebastian Harnisch?
Dieser Ansatz analysiert, wie nationale Akteure (hier die Bundesländer) versuchen, die europäische Integration durch nationale Regeln und Mitbestimmungsrechte zu kontrollieren oder zu „zähmen“.
Verzögerten die Forderungen der Länder die europäische Integration?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass die komplexen Abstimmungsprozesse und Kompetenzforderungen der Bundesländer zwischen 1986 und 2009 den Integrationsprozess teilweise verlangsamt haben könnten.
- Quote paper
- Marcel K. Schwertel (Author), 2014, Bundesländer und ihre Mitwirkungsrechte in der Europapolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310420