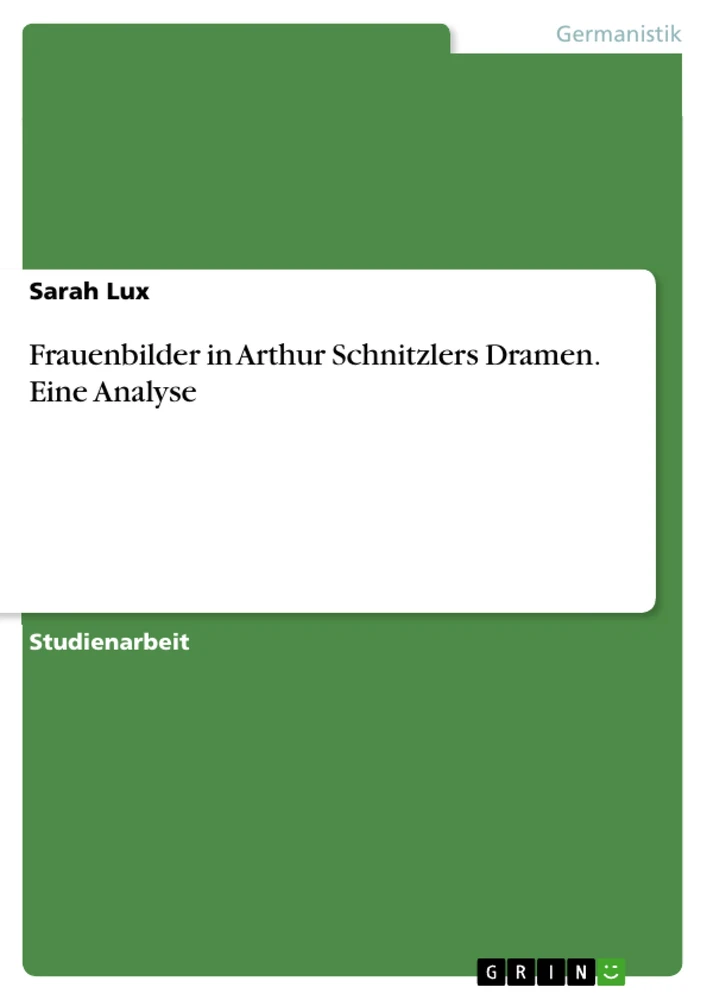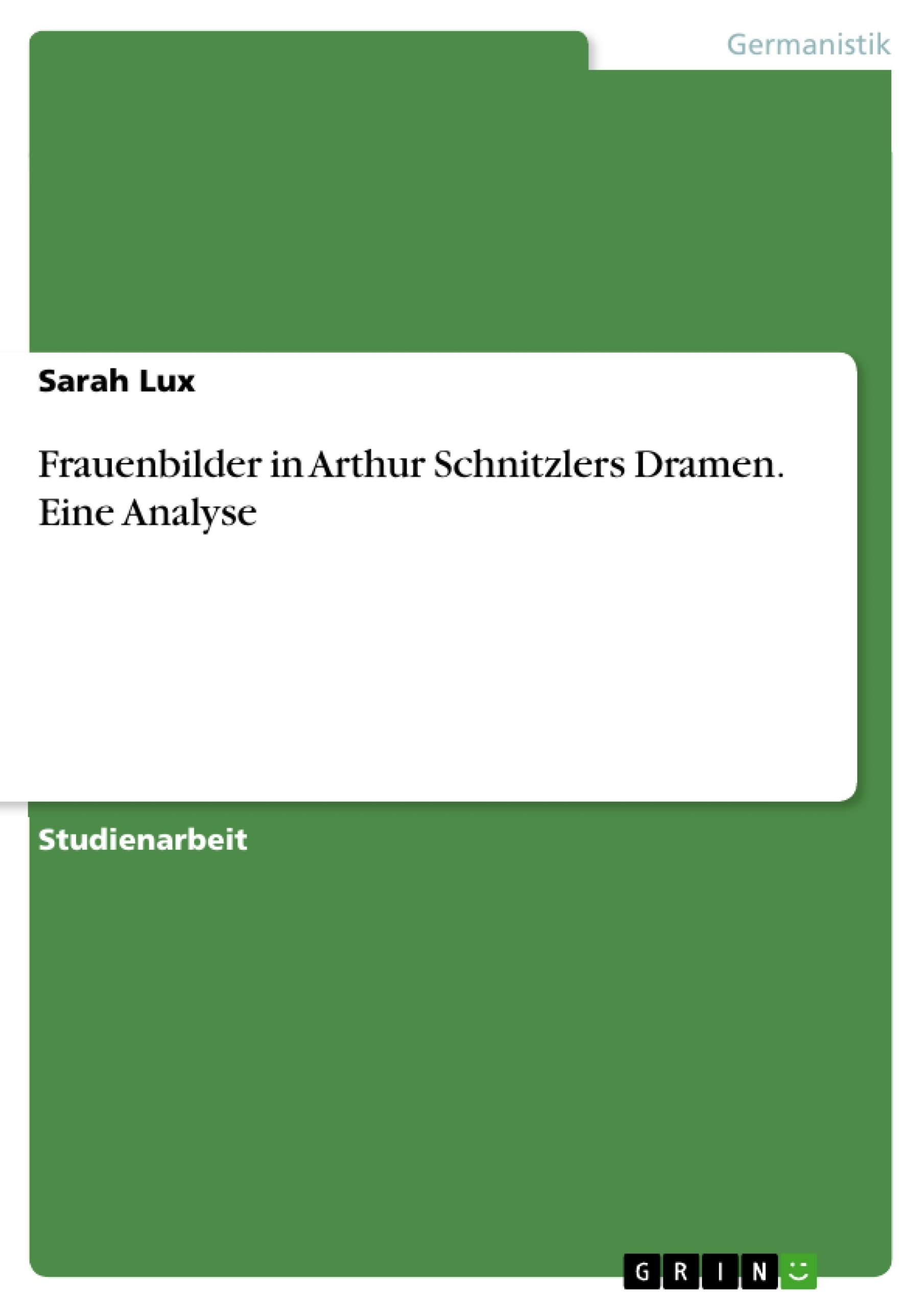Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist geprägt durch den voranschreitenden Zerfall der Donaumonarchie und die Veränderung des Alltags der Menschen: Durch technische und kulturelle Entwicklungen verändert sich das Lebensgefühl nachhaltig.
Das fin de siècle ist bestimmt durch Zukunftsangst, Resignation, Untergangsstimmung, Melancholie, aber auch Euphorie, Dekadenz und Lebenslust. Aufgrund der Industrialisierung können nun auch Frauen arbeiten; sie emanzipieren sich zunehmend, fordern ihr Recht auf Bildung, Selbstbestimmung und bürgerliche und politische Mitbestimmung ein und stoßen damit auf starken männlichen Widerstand. Diese Zeit wird auch „Krise des Patriarchats“ oder „männliche Identitätskrise“ genannt (Ackerl 1999:18). Die Frauen werden als Bedrohung gesehen: Otto Weininger, ein österreichischer Philosoph, behauptet in seinem Buch Geschlecht und Charakter (1903), dass Frauen geistliche, charakterlose und amoralische Wesen seien; dies unterstellt er auch Juden und Homosexuellen (Haupt et al. 2008:249). Die Frauen wollen aber nicht nur hübsch anzusehen sein, sondern auch selbstständig tätig werden. Doch Frauen, die kreativ sind, werden als Gefahr In der Literatur werden sie zu „sexuellen Geschöpfen reduziert“ (Ackerl 1999:19).
Die Frauenbilder um 1900 teilen sich hauptsächlich in zwei Figuren: Die Femme fatale bezeichnet die sexuell attraktive, dämonische Verführerin, die die Männer beherrscht und sie zu ihren Opfern macht. Der Mann scheint wehrlos gegenüber der Dominanz und Ausstrahlung der Frau, die sich ebenfalls im Zwiespalt zwischen Vernunft und Verlangen befindet. Lassen sie sich auf die Reize der Femme fatale ein, so wird sie dies ins Verderben stürzen. Doch nicht nur die Männer leiden unter den verhängnisvollen Folgen, auch die Frau selbst stürzt sich ins Unglück.
Ihr Gegenstück, Femme fragile, wird als rein, schwach und zerbrechlich beschrieben. Der Mann empfindet keinerlei sexuelle Pflichten und verspürt keinen Leistungsdruck. Doch dadurch wirkt sie noch attraktiver ihn. Diese Frauentypen entsprechen nicht der Realität, sondern entspringen der männlichen Phantasie und stellen „die Angst vor der sinnlichen Liebe einerseits, andererseits aber auch das Verlangen nach Erotik und Sexualität“ (Trösch 2011:25) dar. Im Folgenden werden diverse Dramen von Arthur Schnitzler im Hinblick auf Frauenbilder untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arthur Schnitzler
- Dramen von Arthur Schnitzler
- Anatol
- Liebelei
- Reigen
- Der einsame Weg
- Das weite Land
- Frauenbilder in Schnitzlers Dramen
- Das „süße Mädel“
- Die „Ehebrecherin“
- Die „Künstlerin“
- Die „Dirne“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Frauenfiguren in den Dramen von Arthur Schnitzler im Kontext des Fin de Siècle. Sie untersucht die spezifischen Frauenbilder, die Schnitzler in seinen Werken präsentiert, und beleuchtet deren gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund.
- Frauenbilder im Fin de Siècle
- Schnitzlers Dramen und die Darstellung der Geschlechterrollen
- Die Femme fatale und die Femme fragile als stereotype Frauenfiguren
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts
- Die Entwicklung der Frauenrechte und die Emanzipation der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Fin de Siècle als geschichtlichen Kontext für Schnitzlers Werke vor. Sie skizziert die gesellschaftlichen und kulturellen Strömungen dieser Zeit und beleuchtet die Rolle der Frau in dieser Epoche, insbesondere ihre zunehmende Emanzipation und die damit verbundenen Konflikte.
Arthur Schnitzler
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Leben und Werk von Arthur Schnitzler. Es beleuchtet seine Herkunft, seine medizinische Ausbildung, seine literarische Karriere und seine Beziehung zu den Mitgliedern des Zirkels Jung Wien.
Dramen von Arthur Schnitzler
Dieser Abschnitt präsentiert eine Auswahl an Schnitzlers Dramen und gibt einen Einblick in deren Themen und Inhalte.
Anatol
Der Einakter-Zyklus „Anatol“ wird näher betrachtet. Die einzelnen Akte werden in ihrer Thematik und ihren Figuren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Fin de Siècle, Frauenbilder, Dramen, Femme fatale, Femme fragile, Emanzipation, Geschlechterrollen, Gesellschaft, Kultur, Literatur, Wien.
- Arbeit zitieren
- Sarah Lux (Autor:in), 2014, Frauenbilder in Arthur Schnitzlers Dramen. Eine Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310499