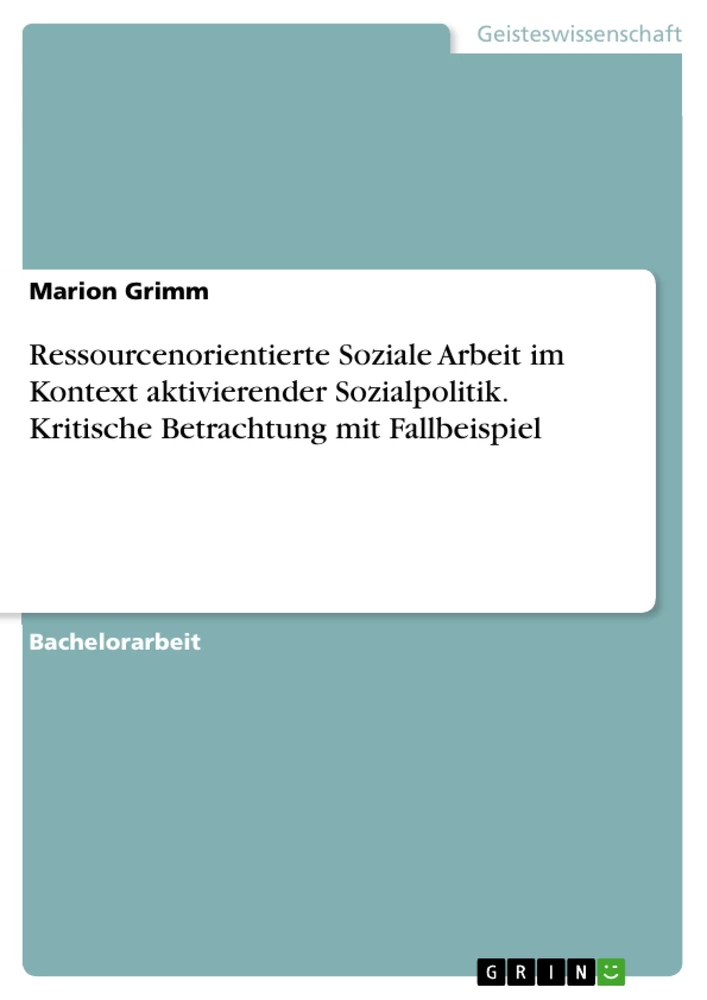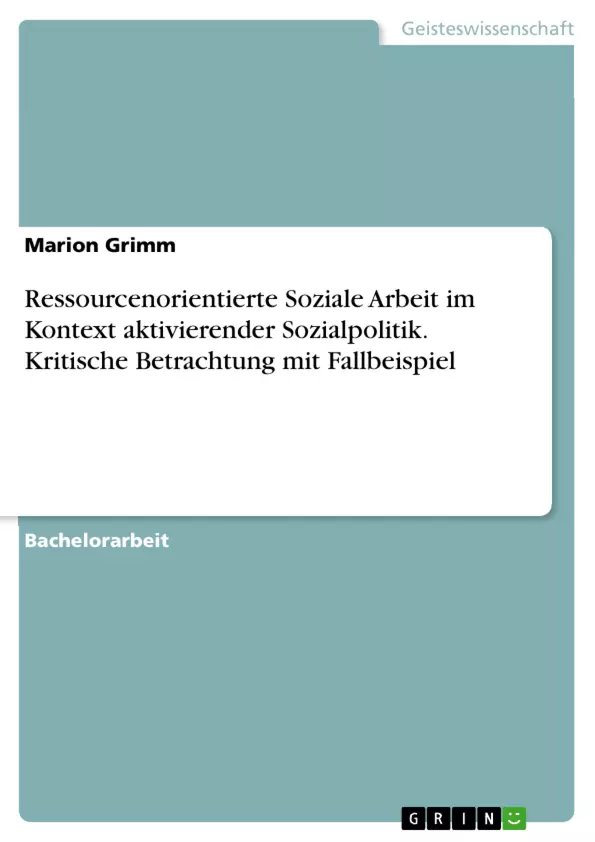In dieser Bachelorarbeit geht es um ressourcenorientierte soziale Arbeit im Kontext aktivierender Sozialpolitik. Es wird eine kritische Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven, anhand eines Fallbeispiels aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit gegeben.
Eine, seit mehr als 30 Jahren etablierte, ja geradezu selbstverständlich gewordene und wenig hinterfragte Art der Hilfe, die häufig in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch in vielen anderen Feldern der Sozialen Arbeit als Allheilmittel – im Sinne von Achtsamkeit und Respekt den NutzerInnen gegenüber und als bloße Orientierung an dem Willen der NutzerInnen, beworben wird, wird in dieser Arbeit kritisch ,aus verschiedenen Perspektiven hinterfragt. Ressourcenorientierung wird in den Kontext struktureller, gesellschaftspolitischer und sozialer Entwicklung gesetzt, um das, nach Ansicht der Autorin, wichtigste Qualitätsmerkmal Sozialer Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren; nämlich die professionelle und ständige Hinterfragung von Handlungsmaximen, deren Wirkung und Sinnhaftigkeit sowie deren Einbindung in äußere Gegebenheiten. Der sozialpolitische Auftrag Sozialer Arbeit wird ebenso betont, wie die Notwendigkeit für infrastrukturelle Voraussetzungen zu sorgen, die Chancengleichheit ermöglicht und Missstände aufdeckt.
Mit der ressourcenorientierten Sozialen Arbeit hat sich ein Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit vollzogen, der von der reinen Ursächlichkeit von Problemen weg zum lösungsorientierten Einbezug der Kräfte, Fähigkeiten und Stärken von Nutzerinnen und deren Umfeld wird.
Zunächst wird im ersten Teil der Arbeit, die Ressourcenorientierung dargestellt und anschließend ein Bezug zur aktivierenden Sozialpolitik in Deutschland, seit den 90er Jahren hergestellt. Im zweiten Teil der Arbeit, angelehnt an die Lebenswelten von Kindern- und Jugendlichen, wird an einem Beispiel aus der Praxis verdeutlicht, wie sehr die Handlungsweisen von Sozialarbeitern im täglichen Umgang mit den NutzerInnen automatisiert und unhinterfragt gestaltet sind. Durch die kritische Betrachtungsweise der ressourcenorientierten Sozialen Arbeit aus psychologischer-, pädagogischer-, gesellschaftlicher- und politischer Sicht, wird ein Blick auf die tägliche Praxis von SozialarbeiterInnen geworfen, an deren Profession verschiedenste Ansprüche gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Darstellung der Ressourcenorientierung
- 1.1 Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit
- 1.2 Ressourcenorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe
- 2. Aktivierende Sozialpolitik in Deutschland seit den 90er Jahren
- 2.1 Machtverhältnisse
- 2.2 Entwicklung des deutschen Sozialstaats seit 1990
- 2.3 Gesellschaftliche Veränderungen in Bezug auf Aktivierung
- 2.4 Individualität und Selbstbestimmung im Kontext gesellschaftlicher Zwänge
- 3. Das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe
- 3.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 3.2 Lebensweltorientierung
- 3.3 Fallbeispiel aus dem Feld offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 4. Ressourcenorientierte Soziale Arbeit kritisch betrachtet
- 4.1 Kritik aus sozialpolitischer Sicht
- 4.2 Kritik aus pädagogischer- und psychologischer Perspektive
- 4.3 Soziale Arbeit als Dienstleistung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Internetquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem ressourcenorientierten Ansatz der Sozialen Arbeit und analysiert seine Bedeutung im Kontext der aktivierenden Sozialpolitik in Deutschland. Dabei wird die Entwicklung des deutschen Sozialstaats seit den 90er Jahren und die damit verbundenen Veränderungen in Bezug auf Aktivierung und Selbstbestimmung beleuchtet.
- Entwicklung und Bedeutung der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit
- Aktivierende Sozialpolitik in Deutschland seit den 90er Jahren und ihre Auswirkungen auf die Soziale Arbeit
- Die Rolle der Ressourcenorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere im Kontext der Lebensweltorientierung
- Kritische Betrachtung des ressourcenorientierten Ansatzes aus verschiedenen Perspektiven
- Die Problematik von „doppeltem Mandat“ und die Spannungen zwischen Nutzerbedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen an Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit und der Unterscheidung zwischen Personenressourcen und Umweltressourcen. Es wird erläutert, wie dieser Ansatz zu einem Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit führte, der auf Selbstbefähigung der NutzerInnen fokussiert.
Im zweiten Kapitel wird die aktivierende Sozialpolitik in Deutschland seit den 90er Jahren beleuchtet. Dabei werden die Machtverhältnisse, die Entwicklung des deutschen Sozialstaats und die gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf Aktivierung untersucht. Die Rolle von Individualität und Selbstbestimmung im Kontext gesellschaftlicher Zwänge wird ebenfalls betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hier wird die Lebensweltorientierung und ein praktisches Beispiel aus dem Feld der offenen Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt, um die Anwendung der Ressourcenorientierung in der Praxis zu veranschaulichen.
Im vierten Kapitel wird der ressourcenorientierte Ansatz kritisch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Es werden die Kritikpunkte aus sozialpolitischer Sicht, aus pädagogischer und psychologischer Perspektive sowie die Problematik von Sozialer Arbeit als Dienstleistung beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ressourcenorientierung, Soziale Arbeit, Aktivierende Sozialpolitik, Kinder- und Jugendhilfe, Lebensweltorientierung, Selbstbestimmung, Empowerment, Dienstleistung, doppeltes Mandat, Kritik, Sozialpolitik, Pädagogik, Psychologie
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Ressourcenorientierung in der Sozialen Arbeit?
Es ist ein Ansatz, der nicht bei den Defiziten, sondern bei den Stärken, Fähigkeiten und dem Umfeld der Nutzer ansetzt, um deren Selbstbefähigung (Empowerment) zu fördern.
Was ist "aktivierende Sozialpolitik"?
Diese Politik fordert Eigenverantwortung und "Aktivierung" der Bürger. In der Sozialen Arbeit führt dies oft zu einem Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle.
Warum wird der ressourcenorientierte Ansatz kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass der Fokus auf individuelle Ressourcen strukturelle Missstände und gesellschaftliche Ungleichheit ausblenden kann, indem die Verantwortung allein auf das Individuum geschoben wird.
Was ist das "doppelte Mandat" der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Verpflichtung der Sozialarbeit gegenüber zwei Instanzen: dem Wohl des Klienten (Hilfe) und dem Auftrag des Staates bzw. der Gesellschaft (Kontrolle/Integration).
Welche Rolle spielt die Lebensweltorientierung?
Dieser Ansatz fordert, dass Soziale Arbeit direkt an den konkreten Alltagsbedingungen und Bedürfnissen der Menschen ansetzen muss, um wirksam zu sein.
- Quote paper
- Marion Grimm (Author), 2015, Ressourcenorientierte Soziale Arbeit im Kontext aktivierender Sozialpolitik. Kritische Betrachtung mit Fallbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310574