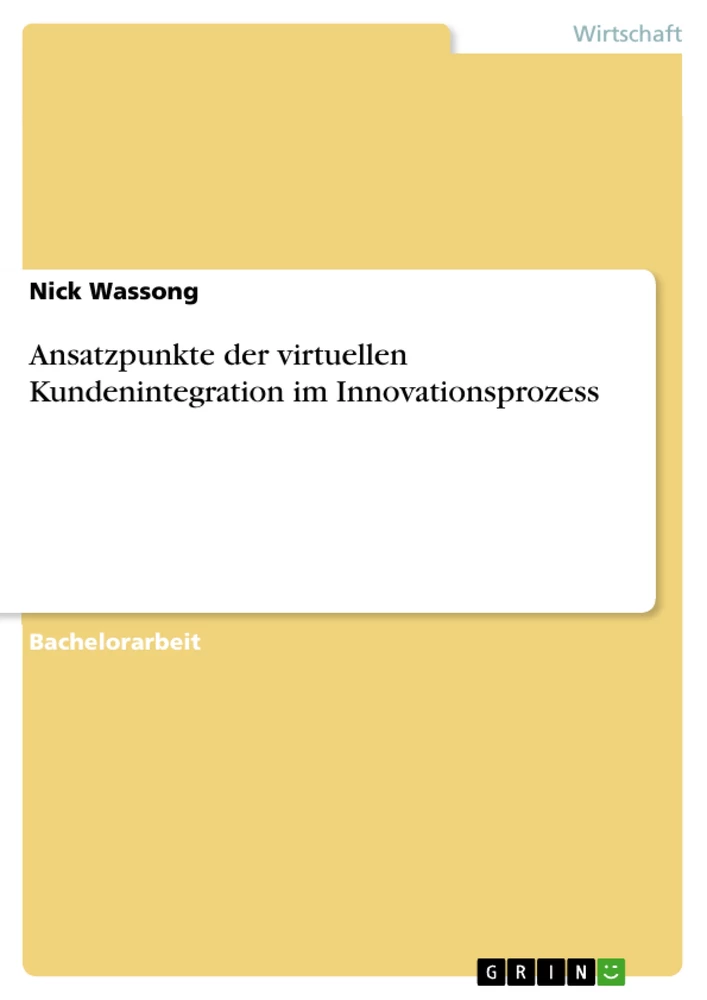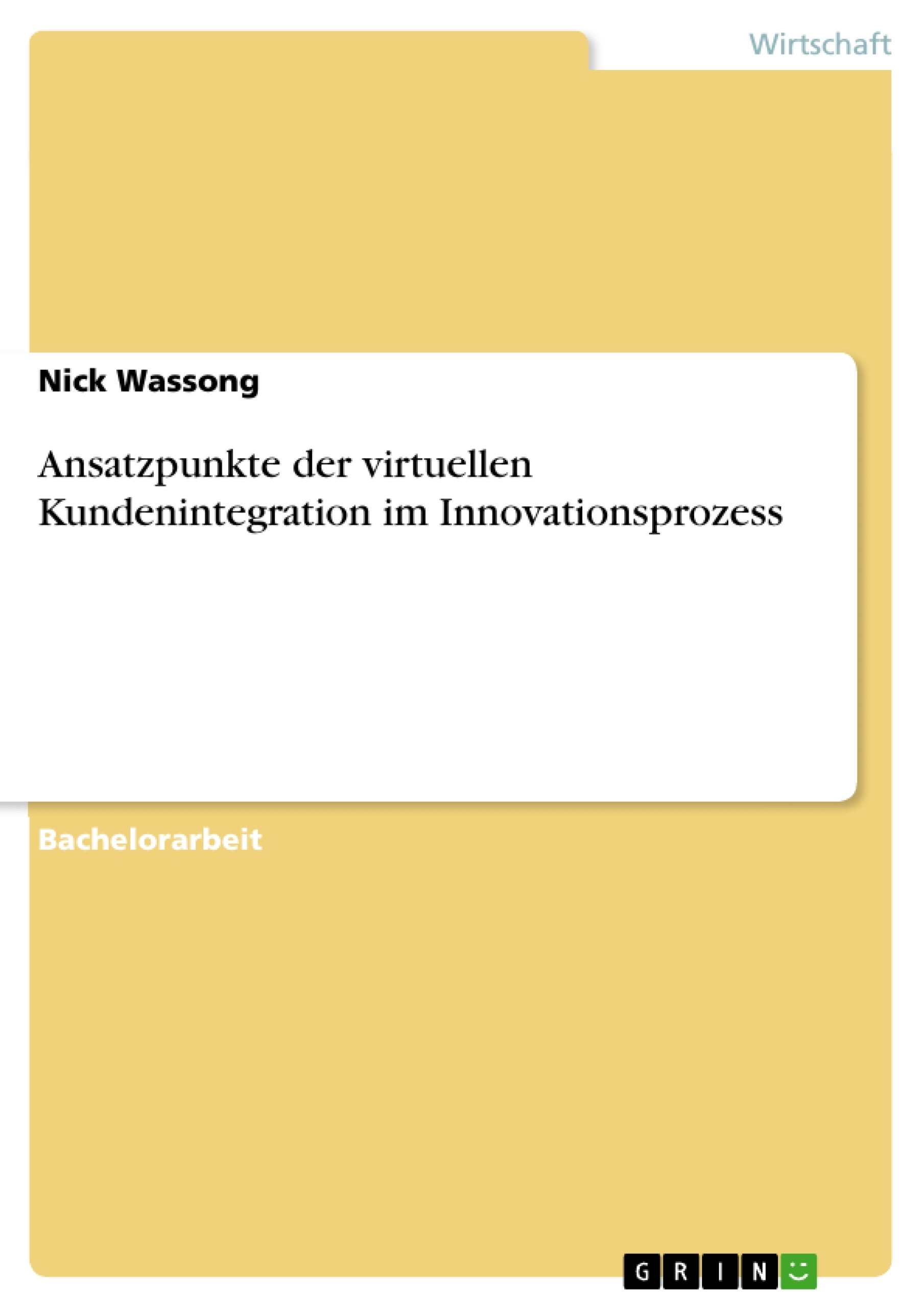Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass eine wissenschaftliche Ausarbeitung über die webbasierte Kundenintegration in den Innovationsprozess sinnvoll ist. Daher hat diese Bachelorarbeit das zentrale Ziel, einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Methoden und Formen der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess aufzuzeigen. Im Rahmen der virtuellen Kundenintegration lassen sich quantitative und qualitative Methoden festmachen, die sich einzelnen Phasen im Innovationsprozess zuordnen lassen. Best-Practice-Beispiele sollen die Methoden veranschaulichen und Antworten für Unternehmen liefern, wie der Kunde erfolgreich in den Innovationsprozess integriert werden kann.
Nach der Einleitung erfolgt im zweiten Kapitel eine Veranschaulichung über die konzeptionellen Grundlagen der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess. Hierzu erfolgt zuerst eine Abgrenzung zentraler Begriffe. Hierzu zählen u.a. der Innovationsbegriff, der Innovationsprozess und der Begriff der virtuellen Kundenintegration. Im Anschluss daran wird im Kapitel 2.2 die Rolle und Entwicklung des Internets beschrieben. Als weitere wichtige Grundlage wird im Kapitel 2.3 die Rolle des Kunden im Rahmen der virtuellen Kundenintegration erläutert. Im Kapitel 2.4 werden die Kundenmotive beleuchtet.
Im dritten Kapitel werden die wichtigsten qualitativen Methoden der virtuellen Kundenintegration erläutert. Hierzu zählen virtuelle Communities, Crowdsourcing, die Lead-User-Methode, Mass Customization, virtuelle Fokusgruppen und Toolkits. Im vierten Kapitel werden die quantitativen Methoden der virtuellen Kundenintegration beschrieben. Hier werden das Information Pump, die webbasierte Conjoint Analyse und Fast Pace, User Design, Securities Trading of Concepts, Virtual Concept Testing, virtuelle Markttests und Online-Befragungen als angewandte Methoden beschrieben. Zu Beginn der Kapitel drei und vier werden jeweils alle Methoden in einer Abbildung den Phasen im Innovationsprozess zugeordnet. Des Weiteren wird jede Methode mit einem Kurzüberblick eingeleitet. Implikationen für die Praxis liefern Best-Practice-Beispiele für jede Methode.
Das fünfte Kapitel gibt eine abschließende Zusammenfassung dieser Arbeit sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Problemstellung
- Aktualität des Themas
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der virtuellen Kundenintegration
- Abgrenzung zentraler Ansatzpunkte
- Begriff der Innovation
- Der Innovationsprozess
- Begriff der virtuellen Kundenintegration
- Interaktive Wertschöpfung
- Open Innovation
- Die Rolle des Internets
- Einordnung der Kundenrolle
- Motivation als zentrale Voraussetzung
- Qualitative Methoden der virtuellen Kundenintegration
- Virtuelle Communities
- Netnographie
- Community Based Innovation
- Virtuelle Communities of Practice
- Crowdsourcing
- Mediatoren-Plattformen bzw. Intermediäre für Innovationen
- Gemeinsam eine freie Lösung
- Unternehmenseigene Ideen-Plattformen
- Ideenwettbewerbe im Bereich Produktideen und Problemlösungen
- Unternehmens-Communities im Bereich Produktideen und Problemlösungen
- Branding- und Designplattformen
- Marktplätze für eigene Ideen
- Öffentliche Initiativen
- Social-Media-Plattformen
- Lead-User-Methode
- Projektinitiierung
- Trendanalyse
- Lead-User Identifikation
- Konzeptdesign
- Virtuelle Fokusgruppen
- Toolkits
- „Toolkits für User Innovation“
- „Toolkits für User Co-Design“
- Produktindividualisierung - Mass Customization
- Quantitative Methoden der virtuellen Kundenintegration
- Information Pump
- Conjoint-Analyse, Web-Based und Fast-PACE
- User Design
- Securities Trading of Concepts (STOC)
- Virtual Concept Testing
- Virtuelle Markttests
- Online-Befragung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit hat das Ziel, einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Methoden und Formen der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess aufzuzeigen. Im Fokus stehen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden, die sich einzelnen Phasen im Innovationsprozess zuordnen lassen. Best-Practice-Beispiele sollen die Methoden veranschaulichen und Antworten für Unternehmen liefern, wie der Kunde erfolgreich in den Innovationsprozess integriert werden kann.
- Die Bedeutung der Kundenintegration im Innovationsprozess
- Die Rolle des Internets bei der virtuellen Kundenintegration
- Qualitative Methoden der virtuellen Kundenintegration (z.B. virtuelle Communities, Crowdsourcing, Lead-User-Methode)
- Quantitative Methoden der virtuellen Kundenintegration (z.B. Conjoint-Analyse, Virtual Concept Testing, Online-Befragung)
- Best-Practice-Beispiele für die erfolgreiche Einbindung von Kunden in den Innovationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 behandelt die konzeptionellen Grundlagen der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess. Hier werden zentrale Begriffe wie Innovation, Innovationsprozess und virtuelle Kundenintegration definiert und abgegrenzt. Die Rolle des Internets als Grundlage der virtuellen Kundenintegration wird ebenfalls beleuchtet, ebenso wie die verschiedenen Kundenrollen und die wichtigsten Motivationsfaktoren, die Kunden zur Teilnahme am Innovationsprozess bewegen.
Kapitel 3 widmet sich den qualitativen Methoden der virtuellen Kundenintegration. Es werden verschiedene Methoden wie virtuelle Communities, Crowdsourcing, die Lead-User-Methode, Mass Customization, virtuelle Fokusgruppen und Toolkits vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen illustriert.
Kapitel 4 behandelt die quantitativen Methoden der virtuellen Kundenintegration. Hier werden das Information Pump, die webbasierte Conjoint Analyse und Fast Pace, User Design, Securities Trading of Concepts, Virtual Concept Testing, virtuelle Markttests und Online-Befragungen als angewandte Methoden beschrieben. Es wird ebenfalls auf die Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Methode im Innovationsprozess eingegangen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Virtuelle Kundenintegration, Innovationsprozess, Open Innovation, Interaktive Wertschöpfung, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Virtuelle Communities, Crowdsourcing, Lead-User-Methode, Conjoint-Analyse, Virtual Concept Testing, Online-Befragung, Best-Practice-Beispiele
Häufig gestellte Fragen
Was ist virtuelle Kundenintegration im Innovationsprozess?
Es beschreibt die Einbindung von Kunden über das Internet in die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, oft im Rahmen von Open Innovation.
Welche qualitativen Methoden werden genutzt?
Beispiele sind virtuelle Communities (Netnographie), Crowdsourcing-Plattformen, die Lead-User-Methode und virtuelle Fokusgruppen.
Was sind quantitative Methoden der Kundenintegration?
Dazu zählen webbasierte Conjoint-Analysen, Virtual Concept Testing, Online-Befragungen und Marktplätze für Ideen (Securities Trading of Concepts).
Was motiviert Kunden, an Innovationen teilzunehmen?
Kundenmotive können Spaß an der Gestaltung, der Wunsch nach besseren Produkten (Lead-User), Anerkennung in einer Community oder finanzielle Belohnungen sein.
Was sind Toolkits für User Innovation?
Das sind Online-Werkzeuge, die es Kunden ermöglichen, Produkte nach ihren eigenen Wünschen selbst zu gestalten (Mass Customization oder Co-Design).
- Quote paper
- Nick Wassong (Author), 2013, Ansatzpunkte der virtuellen Kundenintegration im Innovationsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310938