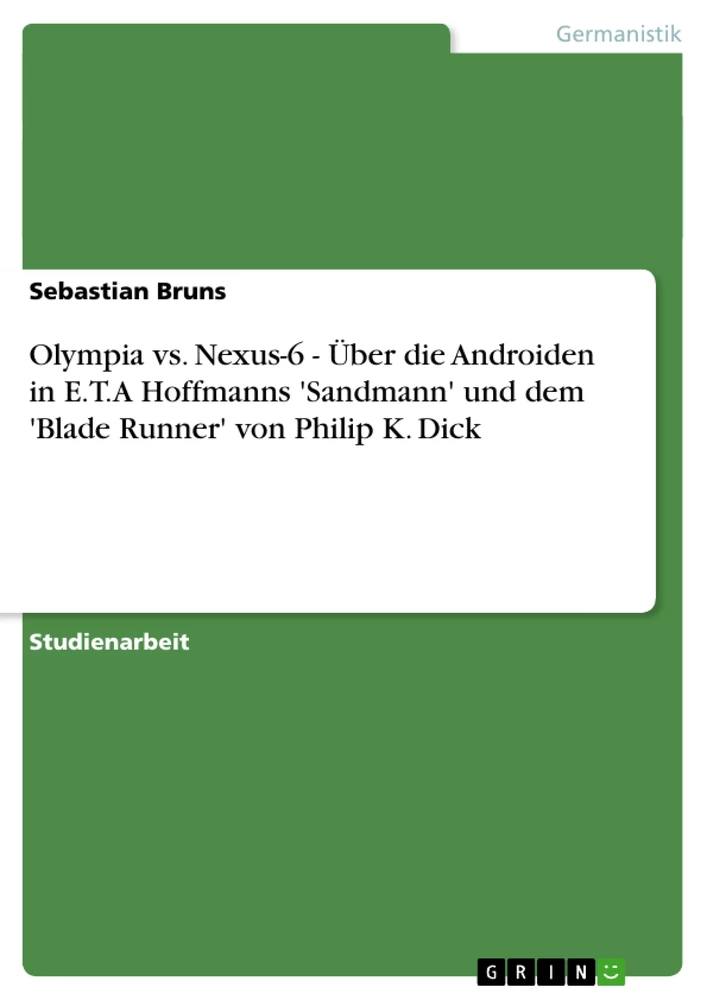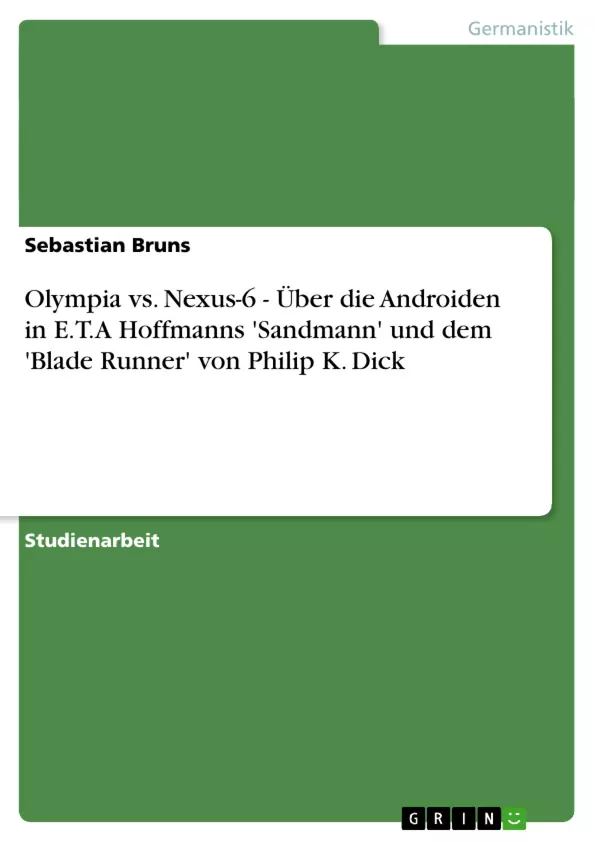In diesen Monaten kommen gleich zwei neue Filme in die deutschen Kinos. Beides sind amerikanische Filme und beide Filme handeln von künstlichen Menschen. In „I, Robot“ übernehmen Roboter die Weltherrschaft, in „Die Frauen von Stepford“ von Frank Oz sind zumindest lediglich die Frauen einer Stadt nicht menschlicher Natur. Seit dem ersten Bekannt werden androider Automaten in den 1750er Jahren haben sich eine Vielzahl von Autoren dem Automatenmotiv angenommen. Der Grundstein für die Vorstellung eines künstlichen Menschen geht bis in die Antike auf den Pygmaleon –Mythos zurück. Die Verarbeitung in der Literatur führte von orakelnden Schachspielern bei E.T.A Hoffmann über Menschen, die für jede Tätigkeit eine Maschine besitzen bei Jean Paul bis zum aus Leichenteilen erschaffenen Mensch-Monster Frankenstein bei Mary W. Shelley. Die folgende Arbeit soll zunächst einen Überblick über die realen Vorbilder der Fiktion geben. Des Weiteren soll auf den Stellenwert des Androiden in Literatur und Gesellschaft eingegangen werden. Abschließend wird der Frage nachgegangen werden, in ob und in welcher Weise sich die Androiden von damals bis heute weiterentwickelt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Einleitung
- Berühmte androide Automaten und ihre Erbauer
- Jaques VAUCANSON
- Die Ente
- Der Flötenspieler
- Der Trommler
- Friedrich von Knaus
- Die allesschreibende Wundermaschine
- Wolfgang von Kempelen
- Die Sprechmaschine
- Der Schachautomat
- Jaquet-Droz - Wir sind die Androiden
- Der Schriftsteller
- Der Zeichner
- Die Musikerin
- Das Automatenmotiv in der Literatur
- Grundlagen für die Entstehung des Automatenmotivs
- E.T.A Hoffmanns Sandmann und Philip K. Dicks Blade Runner - Die Weiterentwicklung des Automatenmotivs in der Literatur
- Zum Inhalt des Sandmann
- Zum Inhalt des Blade Runner
- Ein Vergleich
- Das Verhältnis zur Technik
- Olympia vs. Nexus-6
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der Entwicklung des Androidenmotivs in Literatur und Gesellschaft, ausgehend von realen Vorbildern der androiden Automaten im 18. Jahrhundert bis hin zur literarischen Verarbeitung in E.T.A. Hoffmanns „Sandmann“ und Philip K. Dicks „Blade Runner“. Sie verfolgt die Frage, wie sich die Vorstellung vom künstlichen Menschen im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche Bedeutung diese Entwicklung für die Literatur und die Gesellschaft hat.
- Die Geschichte des Automatenbaus und seine Bedeutung für die Entwicklung des Androidenmotivs
- Die Rolle der androiden Automaten in der Literatur, von den Anfängen bis hin zu den modernen Science-Fiction-Romanen
- Der Vergleich zwischen den Androiden in E.T.A. Hoffmanns „Sandmann“ und Philip K. Dicks „Blade Runner“
- Die Frage nach der Menschlichkeit des Androiden und die ethischen Implikationen der künstlichen Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zwei amerikanischen Filme „I, Robot“ und „Die Frauen von Stepford“ vor, die beide von künstlichen Menschen handeln und die Aktualität des Themas beleuchten. Außerdem wird der Pygmalion-Mythos als Ursprung der Vorstellung eines künstlichen Menschen genannt und ein Überblick über die literarische Verarbeitung des Automatenmotivs von E.T.A. Hoffmann bis Mary W. Shelley gegeben. Abschließend werden die Ziele der Arbeit erläutert.
- Das Kapitel „Berühmte androide Automaten und ihre Erbauer“ gibt einen Einblick in die Geschichte des Automatenbaus. Hier werden die Arbeiten von Jaques Vaucanson, Friedrich von Knaus und Wolfgang von Kempelen vorgestellt. Die Automaten, die im 18. Jahrhundert entwickelt wurden, zeigten bereits erstaunliche Fähigkeiten und hatten einen großen Einfluss auf die Vorstellung vom künstlichen Menschen.
- Das Kapitel „Das Automatenmotiv in der Literatur“ beschäftigt sich mit der literarischen Verarbeitung des Automatenmotivs. Es wird gezeigt, wie dieses Motiv im Laufe der Zeit in verschiedenen literarischen Genres aufgegriffen wurde. Dabei wird auch auf die Entwicklung der Vorstellung vom Androiden als Gegenbild zum Menschen eingegangen.
- Das Kapitel „E.T.A. Hoffmanns Sandmann und Philip K. Dicks Blade Runner“ befasst sich mit der Weiterentwicklung des Automatenmotivs in der modernen Literatur. Es werden die beiden Romane „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann und „Blade Runner“ von Philip K. Dick genauer untersucht. Die Analyse der beiden Werke soll die unterschiedlichen Perspektiven auf den Androiden und seine Rolle in der Gesellschaft deutlich machen.
- Das Kapitel „Ein Vergleich“ vergleicht die Androiden in „Der Sandmann“ und „Blade Runner“ miteinander. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrer Darstellung, ihrer Funktion und ihrer Beziehung zum Menschen herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Androiden, Automatenmotiv, künstliche Intelligenz, E.T.A. Hoffmann, Philip K. Dick, „Der Sandmann“, „Blade Runner“, Pygmalion-Mythos, Menschlichkeit, Gesellschaft, Technik, Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Automatenmotiv in der Literatur?
Es beschreibt die literarische Darstellung künstlicher Menschen oder Androiden, die oft Fragen nach Menschlichkeit, Technik und Seele aufwerfen.
Wer ist Olympia in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“?
Olympia ist eine lebensecht wirkende Holzpuppe (ein Automat), in die sich der Protagonist Nathanael verliebt, ohne ihre künstliche Natur zu erkennen.
Was sind die Nexus-6 Androiden in „Blade Runner“?
Es sind hochmoderne, biologisch konstruierte künstliche Menschen (Replikanten), die sich kaum noch von echten Menschen unterscheiden lassen.
Welche realen Vorbilder gab es für diese Fiktionen?
Berühmte Automatenbauer des 18. Jahrhunderts wie Jacques de Vaucanson oder Wolfgang von Kempelen (Schachautomat) prägten die Vorstellung von künstlichen Wesen.
Wie hat sich das Motiv vom 18. Jahrhundert bis heute gewandelt?
Während frühe Automaten mechanische Wunderwerke waren, thematisiert moderne Science-Fiction wie bei Philip K. Dick komplexe ethische Fragen und die Grenzen der Identität.
- Citar trabajo
- Sebastian Bruns (Autor), 2004, Olympia vs. Nexus-6 - Über die Androiden in E.T.A Hoffmanns 'Sandmann' und dem 'Blade Runner' von Philip K. Dick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31096