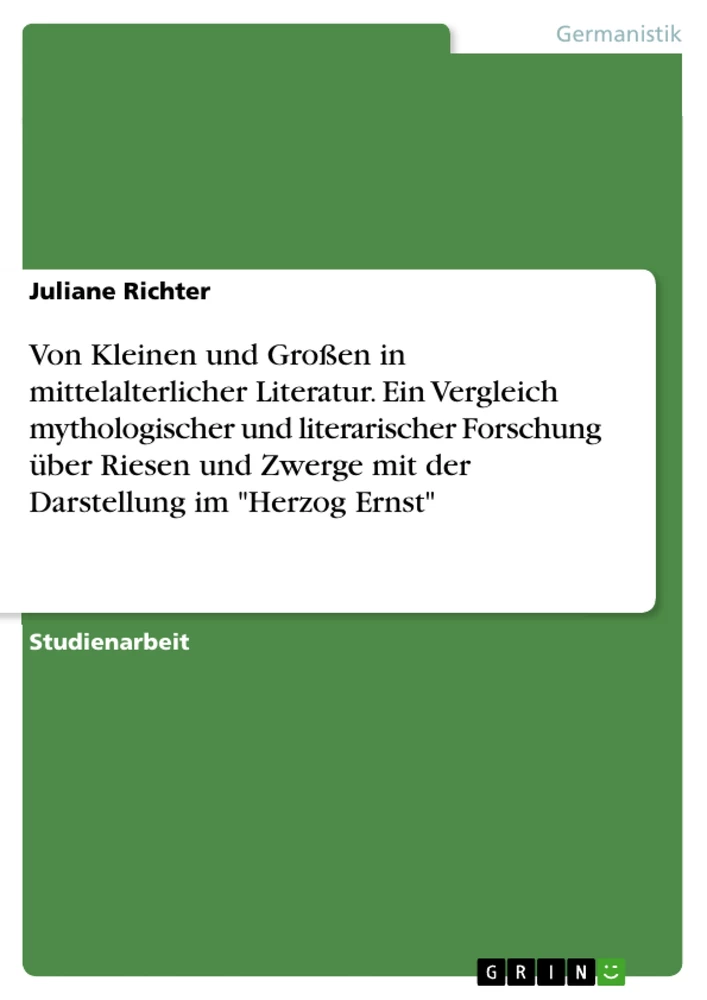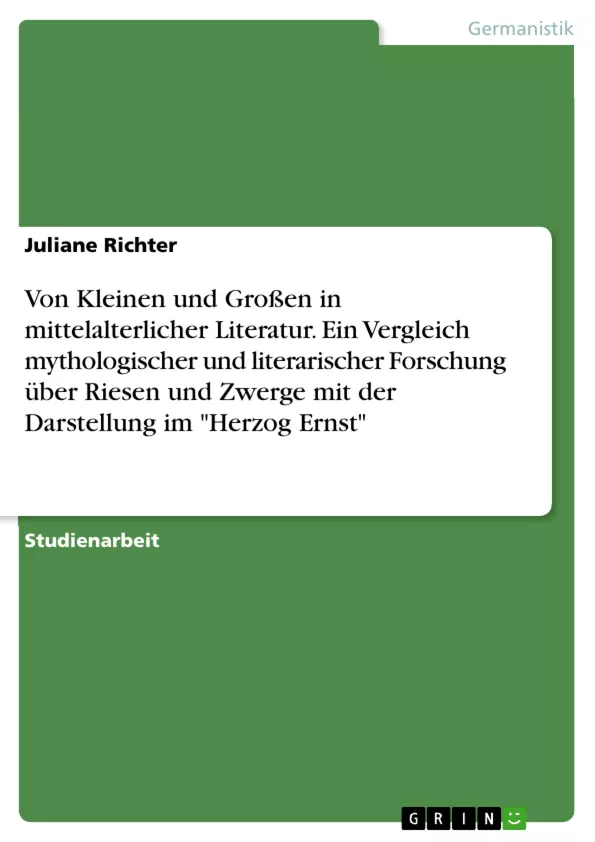Diese Arbeit soll nicht nur analysieren und darstellen, wie die Riesen und Zwerge im "Herzog Ernst" literarisch dargestellt werden, ihre Funktion und Visualisierung beschreiben, sondern auch einen Überblick über die mythologischen Ursprünge und Entwicklung dieser Wesen geben. Den Beginn soll eine Vorstellung beider Wesenstypen machen, gefolgt von der Analyse HE. Hierbei wird zunächst das Werk historisch eingeordnet, um dann den Fokus auf die Arimaspi-Episode zu legen, in dem die Riesen und Zwerge erstmals in Aktion treten.
Der belebende Glaube an Ungewöhnlichkeiten scheint bei näherem Betrachten nicht immer nur das Gespinst, das in den Köpfen der Menschen entstand und über Generationen und Zeitalter weitergegeben wurde, sondern viel mehr als das. Es ist ein Bild der Zeit, ein Bild des Denkens, ein Bild des Verständnisses und ein Bild der Kunst. Phantastische Gedanken stehen als wissenschaftliche Theorien vergangener Zeiten, in denen die Menschen versuchten, sich die Welt, in der sie lebten, mit all ihren Phänomen und Wirkungen, ihrem Zauber und Sinn zu erklären. Egal, ob in Form von Gottheiten, nicht menschlichen Wesen oder gar Ungeheuern, Menschen wollten Antworten auf ihre drängenden Fragen an die Naturerscheinungen. So entstanden Glaube und Mythos und beides wurde zunächst mündlich weitergegeben. Es bildeten sich Geschichten, Sagen, Spekulationen daraus. Der Schwerpunkt dieser Arbeit sei auf zwei mythologische Wesen gelegt. Die Pygmäen und Cananäischen Riesen gelten als ethnologische Kuriositäten im "Herzog Ernst" und lassen sich in den Orientteil seiner Reise einordnen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Mittelalterliche Mythologie
- Riesen
- Zwerge
- Die Darstellung der Riesen und Zwerge im Herzog Ernst B.
- Historischer und Inhaltlicher Abriss
- Arimaspi- Episode
- Kurze Einordnung in den Gesamtzusammenhang
- Inhalt
- Die Darstellung der Zwerge
- Die Darstellung der Riesen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Riesen und Zwergen im mittelalterlichen Heldenepos "Herzog Ernst". Sie untersucht die mythologischen Ursprünge und Entwicklung dieser Wesen und betrachtet ihre literarische Funktion und Visualisierung im Kontext des Werkes. Die Arbeit zielt darauf ab, einen tieferen Einblick in die mittelalterliche Vorstellungswelt und das Verständnis von Fabelwesen in der Literatur zu geben.
- Die mythologischen Ursprünge und Entwicklung von Riesen und Zwergen
- Die literarische Darstellung von Riesen und Zwergen im "Herzog Ernst"
- Die Funktion und Visualisierung von Riesen und Zwergen im "Herzog Ernst"
- Die Rolle von Riesen und Zwergen in der mittelalterlichen Literatur
- Die Beziehungen zwischen Riesen, Zwergen und Helden in der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung von Mythen und Fabelwesen für das mittelalterliche Denken. Sie stellt die beiden zentralen Wesenstypen der Arbeit, die Riesen und Zwerge, vor und skizziert den Fokus der Analyse im "Herzog Ernst".
- Mittelalterliche Mythologie: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die mythologischen Vorstellungen von Riesen und Zwergen im Mittelalter. Es geht auf die Ursprünge und Entwicklung dieser Wesen ein und zeigt ihre Bedeutung in der mittelalterlichen Literatur und Kultur auf.
- Die Darstellung der Riesen und Zwerge im Herzog Ernst B.: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Darstellung von Riesen und Zwergen im "Herzog Ernst". Es stellt den historischen und inhaltlichen Kontext des Werkes dar und beleuchtet die Rolle der Riesen und Zwerge in der Arimaspi-Episode.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen mittelalterliche Mythologie, Riesen, Zwerge, "Herzog Ernst", literarische Darstellung, Fabelwesen, Mythologie, Kulturgeschichte, Arimaspi-Episode.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Riesen und Zwerge im "Herzog Ernst"?
Riesen und Zwerge treten im Orientteil der Reise als ethnologische Kuriositäten auf, insbesondere in der sogenannten Arimaspi-Episode.
Was sind die mythologischen Ursprünge dieser Wesen?
Die Arbeit untersucht die Wurzeln in der antiken und mittelalterlichen Mythologie, wie etwa die Pygmäen und die cananäischen Riesen.
Warum waren Fabelwesen im Mittelalter so wichtig?
Sie dienten als wissenschaftliche Theorien ihrer Zeit, mit denen Menschen versuchten, Naturphänomene und das Unbekannte in der Welt zu erklären.
Wie werden Riesen und Zwerge literarisch visualisiert?
Die Arbeit beschreibt ihre Funktion als phantastische Elemente, die das Bild der Zeit und das damalige Verständnis von Kunst und Natur widerspiegeln.
Was ist die Arimaspi-Episode?
Es ist ein Abschnitt im Epos "Herzog Ernst", in dem der Held erstmals auf diese ungewöhnlichen Wesen trifft und sie in Aktion dargestellt werden.
- Arbeit zitieren
- Juliane Richter (Autor:in), 2015, Von Kleinen und Großen in mittelalterlicher Literatur. Ein Vergleich mythologischer und literarischer Forschung über Riesen und Zwerge mit der Darstellung im "Herzog Ernst", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311098