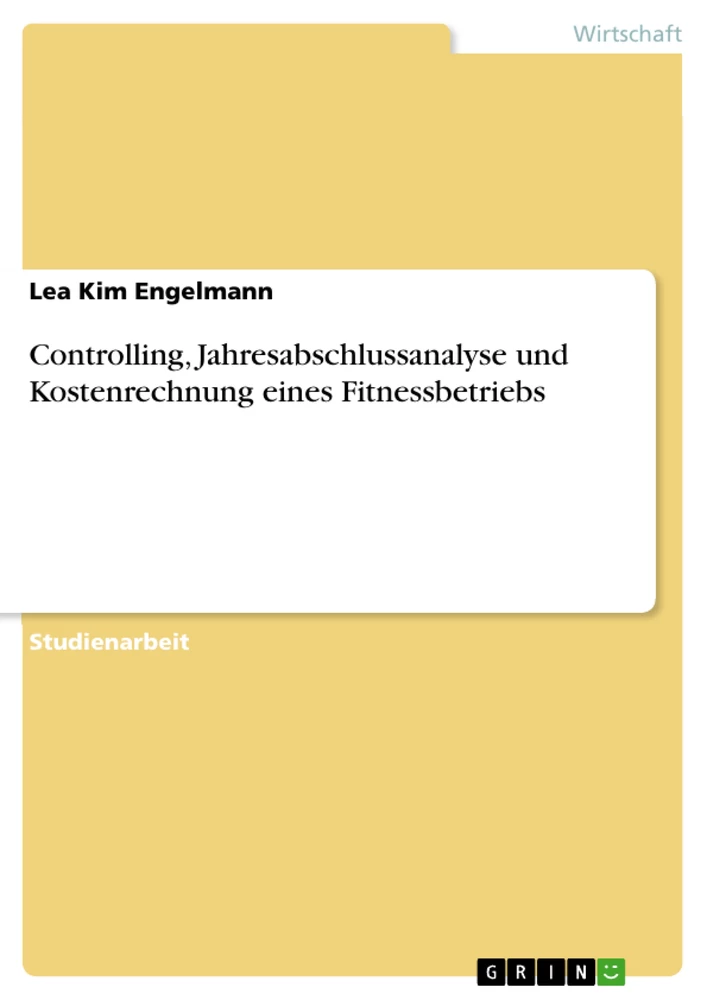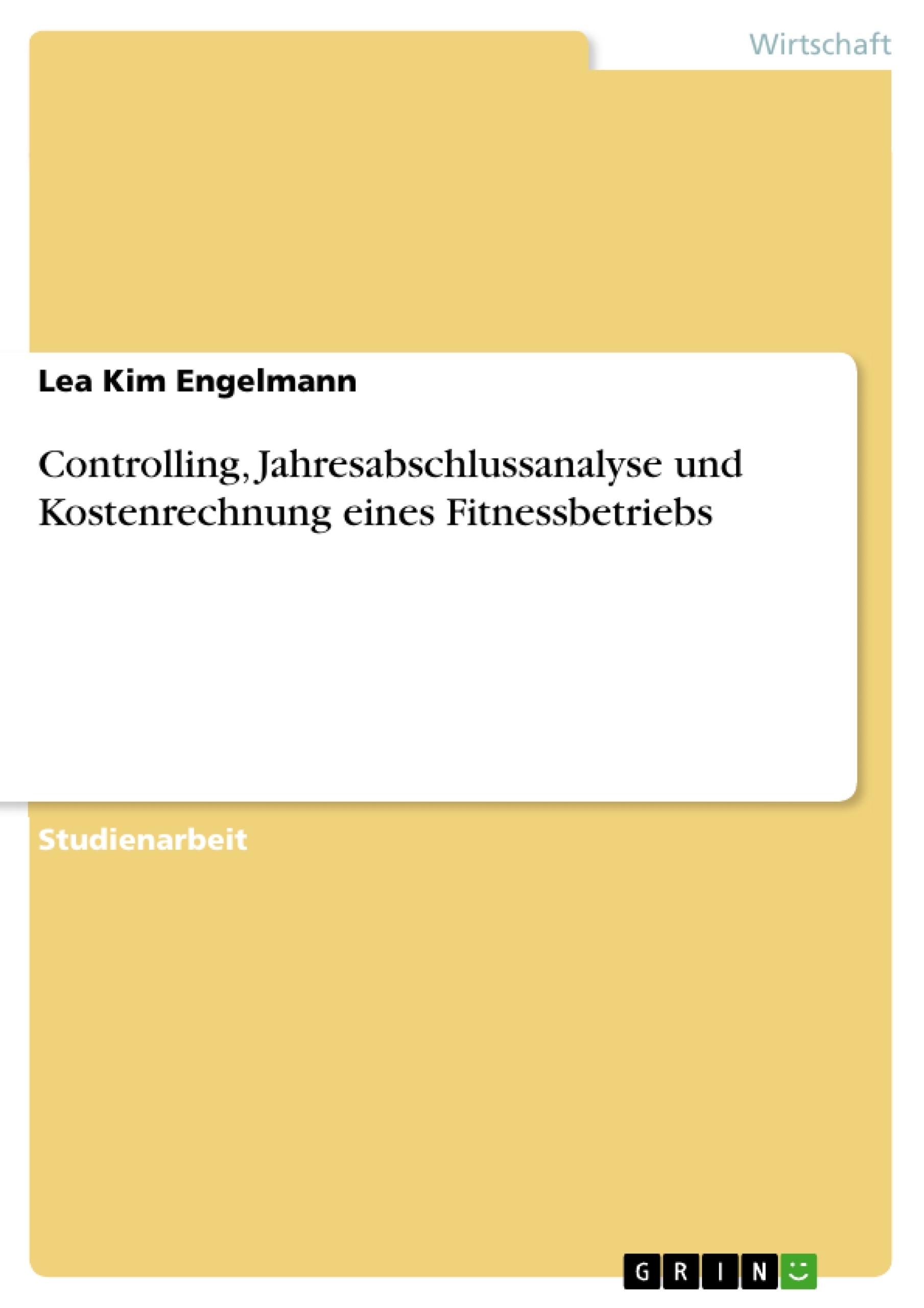In dieser Hausarbeit wird ein Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre beleuchtet: das Controlling. An einem fiktiven Beispiel werden die verschiedenen Bereiche des Controllings, des Jahresabschlussanalyse und der Kostenrechnung durchgeführt.
Der Kerngedanke und die Aufgaben des Controllings werden genauer beleuchtet und erklärt. Verschiedene Kennzahlen und Kennzahlensysteme werden erklärt und dienen als Basis für das Verständnis des Controllingsystems. Dabei wird auch genauer auf die Balanced Scorecard eingegangen.
Die Jahresabschlussanalyse setzt sich hier durch ihre verschiedenen Teilanalysen zusammen: vertikale Strukturanalyse, kurzfristige Finanzanalyse und Erfolgsanalyse. Anhand des Fallbeispiels wird auch dessen wirtschaftliche Entwicklung beurteilt.
Unter der Kostenrechnung werden verschiedene Kostenrechnungsarten erklärt. Zudem wird vermittelt, wie eine Zuschlagskalkulation und die Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- CONTROLLING
- Kerngedanke und Aufgaben des Controllings
- Kennzahlensystem
- Controllingsystem
- Erläuterung eines Controllingsystems
- Balanced Scorecard Praxisbeispiel
- JAHRESABSCHLUSSANALYSE
- Teilanalysen der Jahresabschlussanalyse
- Vertikale Strukturanalyse (Passivseite) für 2013 und 2014
- Kurzfristige Finanzanalyse für 2013 und 2014
- Erfolgsanalyse (Rentabilitätskennzahlen) für 2013 und 2014
- Wirtschaftliche Entwicklung
- KOSTENRECHNUNG
- Kostenrechnungsarten
- Zuschlagskalkulation
- Deckungsbeitragsrechnung
- Interpretation der Deckungsbeitragssituation
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert das Controlling als Instrument zur Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen. Sie beleuchtet die Kerngedanken und Aufgaben des Controllings, die Bedeutung von Kennzahlensystemen und die praktische Anwendung eines Controllingsystems anhand eines Praxisbeispiels. Die Analyse wird durch eine Jahresabschlussanalyse ergänzt, die die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens betrachtet.
- Die Rolle des Controllings in der Unternehmensführung
- Das Kennzahlensystem als Basis für die Steuerung
- Die Anwendung von Controllingsystemen in der Praxis
- Die Analyse der Jahresabschlussdaten für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Die Verbindung von Controlling und Kostenrechnung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Kerngedanken und den Aufgaben des Controllings. Es erläutert die Bedeutung des Controllings als Prozess der Zielsetzung, Planung und Steuerung sowie die Unterscheidung zwischen strategischem und operativem Controlling. Das Kapitel zeigt die Bedeutung von Kennzahlen für die Steuerung von Unternehmensprozessen und beschreibt die Erstellung eines Kennzahlensystems.
Im zweiten Kapitel wird ein Controllingsystem im Detail erläutert und anhand eines Praxisbeispiels der Balanced Scorecard dargestellt. Das Kapitel betrachtet die einzelnen Bestandteile eines Controllingsystems und zeigt, wie das System zur Steuerung und Kontrolle der Unternehmensentwicklung eingesetzt werden kann.
Das dritte Kapitel behandelt die Jahresabschlussanalyse, die als Instrument zur Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens dient. Es werden verschiedene Teilanalysen wie die vertikale Strukturanalyse, die kurzfristige Finanzanalyse und die Erfolgsanalyse vorgestellt. Das Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens anhand der Jahresabschlussdaten.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Kostenrechnung und stellt verschiedene Arten der Kostenrechnung vor. Es erläutert die Funktionsweise der Zuschlagskalkulation und der Deckungsbeitragsrechnung. Das Kapitel analysiert die Deckungsbeitragssituation des Unternehmens und zeigt, wie diese zur Optimierung der Unternehmensrentabilität eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Controlling, Kennzahlen, Kennzahlensystem, Controllingsystem, Balanced Scorecard, Jahresabschlussanalyse, Kostenrechnung, Zuschlagskalkulation, Deckungsbeitragsrechnung, Unternehmenssteuerung, Wirtschaftliche Entwicklung
Häufig gestellte Fragen
Welche Aufgaben übernimmt das Controlling in einem Fitnessbetrieb?
Das Controlling dient als Prozess der Zielsetzung, Planung und Steuerung. Es unterstützt die Unternehmensführung durch die Analyse von Kennzahlen und die Überwachung von Unternehmensprozessen.
Was ist die Balanced Scorecard und wie wird sie angewendet?
Die Balanced Scorecard ist ein Controllingsystem, das verschiedene Perspektiven (z. B. Finanzen, Kunden, Prozesse) einbezieht, um die Unternehmensentwicklung ganzheitlich zu steuern.
Welche Analysen umfasst eine Jahresabschlussanalyse?
Sie besteht aus einer vertikalen Strukturanalyse (Passivseite), einer kurzfristigen Finanzanalyse sowie einer Erfolgsanalyse mittels Rentabilitätskennzahlen.
Was versteht man unter einer Zuschlagskalkulation in der Kostenrechnung?
Die Zuschlagskalkulation ist eine Methode, um die Selbstkosten pro Leistungseinheit zu ermitteln, indem Gemeinkosten über Prozentsätze auf die Einzelkosten aufgeschlagen werden.
Warum ist die Deckungsbeitragsrechnung für ein Unternehmen wichtig?
Sie hilft dabei, die Rentabilität einzelner Leistungen zu bewerten und zu entscheiden, ob diese zur Deckung der Fixkosten und zur Erzielung von Gewinn beitragen.
Wie unterscheiden sich strategisches und operatives Controlling?
Die Arbeit erläutert, dass strategisches Controlling langfristige Ziele verfolgt, während das operative Controlling auf die kurz- bis mittelfristige Steuerung und Effizienz ausgerichtet ist.
- Arbeit zitieren
- Lea Kim Engelmann (Autor:in), 2015, Controlling, Jahresabschlussanalyse und Kostenrechnung eines Fitnessbetriebs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311236