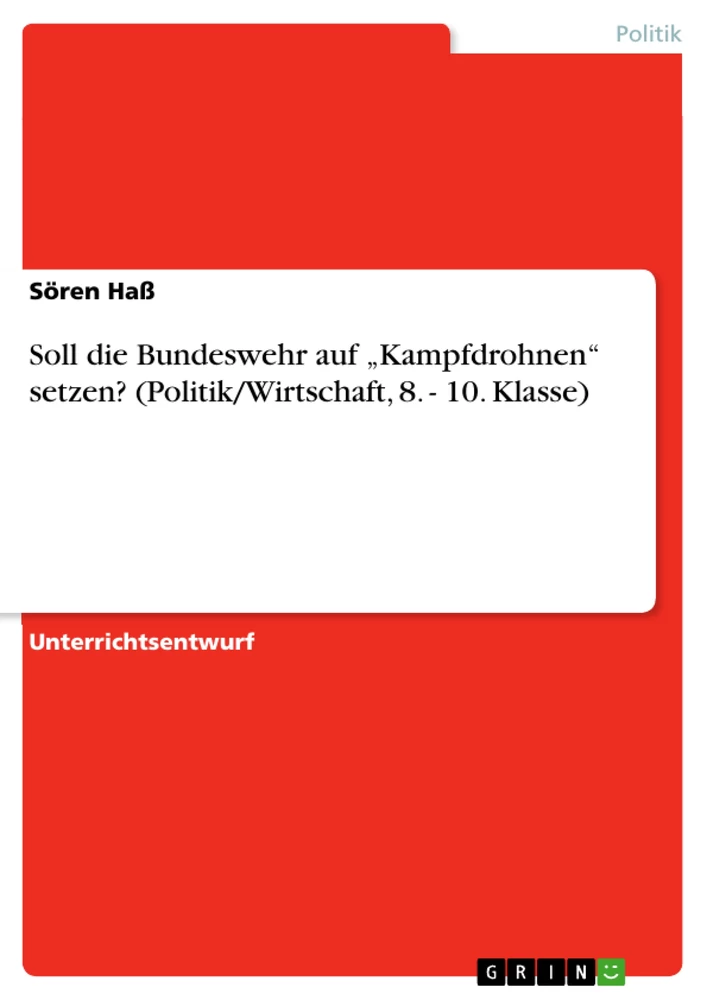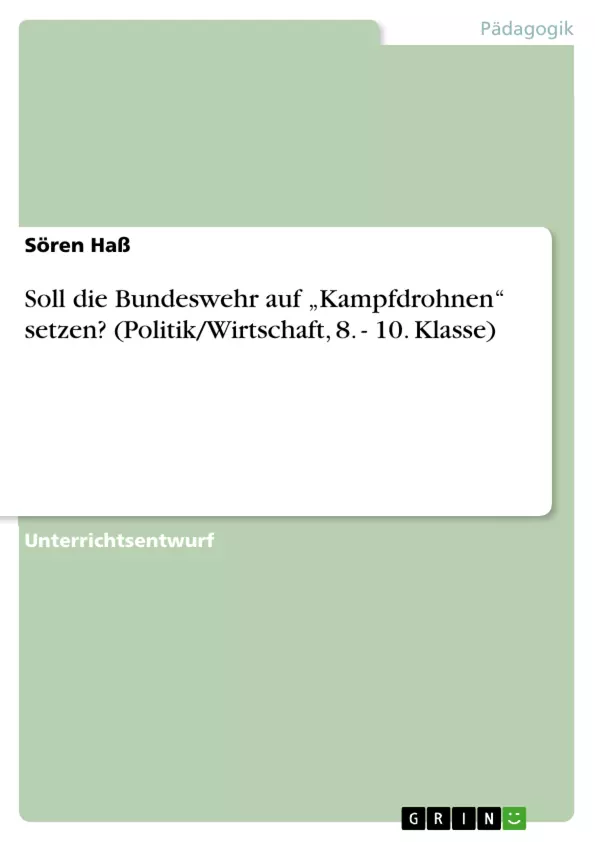Die zu zeigende Stunde ist die siebte Einzelstunde in der Einheit „Bundeswehreinsatz in Afghanistan – Eine Mission impossible?“ Dabei steht der laut Kerncurriculum zu bearbeitende Aspekt „Der politische Willensbildungsprozess in Deutschland bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr“ im Fokus. Es gibt jedoch auch Anknüpfungspunkte zur vorangegangenen Einheit, die die sicherheitspolitischen Herausforderungen (Terrorismus, Neue Kriege) in den Vordergrund stellte. In der aktuellen Einheit wurde damit begonnen, dass die Schüler den laut Spiralcurriculum bereits in 9/2 thematisierten Gesetzgebungsprozess rekapitulierten und die Bundeswehr als „Parlamentsarmee“ und die Bedeutung dieser Konstellation u.a. historisch einordneten. Dies bildete zugleich die Grundlage für das Vorhaben, das Fachkonzept Legitimation weiter zu entwickeln. Die Schüler erarbeiteten in dieser Hinsicht unter Einbezug des Grundgesetztes die nach Easton strukturelle Legitimität (nach Max Weber die legale) als einen wesentlichen Aspekt von Legitimität einer politischen Entscheidung am konkreten Fall der Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. In der vorbereitenden Stunde wurden die Redeprotokolle aus der aktuellen Stunde des Bundestages vom 31. Januar 2013 zur Frage, ob die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgerüstet werden solle hinsichtlich möglicher pro und contra Argumente und rhetorischer Aspekte analysiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Darstellung der Unterrichtssequenz
- 2. Lerngruppenanalyse
- 3. Didaktische Erörterung
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Materialanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, das Fachkonzept „Legitimation“ im Kontext des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan anhand des aktuellen Falls der „Kampfdrohnen“ zu vertiefen. Dabei wird das Konzept der Legitimität politischer Entscheidungen anhand des konkreten Beispiels der Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen analysiert.
- Politischer Willensbildungsprozess in Deutschland bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr
- Legitimität politischer Entscheidungen im Kontext des Einsatzes bewaffneter Drohnen
- Strukturelle und ideologische Legitimität
- Analyse von Pro- und Contra-Argumenten zur Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen
- Ethische und moralische Aspekte des Kampfdrohnen-Einsatzes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
In der ersten Darstellung wird die Unterrichtssequenz in den Kontext der gesamten Einheit „Bundeswehreinsatz in Afghanistan – Eine Mission impossible?“ eingeordnet. Dabei wird die Relevanz des Themas „Kampfdrohnen“ im Hinblick auf das Kerncurriculum und die vorangegangenen Einheiten herausgestellt.
Im zweiten Kapitel wird die Lerngruppe analysiert und auf die besonderen Herausforderungen der heterogenen Leistungscharakteristik des Kurses hingewiesen. Die Lehrkraft soll gezielt Anknüpfungspunkte für alle Schüler schaffen, um eine breite Mobilisierung zu fördern.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der didaktischen Erörterung des Themas „Kampfdrohnen“. In der Sachanalyse werden die Argumente von Befürwortern und Gegnern der Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen dargestellt. Die didaktische Analyse fokussiert auf die Weiterentwicklung des Fachkonzepts „Legitimation“ und die Bedeutung von ideologie- und grundwertgerechter Argumentation. In der Materialanalyse wird das Video und die Plenarprotokolle des Bundestages als zentrales Unterrichtsmaterial vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, dem Einsatz von „Kampfdrohnen“, dem politischen Willensbildungsprozess, der Legitimität politischer Entscheidungen, der strukturellen und ideologischen Legitimität, sowie den ethischen und moralischen Aspekten des Kampfdrohnen-Einsatzes. Die Analyse bezieht sich auf die Debatte im Bundestag und die Argumentationslinien von Befürwortern und Gegnern.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Parlamentsarmee"?
Es bedeutet, dass der Einsatz der Bundeswehr im Ausland immer der Zustimmung des Deutschen Bundestages bedarf. Das Parlament hat die letztendliche Entscheidungsgewalt über bewaffnete Einsätze.
Warum ist die Ausrüstung mit bewaffneten Drohnen politisch umstritten?
Befürworter argumentieren mit dem Schutz eigener Soldaten, während Gegner ethische Bedenken haben (z. B. die Senkung der Hemmschwelle für Gewalt) und eine völkerrechtliche Grauzone befürchten.
Was versteht man unter "struktureller Legitimität" einer Entscheidung?
Strukturelle Legitimität (nach Easton) bezieht sich darauf, dass eine Entscheidung im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Regeln und dem gesetzlich vorgeschriebenen Prozess (z. B. Bundestagsbeschluss) zustande gekommen ist.
Welche Rolle spielen ethische Grundwerte in der Drohnendebatte?
Die Debatte berührt zentrale Werte wie das Recht auf Leben, die Verhältnismäßigkeit von Gewalt und die Frage, ob ferngesteuertes Töten mit der Würde des Menschen und soldatischen Tugenden vereinbar ist.
Wie läuft der politische Willensbildungsprozess bei Auslandseinsätzen ab?
Der Prozess umfasst die Initiative der Bundesregierung, die Beratung in den Ausschüssen des Bundestages und die abschließende Debatte sowie Abstimmung im Plenum des Parlaments.
- Quote paper
- Sören Haß (Author), 2015, Soll die Bundeswehr auf „Kampfdrohnen“ setzen? (Politik/Wirtschaft, 8. - 10. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311338