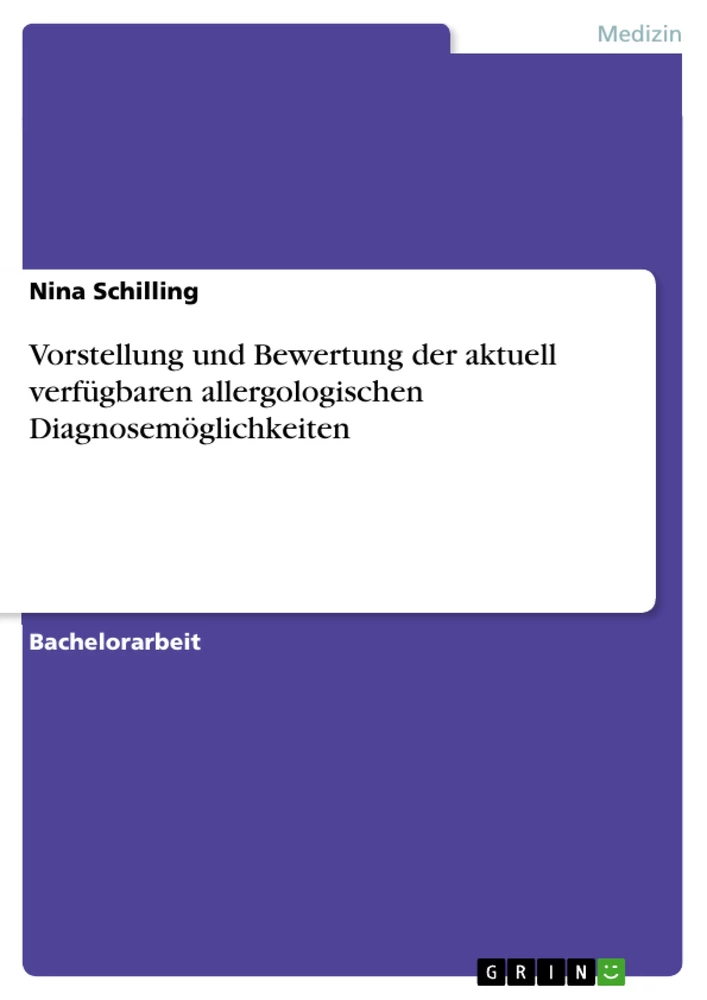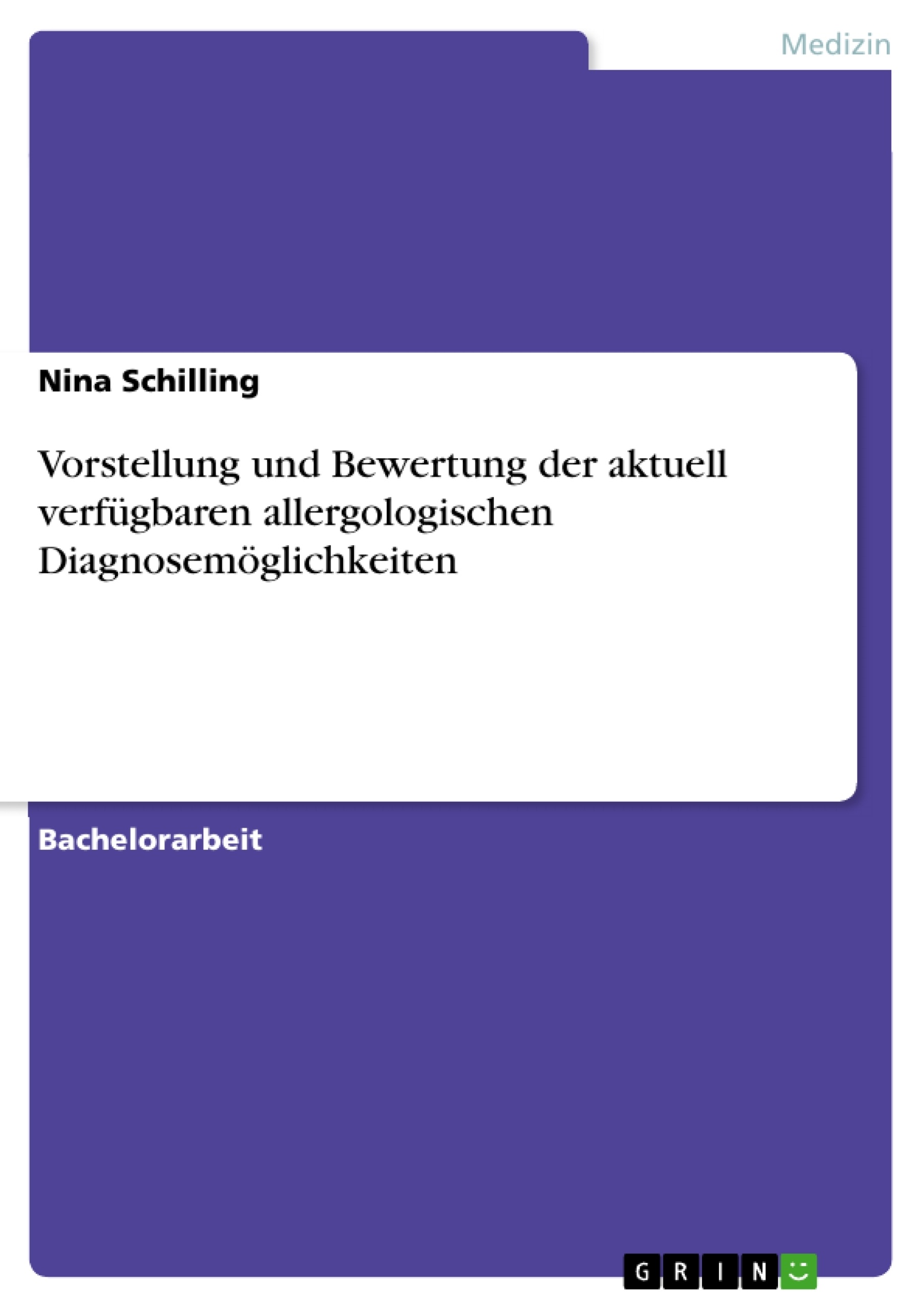Im 20. Jahrhundert, und besonders in der zweiten Hälfte davon, ist die Zahl an allergisch erkrankten Menschen, besonders in den Industrieländern, stark angestiegen. In Deutschland ist schätzungsweise jeder vierte bis fünfte Einwohner von einer allergischen Erkrankung, wie Asthma bronchiale oder atopische Dermatitis, betroffen. Viele der Betroffenen zeigen gleichzeitig Symptome mehrerer Erkrankungen des atopischen Formenkreises (vgl. Böcking / Renz / Pfefferle, 2012). Der atopische Formenkreis enthält die Erkrankungen atopische Dermatitis (AD), allergische Rhinokonjunktivitis, allergisches Asthma bronchiale (vgl. www.flexikon.doccheck.com) und Urtikaria (vgl. www.neurodermitis.net).
Speziell Asthma bronchiale, aber auch alle anderen atopischen Erkrankungen manifestieren sich meist schon im frühen Kindesalter. Somit machen Kinder und Jugendliche einen großen Teil der allergisch Erkrankten aus. Bereits 18% der unter 18-jährigen ist von Allergien betroffen (vgl. Böcking / Renz / Pfefferle, 2012). Allergische Erkrankungen sind nicht von einer hohen Mortalitätsrate gekennzeichnet, jedoch schränken sie die Lebensqualität der Betroffenen stark ein. Außerdem stellen die allergischen Erkrankungen eine Belastung für die Volkswirtschaft dar. Denn die Allergiker beanspruchen zunehmend Leistungen des Gesundheitssystems und verursachen durch Invalidität und Arbeitsunfähigkeit indirekt hohe Kosten. Im Jahr 2008 wurde durchschnittlich jede zehnte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen einer allergischen Ursache ausgestellt (vgl. Ebd.).
Aufgrund von ungenügenden Abrechnungsmodalitäten unter Praxisbedingungen wird eine qualifizierte Allergiediagnostik erschwert (vgl. Kleine-Tebbe / Herold, 2010). Demzufolge existieren auf dem Markt auch ungeeignete, wissenschaftlich nicht gesicherte Tests. Bei dem Einsatz von wissenschaftlich nicht gesicherten und nicht reproduzierbaren Testmethoden besteht ein hohes Risiko einer falschen Diagnose mit der Empfehlung von entsprechend ungeeigneten Therapiemethoden (vgl. Ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufgabenstellung
- 3. Methoden
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Anamnese
- 4.2 Hauttests
- 4.2.1 Pricktest
- 4.2.2 Reibetest
- 4.2.3 Scratch-Test
- 4.2.4 Intrakutantest
- 4.2.5 Epikutantest
- 4.2.6 Atopie-Patch-Test
- 4.3 In-Vitro Tests
- 4.3.1 Testprinzipien
- 4.3.2 RAST / EAST / CAP
- 4.3.3 Immunoblot
- 4.3.4 Allergen-Microarrays – ISAC
- 4.4 Bestimmung von Entzündungsmarkern
- 4.5 Zelluläre Tests
- 4.5.1 Zellulärer Antigen-Stimulationstest
- 4.5.2 Durchflusszytometrischer Basophilen-Aktivierungstest
- 4.5.3 Lymphozyten-Stimulationstest
- 4.6 Provokationstests
- 4.6.1 Nasaler Provokationstest
- 4.6.2 Konjunktivaler Provokationstest
- 4.6.3 Bronchialer Provokationstest
- 4.6.4 Oraler Provokationstest
- 5. Diskussion
- 5.1 Anamnese
- 5.2 Hauttests
- 5.2.1 Pricktest
- 5.2.2 Reibetest
- 5.2.3 Scratch-Test
- 5.2.4 Intrakutantest
- 5.2.5 Epikutantest
- 5.2.6 Atopie-Patch-Test
- 5.3 In-Vitro Tests
- 5.3.1 Testprinzipien
- 5.3.2 RAST / EAST / CAP
- 5.3.3 Immunoblot
- 5.3.4 Allergen-Microarrays – ISAC
- 5.4 Bestimmung von Entzündungsmarkern
- 5.5 Zelluläre Tests
- 5.5.1 Zellulärer Antigen-Stimulationstest
- 5.5.2 Durchflusszytometrischer Basophilen-Aktivierungstest
- 5.5.3 Lymphozyten-Stimulationstest
- 5.6 Provokationstests
- 5.6.1 Nasaler Provokationstest
- 5.6.2 Konjunktivaler Provokationstest
- 5.6.3 Bronchialer Provokationstest
- 5.6.4 Oraler Provokationstest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit bietet einen Überblick über die aktuell verfügbaren allergologischen Diagnosemöglichkeiten. Die Zielsetzung ist die Darstellung und Bewertung verschiedener Testmethoden unter Berücksichtigung ihrer Indikationen, Kontraindikationen, Verlässlichkeit und klinischen Relevanz. Stärken und Schwächen der einzelnen Verfahren werden herausgearbeitet.
- Bewertung verschiedener allergologischer Testmethoden (Hauttests, In-vitro-Tests, Provokationstests)
- Analyse der Aussagekraft und der Grenzen der einzelnen Diagnoseverfahren
- Diskussion der klinischen Relevanz der Testergebnisse im Kontext der Anamnese
- Herausarbeitung von Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden
- Zusammenfassende Beurteilung der aktuellen Möglichkeiten der Allergiediagnostik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anstieg allergischer Erkrankungen im 20. Jahrhundert, insbesondere in Industrieländern, und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität Betroffener und die Volkswirtschaft. Sie führt in die Grundlagen der Immunologie ein, erklärt den Unterschied zwischen natürlicher und erworbener Immunität und beschreibt die verschiedenen Immunglobulinklassen (IgE, IgG, IgA, IgM, IgD), wobei der Fokus auf IgE und seiner Rolle bei allergischen Reaktionen liegt. Die Bedeutung der Allergieklassifikation nach Coombs und Gell (Typ I-IV) wird erläutert und die verschiedenen Allergentypen (Inhalations-, Ingestions-, Kontakt-, Injektionsallergene) werden vorgestellt. Schließlich wird der Unterschied zwischen Allergie und Pseudoallergie erklärt.
2. Aufgabenstellung: Dieses Kapitel definiert die Ziele der Arbeit: Erstellung einer Übersicht über aktuell verfügbare diagnostische Tests zum Nachweis von Allergien, inklusive Indikation und Kontraindikation, sowie eine Bewertung der einzelnen Tests hinsichtlich Verlässlichkeit und klinischer Relevanz. Die Stärken und Schwächen jedes Tests werden in einer Tabelle zusammengefasst.
3. Methoden: Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche in Datenbanken wie Pubmed und Springerlink sowie der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche und beschreibt die drei Säulen der allergologischen Diagnostik: Anamnese, Hauttests und In-vitro-Tests. Es werden die verschiedenen Testverfahren detailliert erläutert, von der Anamnese über Hauttests (Pricktest, Reibetest, Scratch-Test, Intrakutantest, Epikutantest, Atopie-Patch-Test) und In-vitro-Tests (RAST/EAST/CAP, Immunoblot, Allergen-Microarrays – ISAC, Bestimmung von Entzündungsmarkern) bis hin zu zellulären Tests (CAST, DZBAT, LST) und Provokationstests (nasal, konjunktival, bronchial, oral). Für jede Methode wird das jeweilige Verfahren, die Indikation, Kontraindikationen und die Interpretation der Ergebnisse beschrieben.
Schlüsselwörter
Allergie, Allergiediagnostik, IgE, Immunglobuline, Hauttests, Pricktest, Epikutantest, Atopie-Patch-Test, In-vitro-Tests, RAST, CAP, Immunoblot, Allergen-Microarrays (ISAC), Provokationstests, Anamnese, Entzündungsmarker, Zelluläre Tests, Coombs und Gell, Typ-I-Reaktion, Typ-IV-Reaktion, Kreuzreaktionen, Pseudoallergie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Übersicht allergologischer Diagnosemöglichkeiten
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Diese Bachelorarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die aktuell verfügbaren allergologischen Diagnosemöglichkeiten. Sie beschreibt und bewertet verschiedene Testmethoden, berücksichtigt deren Indikationen, Kontraindikationen, Verlässlichkeit und klinische Relevanz und arbeitet die Stärken und Schwächen der einzelnen Verfahren heraus. Die Arbeit umfasst die Einleitung, Aufgabenstellung, Methoden, Ergebnisse (inkl. detaillierter Beschreibung verschiedener Testverfahren wie Hauttests, In-vitro-Tests und Provokationstests) und Diskussion der Ergebnisse.
Welche Arten von allergologischen Tests werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Palette allergologischer Testmethoden, darunter: Hauttests (Pricktest, Reibetest, Scratch-Test, Intrakutantest, Epikutantest, Atopie-Patch-Test), In-vitro-Tests (RAST/EAST/CAP, Immunoblot, Allergen-Microarrays – ISAC, Bestimmung von Entzündungsmarkern), zelluläre Tests (zellulärer Antigen-Stimulationstest, durchflusszytometrischer Basophilen-Aktivierungstest, Lymphozyten-Stimulationstest) und Provokationstests (nasaler, konjunktivaler, bronchialer, oraler Provokationstest). Die Anamnese als wichtiger Bestandteil der Diagnostik wird ebenfalls ausführlich behandelt.
Wie werden die verschiedenen Testmethoden bewertet?
Für jede Testmethode werden Verfahren, Indikation, Kontraindikationen und Interpretation der Ergebnisse beschrieben. Die Arbeit analysiert die Aussagekraft und Grenzen der einzelnen Diagnoseverfahren und diskutiert deren klinische Relevanz im Kontext der Anamnese. Stärken und Schwächen der jeweiligen Methoden werden herausgearbeitet, um eine umfassende Beurteilung der aktuellen Möglichkeiten der Allergiediagnostik zu ermöglichen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Erstellung einer Übersicht über aktuell verfügbare diagnostische Tests zum Nachweis von Allergien, inklusive Indikation und Kontraindikation, sowie eine Bewertung der einzelnen Tests hinsichtlich Verlässlichkeit und klinischer Relevanz. Die Stärken und Schwächen jedes Tests werden ausführlich dargestellt.
Welche Methoden wurden zur Erstellung der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche in Datenbanken wie Pubmed und Springerlink sowie der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Allergie, Allergiediagnostik, IgE, Immunglobuline, Hauttests, Pricktest, Epikutantest, Atopie-Patch-Test, In-vitro-Tests, RAST, CAP, Immunoblot, Allergen-Microarrays (ISAC), Provokationstests, Anamnese, Entzündungsmarker, Zelluläre Tests, Coombs und Gell, Typ-I-Reaktion, Typ-IV-Reaktion, Kreuzreaktionen, Pseudoallergie.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels: Einleitung (Hintergrundinformationen zu Allergien, Immunologie und Allergieklassifizierung), Aufgabenstellung (klare Definition der Ziele), Methoden (Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden), und Ergebnisse (detaillierte Darstellung der verschiedenen Testverfahren und deren Bewertung).
- Arbeit zitieren
- Nina Schilling (Autor:in), 2013, Vorstellung und Bewertung der aktuell verfügbaren allergologischen Diagnosemöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311456