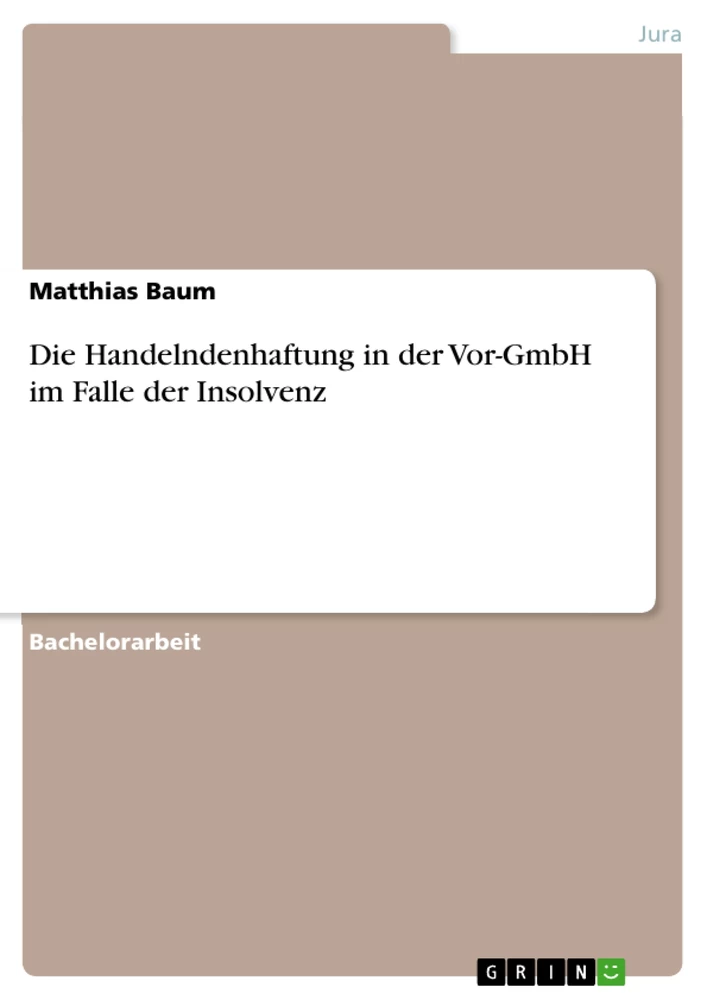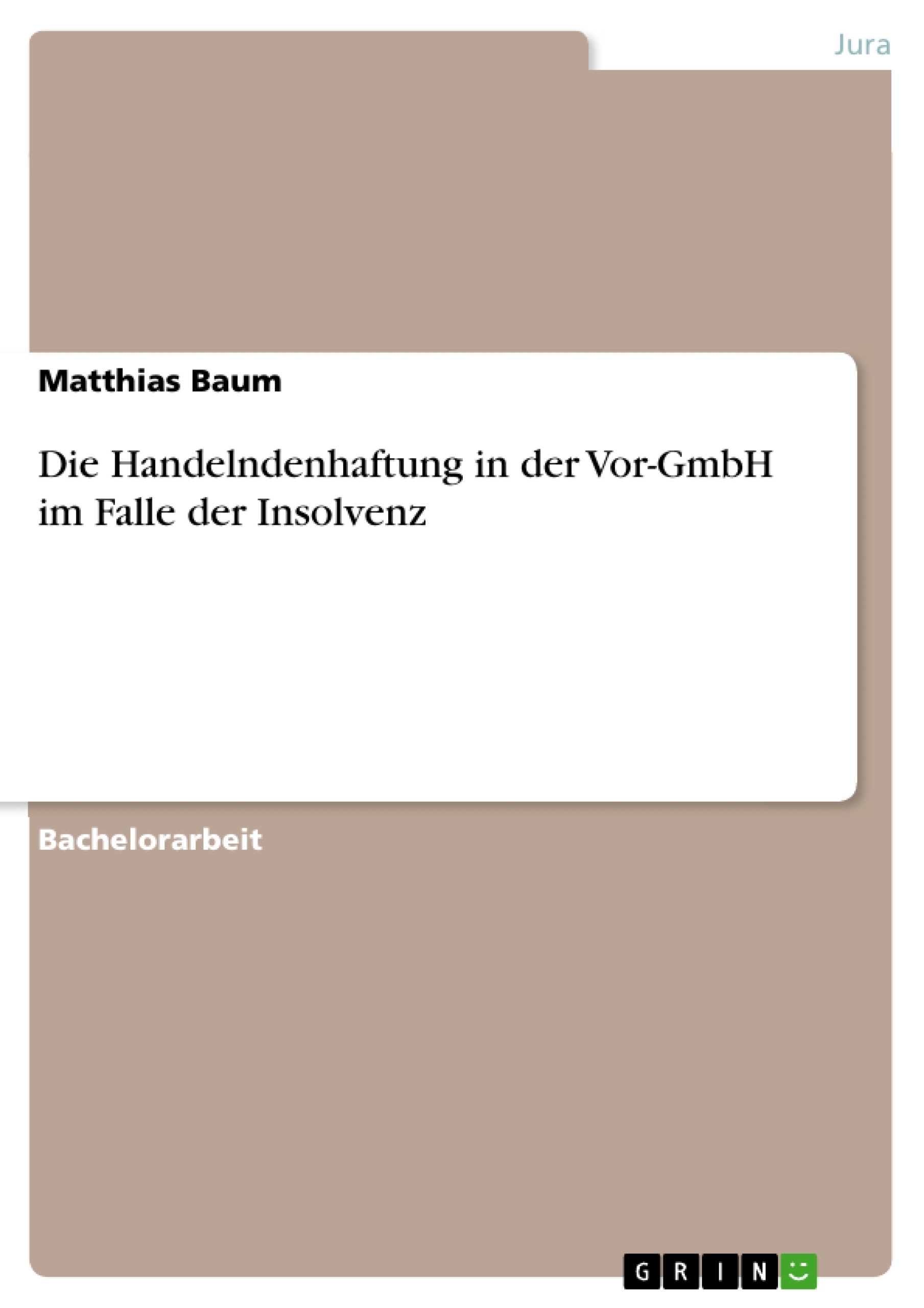Die Arbeit befasst sich zunächst mit dem Begriff der Handelndenhaftung im (Zwischen-)Stadium der Vor-GmbH, § 11 II GmbHG. Es wird insbesondere eine Analyse nach den vier gängigen Auslegungsmethoden durchgenommen und auch die noch h.M. kritisch hinterfragt. Der zweite Komplex befasst sich vornehmlich mit der Insolvenzverschleppungshaftung nach § 15a InsO und den Verpflichtungen des Geschäftsführers gem. § 64 GmbHG. Besonders kritisiert und diskutiert wird die analoge Strafbarkeit des faktischen Geschäftsführers durch eine Insolvenzverschleppung.
Geschlossen wird die Arbeit mit einem Aufgriff zur Gesetzesvereinfachung.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH
- I. Anwendungsbereich des § 11 GmbHG
- 1. Erläuterung der Gründungsstadien
- 2. Entstehen und Konsequenzen der unechten Vor-GmbH
- 3. Ursprung der Handelndenhaftung
- 4. Eigenschaften und Fortbestehen der Handelndenhaftung
- 5. Besonderheiten der Einpersonen-Gründung
- II. Wortlautauslegung
- 1. Untersuchung des Handelndenbegriffs
- 2. Eingrenzung des zeitlichen Haftungsrahmens
- 3. Merkmal der solidarischen Haftung
- 4. Bedeutung im Namen der Gesellschaft
- III. Systematische Auslegung
- IV. Historische Auslegung
- 1. Strafcharakter der Handelndenhaftung
- 2. Konsequenzen des gesetzgeberischen Entschlusses zur Untätigkeit
- 3. Grundsatzurteil zur Gründerhaftung
- 4. Anwendbarkeit der Falsus-procurator-Haftung
- V. Teleologische Auslegung
- 1. Sinnhaftigkeit des Vorbelastungsverbots
- 2. Erlöschen der Handelndenhaftung
- 3. Anzweiflung der Sinnhaftigkeit der Handelndenhaftung
- I. Anwendungsbereich des § 11 GmbHG
- C. Die Haftungsvermeidung
- I. Grundsätzliches
- II. Analoge Handelndenhaftung im europarechtlichen Kontext
- D. Die Konstellation der Haftung in der Insolvenz
- I. Insolvenzgründe und -verfahren
- 1. Ablehnung mangels Masse
- 2. Funktionen des Liquidators
- 3. Das Regelinsolvenzverfahren
- 4. Aufgaben des Insolvenzverwalters
- 5. Möglichkeiten im Insolvenzplanverfahren
- 6. Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren und Sachwalter
- 7. Einordnung der Vor-GmbH in die Insolvenz
- I. Insolvenzgründe und -verfahren
- E. Der Tatbestand der Insolvenzverschleppung für juristische Personen
- I. Zivilrechtliche Auseinandersetzung
- II. Strafrechtliche Aspekte des § 15a InsO
- F. Die faktische Geschäftsführerhaftung gem. § 64 GmbHG
- I. Grundsätzliches
- II. Haftung aus § 25 HGB
- III. Prozessuales
- G. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH im Falle der Insolvenz. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen dieser Haftung zu klären und die Konsequenzen im Insolvenzfall zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Auslegungsmöglichkeiten des relevanten Rechts und betrachtet sowohl zivil- als auch strafrechtliche Aspekte.
- Handelndenhaftung in der Vor-GmbH
- Anwendungsbereich des § 11 GmbHG
- Insolvenzrechtliche Konsequenzen
- Haftungsvermeidung
- Insolvenzverschleppung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Untersuchung zur Handelndenhaftung in der Vor-GmbH im Insolvenzfall. Sie gibt einen Überblick über die zentralen Fragestellungen und den methodischen Ansatz der Arbeit.
B. Die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH: Dieses Kapitel behandelt umfassend die Handelndenhaftung im Kontext der Vor-GmbH. Es analysiert den Anwendungsbereich des § 11 GmbHG, beleuchtet verschiedene Auslegungsperspektiven (Wortlaut, Systematik, Historie, Teleologie) und untersucht den Handelndenbegriff, den zeitlichen Haftungsrahmen sowie die Besonderheiten der solidarischen Haftung. Die Besonderheiten der Einpersonen-Gründung werden ebenfalls berücksichtigt. Die unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten werden kritisch gegeneinander abgewogen und ihre jeweilige Reichweite diskutiert.
C. Die Haftungsvermeidung: Dieses Kapitel befasst sich mit Möglichkeiten der Haftungsvermeidung im Kontext der Handelndenhaftung. Es analysiert grundsätzliche Strategien und untersucht die analoge Anwendbarkeit der Handelndenhaftung im europarechtlichen Kontext. Der Fokus liegt auf präventiven Maßnahmen und rechtlichen Möglichkeiten, die Haftung zu reduzieren oder zu umgehen.
D. Die Konstellation der Haftung in der Insolvenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen, die sich im Kontext der Insolvenz einer Vor-GmbH für die handelnden Personen ergeben. Es beleuchtet verschiedene Insolvenzgründe und -verfahren, die Rolle des Insolvenzverwalters und die Möglichkeiten im Insolvenzplanverfahren. Die Einordnung der Vor-GmbH in das Insolvenzrecht und die Auswirkungen auf die Handelndenhaftung stehen im Mittelpunkt.
E. Der Tatbestand der Insolvenzverschleppung für juristische Personen: Dieses Kapitel untersucht den Tatbestand der Insolvenzverschleppung nach § 15a InsO sowohl aus zivil- als auch aus strafrechtlicher Perspektive. Es analysiert den Geltungsbereich, den geschützten Personenkreis, die Antragstellungspflichten und die Bedeutung von Verschulden. Die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale werden detailliert erörtert, inklusive der Beweislastverteilung, des Quotenschadens und der Rechtsnatur des § 15a InsO als Schutzgesetz.
F. Die faktische Geschäftsführerhaftung gem. § 64 GmbHG: Dieses Kapitel befasst sich mit der faktischen Geschäftsführerhaftung nach § 64 GmbHG. Es untersucht den Begriff des "faktischen Geschäftsführers", den Zahlungsbegriff und die Rechtsfolge dieser Haftung. Die Möglichkeiten der Exkulpation des faktischen Geschäftsführers sowie die Haftung aus § 25 HGB und prozessuale Aspekte werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Handelndenhaftung, Vor-GmbH, Insolvenz, § 11 GmbHG, § 15a InsO, § 64 GmbHG, Insolvenzverschleppung, Geschäftsführerhaftung, Haftungsauslegung, Europarecht.
Häufig gestellte Fragen zur Handelndenhaftung in der Vor-GmbH
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Handelndenhaftung in der Vor-GmbH, insbesondere im Kontext der Insolvenz. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen dieser Haftung, analysiert die Konsequenzen im Insolvenzfall und beleuchtet zivil- und strafrechtliche Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH unter verschiedenen Aspekten: den Anwendungsbereich des § 11 GmbHG, unterschiedliche Auslegungsperspektiven (Wortlaut, Systematik, Historie, Teleologie), den Handelndenbegriff, den zeitlichen Haftungsrahmen, die solidarische Haftung, Besonderheiten der Einpersonen-Gründung, Haftungsvermeidung, Insolvenzrechtliche Konsequenzen, Insolvenzverschleppung (§ 15a InsO) und die faktische Geschäftsführerhaftung (§ 64 GmbHG).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die rechtlichen Grundlagen der Handelndenhaftung in der Vor-GmbH zu klären und die Konsequenzen im Insolvenzfall zu analysieren. Die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten des relevanten Rechts werden beleuchtet und kritisch gewogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH (inkl. detaillierter Unterkapitel zu Auslegung, Anwendungsbereich des §11 GmbHG und Besonderheiten), Die Haftungsvermeidung, Die Konstellation der Haftung in der Insolvenz, Der Tatbestand der Insolvenzverschleppung für juristische Personen, Die faktische Geschäftsführerhaftung gem. § 64 GmbHG und Fazit.
Wie wird die Handelndenhaftung ausgelegt?
Die Arbeit untersucht die Handelndenhaftung unter Berücksichtigung verschiedener Auslegungsperspektiven: Wortlautauslegung, systematische Auslegung, historische Auslegung und teleologische Auslegung. Die unterschiedlichen Auslegungen werden kritisch verglichen und ihre jeweilige Reichweite diskutiert.
Welche Rolle spielt das Insolvenzrecht?
Das Insolvenzrecht spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Konsequenzen der Handelndenhaftung im Insolvenzfall einer Vor-GmbH analysiert. Es werden verschiedene Insolvenzgründe und -verfahren, die Rolle des Insolvenzverwalters und die Möglichkeiten im Insolvenzplanverfahren beleuchtet.
Welche Bedeutung hat die Insolvenzverschleppung?
Die Arbeit untersucht den Tatbestand der Insolvenzverschleppung nach § 15a InsO aus zivil- und strafrechtlicher Sicht. Der Geltungsbereich, der geschützte Personenkreis, Antragstellungspflichten, Verschulden, objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale, Beweislastverteilung, Quotenschaden und die Rechtsnatur des § 15a InsO als Schutzgesetz werden erörtert.
Was ist die faktische Geschäftsführerhaftung?
Die Arbeit behandelt die faktische Geschäftsführerhaftung nach § 64 GmbHG, den Begriff des "faktischen Geschäftsführers", den Zahlungsbegriff, die Rechtsfolge dieser Haftung, Möglichkeiten der Exkulpation, die Haftung aus § 25 HGB und prozessuale Aspekte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Handelndenhaftung, Vor-GmbH, Insolvenz, § 11 GmbHG, § 15a InsO, § 64 GmbHG, Insolvenzverschleppung, Geschäftsführerhaftung, Haftungsauslegung, Europarecht.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet eine Zusammenfassung der Bachelorarbeit. Der vollständige Text der Arbeit enthält detailliertere Informationen und Analysen zu den einzelnen Themen.
- Arbeit zitieren
- Matthias Baum (Autor:in), 2015, Die Handelndenhaftung in der Vor-GmbH im Falle der Insolvenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311472