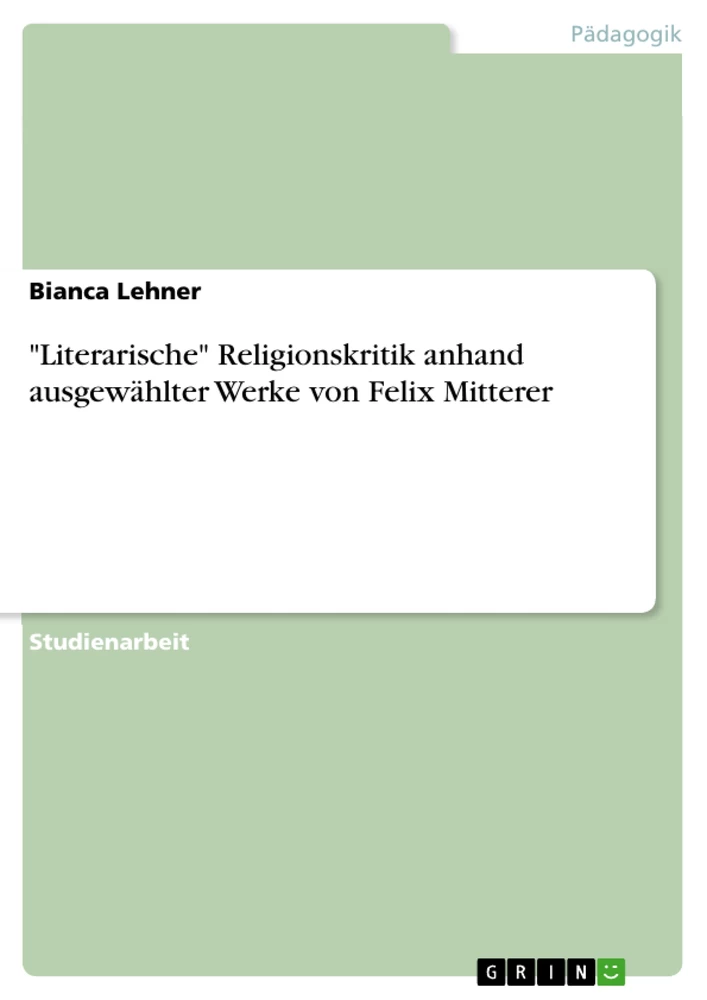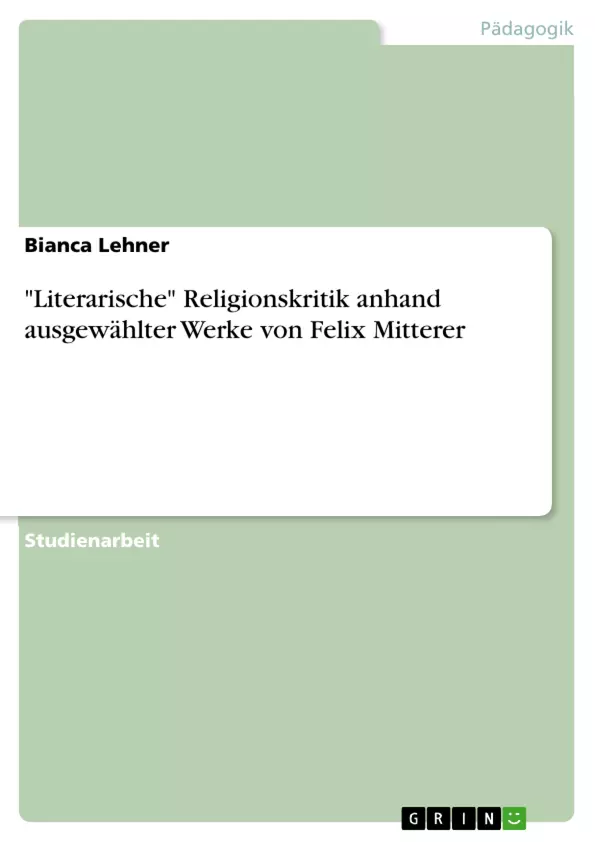Immer häufiger geraten die Kirche und somit auch die Religion in der heutigen Zeit ins Kreuzfeuer der Kritik. Die veralteten Ansichten der Kirche und ihrer Vertreter sowie die Zustände innerhalb der Institution werden nicht nur vom gemeinen Volk angeprangert, sondern sind oft auch ein Thema für namhafte Literaten.
Besonders der Österreicher Felix Mitterer versteht es ausgezeichnet, in seinen gesell-schaftskritischen Werken einerseits die Meinung des Volkes zu vertreten und anderer-seits den Menschen gleichzeitig einen Spiegel vorzuhalten und sie zum Nachdenken über sich selbst und ihr Verhalten anzuregen. Beinahe alle seiner Stücke haben eine wahre Begebenheit zum Anlass, sind also brandaktuell, und berühren das Publikum o-der den Leser auch durch die einfach verständliche Sprache, in der sie verfasst sind.
Da ich glaube, dass Felix Mitterer einer der wenigen Autoren ist, deren Kritikpunkte auch tatsächlich von den Menschen verstanden und angenommen werden, möchte ich im Folgenden genauer untersuchen, wie Mitterers Verhältnis zu Religion und Kirche ist und auf welche Art und Weise er diese in seinen Werken kritisiert. Auch erscheint es mir wichtig, zuvor noch zu klären, was genau man unter Religionskritik versteht, sowie kurz aufzuzeigen, welche Personen sich bereits vor Mitterer gegen religiöse Missstände zur Wehr gesetzt haben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Religionskritik
- Arten von Religionskritik
- Kirchenkritik
- Religionskritiker
- Felix Mitterer
- Mitterers Verhältnis zur Religion
- Religionskritische Elemente in Mitterers Werken
- Kein Platz für Idioten
- Krach im Hause Gott
- Die Beichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit der "literarischen" Religionskritik anhand ausgewählter Werke von Felix Mitterer. Ziel der Arbeit ist es, Mitterers Verhältnis zur Religion und Kirche zu untersuchen und die Art und Weise zu analysieren, wie er diese in seinen Werken kritisiert. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Arten von Religionskritik und zeigt auf, welche Personen sich bereits vor Mitterer gegen religiöse Missstände zur Wehr gesetzt haben.
- Religionskritik als ein zentrales Thema in Mitterers Werken
- Die Kritik an veralteten Ansichten der Kirche und ihrer Vertreter
- Die Darstellung von religiösen Missständen in Mitterers Stücken
- Die Analyse der Beziehung zwischen Religion, Gesellschaft und Individuum
- Die Rolle der Religion in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz von Religionskritik in der heutigen Zeit und stellt die Werke von Felix Mitterer als ein wichtiges Beispiel für diese Thematik vor. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Arten von Religionskritik, darunter die allgemeine und spezielle Religionskritik sowie die Unterscheidung nach Herkunft und methodischem Zugang. Das dritte Kapitel behandelt die Kirchenkritik im Vergleich zur Religionskritik und untersucht, wie eng diese beiden Bereiche miteinander verbunden sind.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Religionskritiker, wie Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Sigmund Freud, vorgestellt und deren Ansichten zusammengefasst. Das fünfte Kapitel widmet sich dem Autor Felix Mitterer und seinem Verhältnis zur Religion. Das sechste Kapitel analysiert die religionskritischen Elemente in drei ausgewählten Werken von Mitterer: "Kein Platz für Idioten", "Krach im Hause Gott" und "Die Beichte".
Schlüsselwörter (Keywords)
Religionskritik, Kirchenkritik, Felix Mitterer, Literatur, Gesellschaft, Kirche, Religion, Atheismus, Moral, Glaube, Gottesbild, Kritik, Religionsphilosophie, Religionssoziologie, Religionsgeschichte, Feuerbach, Marx, Freud, Österreich, Theater, Drama.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter literarischer Religionskritik?
Es ist die kritische Auseinandersetzung mit religiösen Dogmen, Institutionen oder Glaubensvorstellungen innerhalb literarischer Werke, um gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen.
Warum ist Felix Mitterer ein bedeutender Religionskritiker?
Mitterer nutzt wahre Begebenheiten und eine einfache, volksnahe Sprache, um der Kirche den Spiegel vorzuhalten und veraltete Moralvorstellungen zu hinterfragen.
Welche Werke von Mitterer werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht die Stücke „Kein Platz für Idioten“, „Krach im Hause Gott“ und „Die Beichte“ auf ihre religionskritischen Inhalte.
Wer waren die Vorbilder der modernen Religionskritik?
Die Arbeit nennt klassische Denker wie Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Sigmund Freud, die das Fundament für die moderne Auseinandersetzung mit Religion legten.
Was kritisiert Mitterer konkret an der Institution Kirche?
Er kritisiert vor allem die mangelnde Nächstenliebe gegenüber Außenseitern, die Heuchelei der Vertreter und die starren Machtstrukturen innerhalb der Glaubensgemeinschaft.
- Quote paper
- Bianca Lehner (Author), 2015, "Literarische" Religionskritik anhand ausgewählter Werke von Felix Mitterer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311506