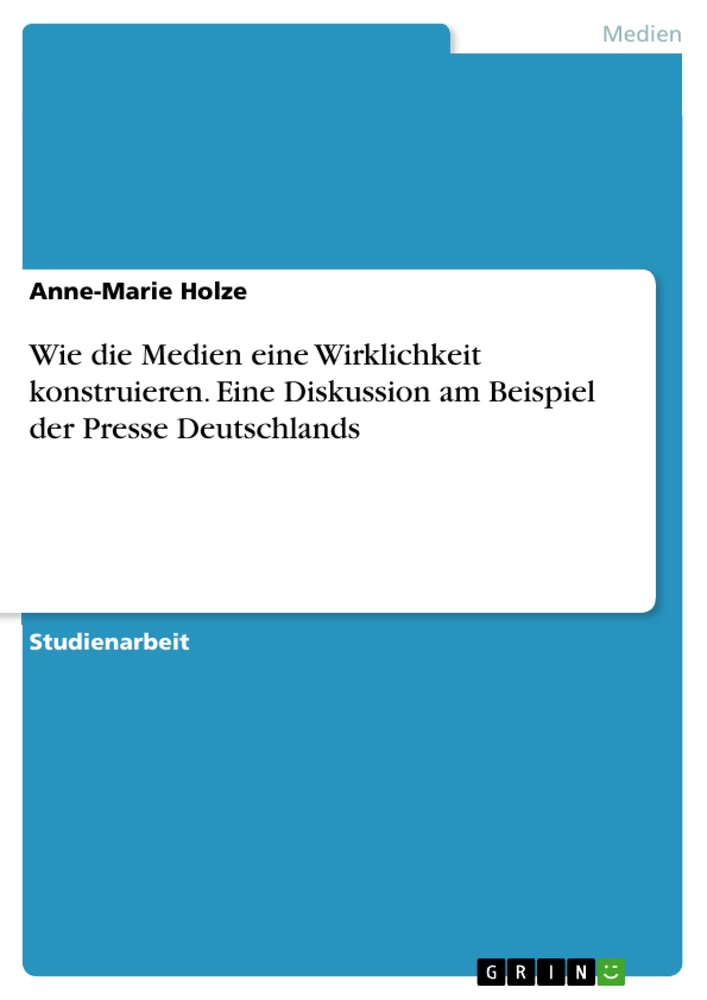Die Massenmedien spielen in der heutigen Gesellschaft eine ausschlaggebende Rolle, wenn es darum geht, an Informationen über die Welt zu gelangen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich die Frage diskutieren, inwiefern die Presse als Massenmedium die Wirklichkeit beeinflusst oder konstruiert.
Hierzu beleuchte ich kurz die rechtlichen Möglichkeiten dieses Mediums beziehungsweise die, der Redakteure. Wie weit reicht die Freiheit der Presse und welche Rechte stehen ihr zu? Dann versuche ich die Subjektivität der Wirklichkeit zu untersuchen. Gibt es einen Unterschied zwischen der Realität und der Wirklichkeit? Hat jeder seine eigene Wirklichkeit? Weiterhin folgt eine Untersuchung der Art und Weise wie die Wirklichkeit in der Presse dargestellt werden kann. Schafft schon die Auswahl der Artikel eine Begrenzung der Wirklichkeit? Welche Rolle spielt die Emotionalisierung?
Als Bespiele beleuchte ich eine Schlagzeile der Bild-Zeitung über die Leichtathletik-WM, die Serie über den 11. September im Stern und das Thema des Turiner Leichentuches, was in einer PM-Perspektive angesprochen wird. Abschließend überlege ich, welche Konsequenzen aus der Umgangsart der Presse mit der Realität entstehen können. Welche Verantwortung liegt bei der Presse? Wie wird das Verhalten der Menschen oder eine Bildung der Kultur verändert? Diese Fragen führen letztlich zu Einer: Schaffen die Medien ihre eigene Wirklichkeit und welchen Einfluss haben die auf kollektives Wissen?
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenhang zwischen Medien und Wirklichkeit
- Konstruiert die Presse eine Wirklichkeit?
- Die Freiheit der Presse
- Die Subjektivität der Wirklichkeit
- Die Konsequenzen ihrer Wirklichkeit
- Die Beeinflussung des kollektiven Wissens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Presse auf die Konstruktion und Wahrnehmung der Wirklichkeit. Es wird analysiert, inwieweit die Pressefreiheit die Darstellung der Realität prägt und welche Rolle die Subjektivität in der Berichterstattung spielt. Die Arbeit beleuchtet die Konsequenzen dieser medialen Wirklichkeitskonstruktion für die Gesellschaft.
- Die Rolle der Pressefreiheit in der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung
- Die Subjektivität der Wirklichkeit und deren mediale Darstellung
- Die Auswahl von Nachrichten und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung
- Die Konsequenzen der medialen Wirklichkeitskonstruktion für das kollektive Wissen
- Die Verantwortung der Presse in der demokratischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenhang zwischen Medien und Wirklichkeit: Die Einleitung betont die zentrale Rolle der Massenmedien – Fernsehen, Rundfunk, Internet und Presse – in der Informationsvermittlung und hebt die besondere Zugänglichkeit der Presse hervor. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie die Presse die Wirklichkeit beeinflusst oder konstruiert, indem sie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Pressefreiheit, die Subjektivität der Wirklichkeitswahrnehmung und die Konsequenzen der medialen Darstellung untersucht. Beispiele wie eine Bild-Zeitung-Schlagzeile, die Stern-Serie zum 11. September und die Berichterstattung über das Turiner Grabtuch illustrieren die Problematik der medialen Wirklichkeitskonstruktion.
Konstruiert die Presse eine Wirklichkeit?: Dieses Kapitel analysiert die Pressefreiheit im Kontext des deutschen Grundgesetzes (Artikel 5). Es differenziert zwischen der garantierten Meinungsfreiheit und ihren Grenzen, wie etwa der Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder der Verletzung der persönlichen Ehre. Das Informationsrecht der Bürger wird als weiterer wichtiger Aspekt hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, wobei der demokratische Kontext stets im Vordergrund steht. Die Bedeutung des Wettbewerbsrechts für den Pluralismus der Medienlandschaft wird ebenfalls diskutiert.
Die Subjektivität der Wirklichkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die These, dass unser Wissen über die Welt maßgeblich von den Massenmedien geprägt wird. Es hinterfragt die Objektivität der Presseberichterstattung und betont deren meinungsbildende Funktion. Die Auswahl der Themen, deren Platzierung und die Art der Darstellung beeinflussen die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die Stern-Serie zum 11. September wird als Beispiel für die Konstruktion einer medialen Wirklichkeit herangezogen, die zwar auf realen Ereignissen basiert, aber durch die Selektion und Präsentation der Informationen eine spezifische Interpretation und Gewichtung vermittelt.
Schlüsselwörter
Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Wirklichkeitskonstruktion, Medienwirklichkeit, Subjektivität, Objektivität, kollektives Wissen, Meinungsbildung, Demokratie, Wettbewerbsrecht, Informationsrecht, Massenmedien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Presse auf die Konstruktion und Wahrnehmung der Wirklichkeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Presse auf die Konstruktion und Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie analysiert, inwieweit Pressefreiheit die Darstellung der Realität prägt und welche Rolle die Subjektivität in der Berichterstattung spielt. Die Konsequenzen dieser medialen Wirklichkeitskonstruktion für die Gesellschaft werden beleuchtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Pressefreiheit in der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung, die Subjektivität der Wirklichkeit und deren mediale Darstellung, die Auswahl von Nachrichten und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung, die Konsequenzen der medialen Wirklichkeitskonstruktion für das kollektive Wissen und die Verantwortung der Presse in der demokratischen Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst Kapitel zum Zusammenhang zwischen Medien und Wirklichkeit (mit Fokus auf die Einflussnahme der Presse), zur Frage, ob die Presse eine Wirklichkeit konstruiert (inkl. Analyse der Pressefreiheit im deutschen Grundgesetz und des Spannungsfelds zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechten), und zur Subjektivität der Wirklichkeit (mit Betonung der meinungsbildenden Funktion der Medien und der selektiven Darstellung von Informationen).
Welche Beispiele werden verwendet, um die Thesen zu veranschaulichen?
Es werden Beispiele wie eine Bild-Zeitung-Schlagzeile, die Stern-Serie zum 11. September und die Berichterstattung über das Turiner Grabtuch verwendet, um die Problematik der medialen Wirklichkeitskonstruktion zu illustrieren. Die Stern-Serie zum 11. September dient als Beispiel für die Konstruktion einer medialen Wirklichkeit, die zwar auf realen Ereignissen basiert, aber durch Selektion und Präsentation der Informationen eine spezifische Interpretation und Gewichtung erhält.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Wirklichkeitskonstruktion, Medienwirklichkeit, Subjektivität, Objektivität, kollektives Wissen, Meinungsbildung, Demokratie, Wettbewerbsrecht, Informationsrecht, Massenmedien.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss der Presse auf die Konstruktion und Wahrnehmung der Wirklichkeit zu untersuchen und die Konsequenzen dieser Konstruktion für die Gesellschaft zu analysieren. Sie beleuchtet dabei insbesondere die Rolle der Pressefreiheit und die Auswirkungen der Subjektivität in der Berichterstattung.
- Arbeit zitieren
- Anne-Marie Holze (Autor:in), 2011, Wie die Medien eine Wirklichkeit konstruieren. Eine Diskussion am Beispiel der Presse Deutschlands, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311644