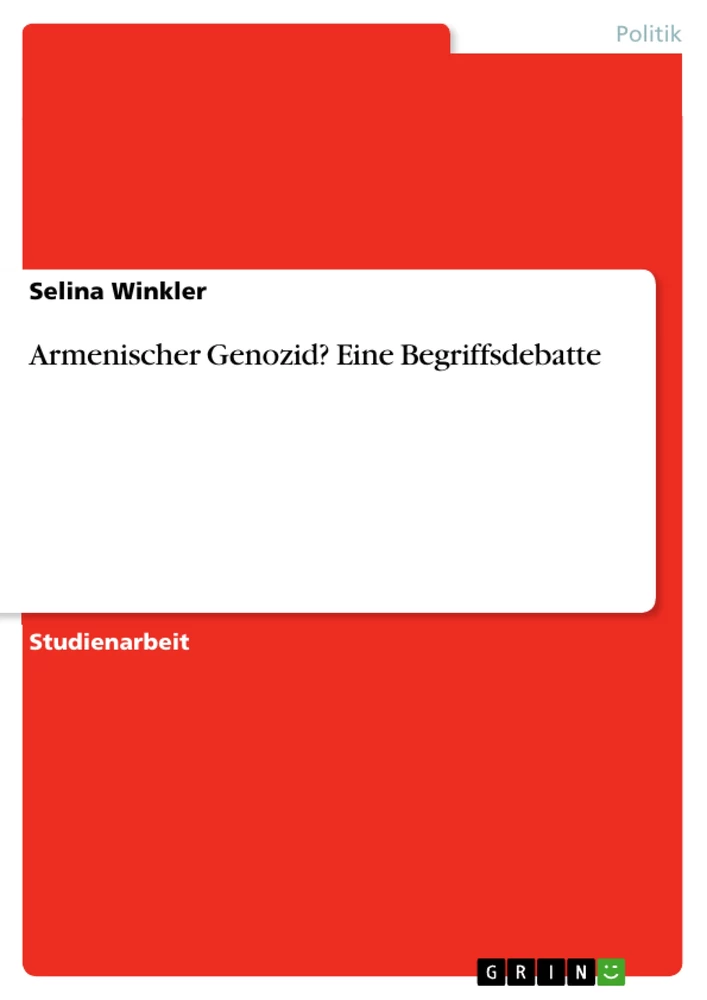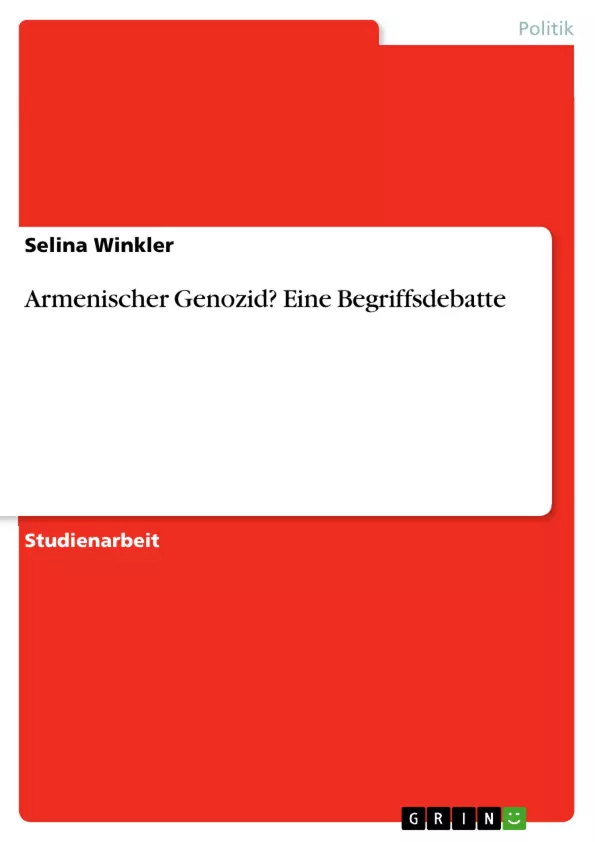Ein Massaker oder die Vernichtung größerer Menschengruppen als Genozid zu bezeichnen, hat nach der Entwicklung des Genozidbegriffs teilweise fast trendartige Ausmaße angenommen und besitzt doch oft nicht die ausreichende Berechtigung. In der vorliegenden Arbeit soll deshalb analysiert werden, ob das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als Genozid eingestuft werden kann oder nicht.
Zu diesem Zweck wird es anfangs um den Genozidbegriff selbst, seine Entwicklung innerhalb der Singularitätsdebatte und verschiedene diesbezügliche Theorien, sowie die UNGC und deren Problematik gehen. Nach einer Darstellung der Begriffsdebatte um den Genozidbegriff wird anhand der Thesen von Rudolph J. Rummel, Boris Barth und Helen Fein ein Analyseraster festgesetzt, welches im zweiten Teil der Arbeit auf besagte Vorfälle im Osmanischen Reich angewandt wird. Nach dieser Diskussion, ob tatsächlich von einem Genozid an den Armeniern gesprochen werden kann, soll abschließend die Bedeutung des Genozidbegriffs in Gegenwart und Zukunft aufgezeigt werden.
Bereits 1933 warf der polnische Jurist Raphael Lemkin auf der fünften internationalen Konferenz zur Vereinheitlichung des Kriminalrechts unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes die Frage auf, „ob die Souveränität eines Staates nicht an ihre Grenzen stoße, wenn eine Regierung beginne, in großem Stil ihre eigenen Bürger zu ermorden.“ Zu jenem Zeitpunkt noch ein rein theoretisches Problem ohne juristische Konsequenzen, prägte Lemkin noch während des Zweiten Weltkrieges den Begriff ludobójstwo, zusammengesetzt aus lud und zabójstwo, den polnischen Wörtern für „Volk“ und „Mord“. 1944 übersetzt er ihn als genocide ins Englische, vom griechischen genos für „Volk“ und dem lateinischen caedere für „töten“, und als Völkermord ins Deutsche. Seine und damit die erste Definition des Genozid-Begriffs lautete „the coordinated and planned destruction of a national, religious, racial or ethnic group by different actions through the destruction of the essential foundations of the life of the group with the aim of annihilating it physically and culturally.“ Obwohl also die Debatte darüber, die Vernichtung derartiger Gruppen als Verbrechen unter internationale Strafe zu stellen, nachweislich vor dem Zweiten Weltkrieg angeregt wurde, bildete sich die Genozidforschung erst als die sogenannten „post-holocaust-studies“ aus der Holocaustforschung heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Die Genese der Genozidforschung
- Der Genozid-Begriff
- Die Genozid-Konvention der Vereinten Nationen und ihre Problematik
- Genozid-Theorien
- Rudolph J. Rummel
- Boris Barth
- Helen Fein
- Angewandtes Analyseraster
- Der Armenische Genozid
- Genozid in Gegenwart und Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Genozidbegriff, seine Entwicklung und Anwendung. Ziel ist es, die Eignung des Begriffs zur Beschreibung historischer Ereignisse zu untersuchen, insbesondere am Beispiel des armenischen Genozids. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Definition und untersucht verschiedene Theorien zur Genozidforschung.
- Entwicklung des Genozidbegriffs und seine Problematik
- Vergleichende Genozidforschung und die Singularitätsdebatte
- Anwendung verschiedener Theorien auf den armenischen Genozid
- Analyse des armenischen Genozids im Kontext des Genozidbegriffs
- Relevanz des Genozidbegriffs für Gegenwart und Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Genese der Genozidforschung: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung der Genozidforschung, beginnend mit Raphael Lemkins frühen Überlegungen zur internationalen Strafbarkeit staatlicher Morde an eigenen Bürgern. Es beleuchtet die Entwicklung der Forschung im Kontext der "post-Holocaust-studies" und die Herausforderungen der vergleichenden Genozidforschung, die durch den Mangel an einheitlichen Definitionen und die anhaltende Singularitätsdebatte erschwert wird. Die Debatte um die Einzigartigkeit des Holocaust und der Versuch, Strukturmerkmale und Gemeinsamkeiten verschiedener genozidaler Ereignisse herauszuarbeiten, werden detailliert dargestellt.
Der Genozid-Begriff: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Genozidbegriff selbst. Es analysiert die Genozidkonvention der Vereinten Nationen und deren Problematik. Es werden verschiedene Theorien von Rudolph J. Rummel, Boris Barth und Helen Fein vorgestellt, welche unterschiedliche Ansätze zur Definition und Analyse von Genoziden bieten. Die Diskussion um die Singularität des Holocaust und die daraus resultierende Herausforderung für die vergleichende Genozidforschung wird ausführlich behandelt, inklusive der Kontroversen um Ernst Noltes Thesen und den Historikerstreit. Das Kapitel legt den Grundstein für die Anwendung eines Analyserasters in den folgenden Kapiteln.
Schlüsselwörter
Genozid, Genozidforschung, Genozidkonvention, Völkermord, Singularitätsdebatte, Holocaust, Armenischer Genozid, Raphael Lemkin, Rudolph J. Rummel, Boris Barth, Helen Fein, vergleichende Genozidforschung, Analyseraster.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Analyse des Genozidbegriffs am Beispiel des Armenischen Genozids
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Genozidbegriff, seine Entwicklung und Anwendung. Sie untersucht insbesondere die Eignung des Begriffs zur Beschreibung historischer Ereignisse, vor allem am Beispiel des armenischen Genozids. Ein Schwerpunkt liegt auf der Problematik der Definition und der Untersuchung verschiedener Theorien zur Genozidforschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Genese der Genozidforschung, den Genozidbegriff (inklusive der Genozidkonvention der Vereinten Nationen und verschiedener Theorien von Rummel, Barth und Fein), den Armenischen Genozid und die Relevanz des Genozidbegriffs für Gegenwart und Zukunft. Die vergleichende Genozidforschung und die Singularitätsdebatte werden ebenfalls ausführlich diskutiert.
Welche Theorien zur Genozidforschung werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Theorien zur Genozidforschung vor, insbesondere die Ansätze von Rudolph J. Rummel, Boris Barth und Helen Fein. Diese Theorien bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Definition und Analyse von Genoziden.
Welche Rolle spielt der Armenische Genozid in dieser Arbeit?
Der Armenische Genozid dient als Fallbeispiel, um die Anwendung des Genozidbegriffs und verschiedener Theorien zu untersuchen. Die Arbeit analysiert den Genozid im Kontext des Begriffs und seiner Problematik.
Wie wird der Genozidbegriff definiert und welche Probleme bestehen?
Die Arbeit analysiert die Genozidkonvention der Vereinten Nationen und deren Problematik. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Anwendung des Begriffs, inklusive der anhaltenden Singularitätsdebatte (insbesondere im Kontext des Holocaust) und der daraus resultierenden Herausforderungen für die vergleichende Genozidforschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Genese der Genozidforschung, zum Genozidbegriff (einschließlich der Darstellung verschiedener Theorien), zum Armenischen Genozid und zum Genozid in Gegenwart und Zukunft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genozid, Genozidforschung, Genozidkonvention, Völkermord, Singularitätsdebatte, Holocaust, Armenischer Genozid, Raphael Lemkin, Rudolph J. Rummel, Boris Barth, Helen Fein, vergleichende Genozidforschung, Analyseraster.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung des Genozidbegriffs zur Beschreibung historischer Ereignisse zu untersuchen und die Problematik seiner Definition und Anwendung zu beleuchten. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze und wendet diese auf den Fall des armenischen Genozids an.
- Citar trabajo
- Selina Winkler (Autor), 2015, Armenischer Genozid? Eine Begriffsdebatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311860