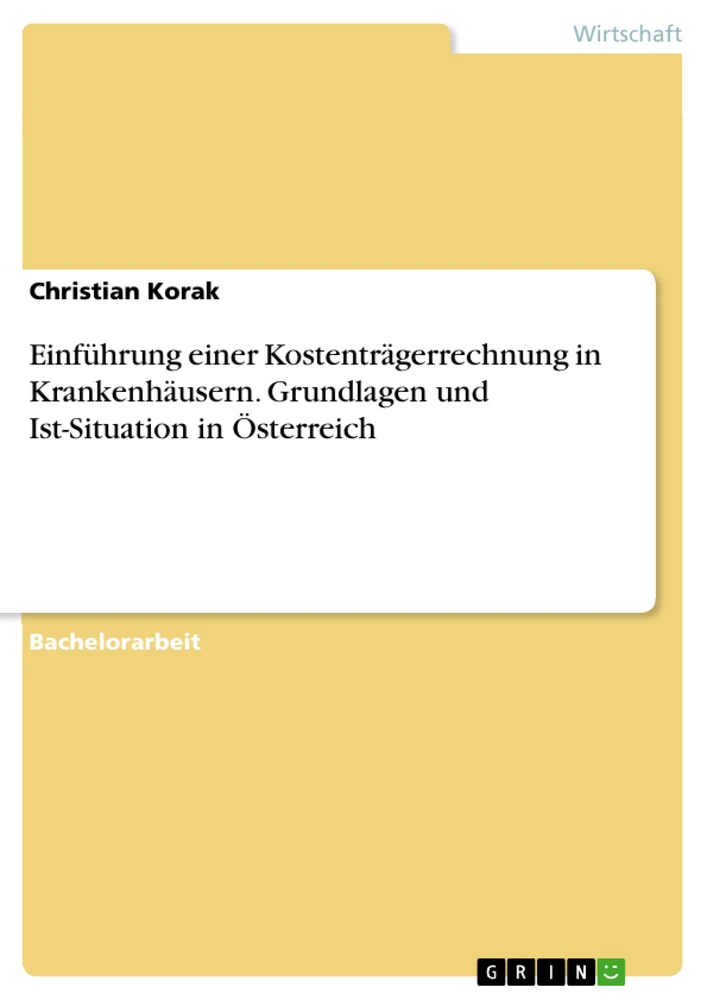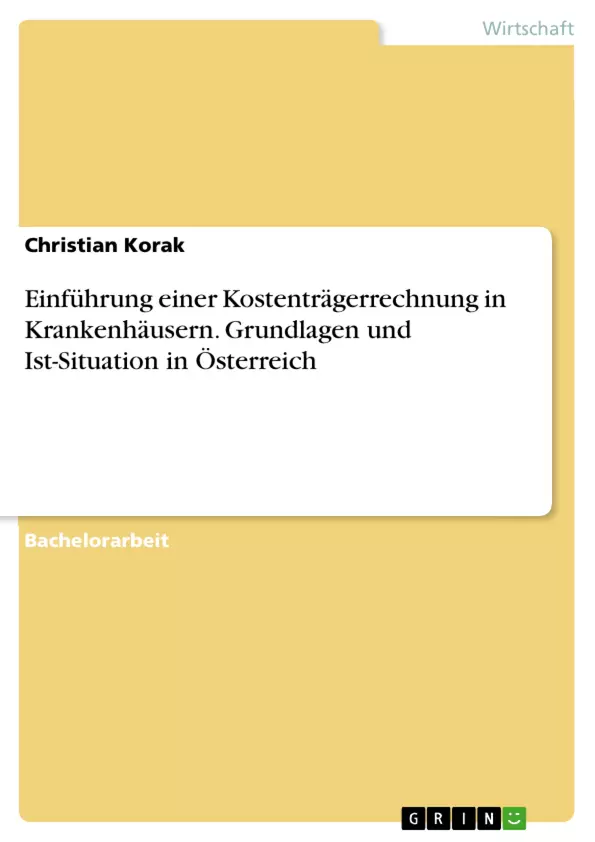Die medizinischen und technischen Fortschritte, sowie die exzellente Ausstattung unserer Krankenhäuser mit medizinischen Geräten ermöglichen es, den Patienten/innen eine immer breitere Palette an Leistungen anzubieten. Jedoch ziehen diese Leistungen, ebenso wie die ständig steigende Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung, immer höhere Kosten nach sich.
Um die steigenden Gesundheitsausgaben einzudämmen wurde 1997 die leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung eingeführt.
Ein Ziel dieser Reform war es, die Krankenhausmanager/innen mit Hilfe fallbezogener Leistungsvergütung zu betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu bewegen, da mit dem neuen Vergütungssystem nicht länger ein fixer Verrechnungssatz pro Aufenthaltstag vergütet wurde. Eine Änderung des Vergütungssystems bringt zwangsläufig auch eine Veränderung der Kosten- und Leistungsrechnung mit sich. Jedoch sieht die Kostenrechnungsverordnung für landesfondsfinanzierte Krankenanstalten bis heute keine verpflichtende Kostenträgerrechnung in Krankenanstalten vor.
Ohne eine solche ist eine Kalkulation der Selbstkosten des Kranken-hauses, für eine durch eine Fallpauschale abgegoltene Leistung, nicht im befriedigenden Ausmaß möglich. Das Gesetz schreibt lediglich eine Kalkulation der Kosten bis zu den einzelnen Kostenstellen vor. Somit ist die Zurechnung dieser Kosten auf einzelne Krankenhausleistungen, die mittels Fallpauschale vergütet wer-den, nicht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Forschungsfrage
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen der Kostenträgerrechnung
- Kostenträgerstückrechnung
- Kostenträgerzeitrechnung
- Rechtliche Grundlagen der Krankenanstalten-kostenrechnung
- Kostenartenrechnung
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung
- Finanzierungssystem und Kostenträgerrechnung in Krankenhäusern
- Die leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung
- Krankenhaus-Kostenträger
- Implementierungshürden,- bzw. -anforderungen bei der Einführung einer Kostenträgerrechnung
- Ist-Situation in ausgewählten Krankenhäusern
- Krankenhaus A
- Krankenhaus B
- Krankenhaus C
- Krankenhaus D
- Krankenhaus E
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Einführung einer Kostenträgerrechnung in Krankenhäusern und analysiert die Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen können. Die Arbeit untersucht dabei die Herausforderungen und Chancen der Einführung einer solchen Rechnung im Kontext der leistungsorientierten Krankenanstalten-Finanzierung.
- Rechtliche Grundlagen der Krankenanstalten-Kostenrechnung
- Kostenträgerrechnung als Instrument zur Kalkulation von Selbstkosten
- Finanzierungssystem und Kostenträgerrechnung in Krankenhäusern
- Implementierungshürden und -anforderungen
- Ist-Situation in ausgewählten Krankenhäusern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit vor und erläutert den aktuellen Kontext der Kostenrechnung in Krankenhäusern. Kapitel 2 bietet eine Einführung in die Grundlagen der Kostenträgerrechnung, inklusive der Kostenträgerstückrechnung und der Kostenträgerzeitrechnung. Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Krankenanstalten-Kostenrechnung, wobei die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung näher betrachtet werden. Kapitel 4 analysiert das Finanzierungssystem und die Kostenträgerrechnung in Krankenhäusern, insbesondere die leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung und die verschiedenen Krankenhaus-Kostenträger. Es werden auch die Implementierungshürden und -anforderungen bei der Einführung einer Kostenträgerrechnung diskutiert. Kapitel 5 analysiert die Ist-Situation in ausgewählten Krankenhäusern, um den aktuellen Stand der Kostenrechnung und der Kostenträgerrechnung darzustellen.
Schlüsselwörter
Kostenträgerrechnung, Krankenhäuser, Kostenrechnung, Leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung, Krankenhaus-Kostenträger, Implementierungshürden, Ist-Situation
- Citation du texte
- Christian Korak (Auteur), 2015, Einführung einer Kostenträgerrechnung in Krankenhäusern. Grundlagen und Ist-Situation in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312027