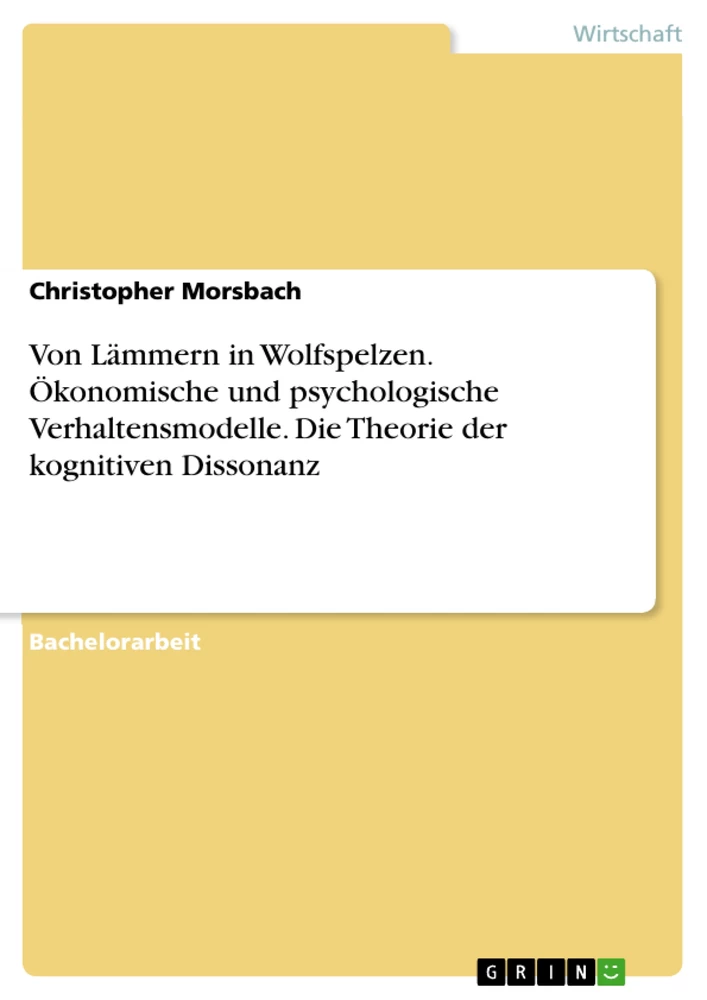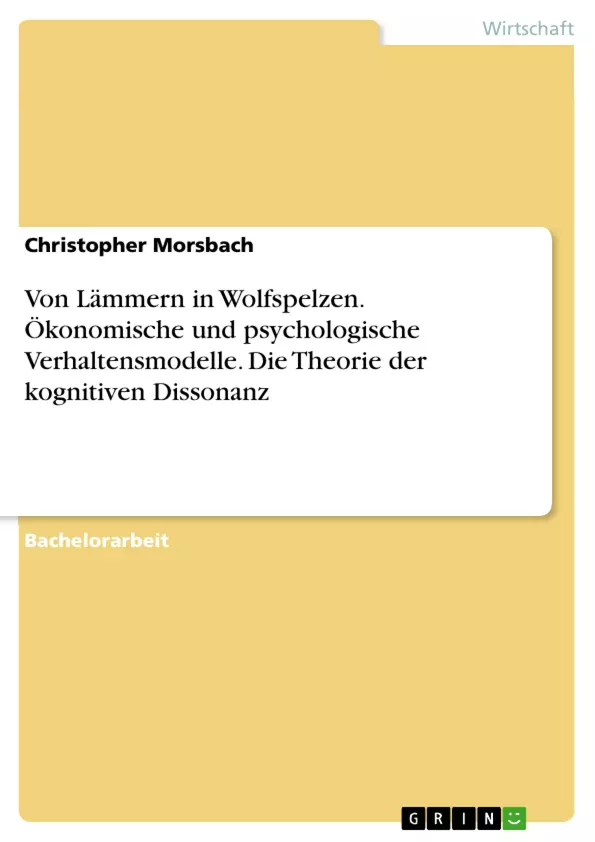„Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe“ (Reschke, 2010). Als der erfolgreiche Fußballtrainer Christoph Daum im Oktober 2000 auf einer Pressekonferenz diesen Satz prägte, galt er als designierter Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft. Anlass für die Aussage bot die Entnahme einer Haarprobe im Zusammenhang mit einer freiwilligen Drogenanalyse, die den Beweis von Daums Unschuld erbringen sollte. Zuvor war er verdächtigt worden, Kokain konsumiert zu haben. Zehn Tage nach besagter Pressekonferenz wurden die Ergebnisse der Haarprobe veröffentlicht und der Verdacht des Drogenmissbrauchs unzweifelhaft bestätigt. Eine prestigeträchtige Karriere als deutscher Bundestrainer war beendet, bevor sie begonnen hatte und Daum sah sich aufgrund des öffentlichen Drucks gezwungen, Deutschland in Richtung Florida zu verlassen (Reschke, 2010). Wie ist solches, scheinbar widersinniges, Verhalten erklärbar?
Ökonomische Verhaltensmodelle tun sich schwer mit einer Interpretation des Handelns von Christoph Daum. Dessen Verhalten in Einklang bringen zu wollen mit dem eines rationalen und anreizorientierten Entscheiders (Diekmann, Eichner, Schmidt, & Voss, 2013), erscheint kaum möglich. Vorstellbar wäre dahingegen, dass Daum in Anbetracht eines sicheren Verlustes seiner Reputation bereit war, ein sehr großes Risiko einzugehen. Die Neue Erwartungstheorie (Prospect Theory), die ökonomische mit psychologischen Theorieelementen verbindet, könnte in diesem Fall dem Verständnis auf die Sprünge helfen (Kahneman & Tversky, 1979). Eine Möglichkeit Daums Verhalten aus der Perspektive psychologischer Motivationstheorie zu verstehen, bietet das Bedürfnis nach Anerkennung und Achtung (Maslow, 1970). Die negative Berichterstattung zu seiner Person könnte sonach einen Mangel dieses Bedürfnisses hervorgerufen und ihn zu dem Drogentest bewogen haben. Außerdem sollte die subjektive Sichtweise Daums, die maßgeblich bestimmt wird durch die Gegebenheiten der sozialen Umwelt, bei einer Verhaltensanalyse nicht vernachlässigt werden (Lewin, 1963). Diese subjektive Wirklichkeit zugrunde legend, kann insbesondere unter Einbezug der Theorie der kognitiven Dissonanz eine plausible Begründung für sein Verhalten gefunden werden. Im April 2013 legte Daum in einem Interview mit der überregionalen Tageszeitung „Die Welt“ dar, wie der Drogenkonsum und die damit verbundenen Lügen seinen innersten Überzeugungen zutiefst widersprochen haben (Gartenschläger, 2013)...
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Von Lämmern in Wolfspelzen – Ein einführendes Beispiel
- Disziplinäre Modelle des Verhaltens
- Ökonomische Theorieansätze
- Psychologische Theorieansätze
- Die Theorie der kognitiven Dissonanz
- Diskussion verschiedener Studienergebnisse
- Das „Hoeneß-Dilemma“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das menschliche Verhalten anhand ökonomischer und psychologischer Verhaltensmodelle. Ein Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Relevanz psychologischer Konzepte zur Erklärung menschlichen Handelns, insbesondere der Theorie der kognitiven Dissonanz. Ein weiteres Ziel ist es, mit dem optimalen Denkansatz scheinbar irrationale Verhaltensweisen zu erklären. Die Arbeit verwendet sowohl theoretische Annahmen als auch empirische Studien und bezieht aktuelles Zeitgeschehen mit ein.
- Ökonomische Verhaltensmodelle im Vergleich zu psychologischen Modellen
- Relevanz der Theorie der kognitiven Dissonanz für die Verhaltensforschung
- Erklärung scheinbar irrationalen Verhaltens mittels des optimalen Denkansatzes
- Interdisziplinäre Herangehensweise an die Verhaltensanalyse
- Anwendung der Theorie auf reale Fälle (z.B. Christoph Daum)
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Arbeit diskutiert Untersuchungsbefunde im Kontext zweier Zielsetzungen: die Überprüfung psychologischer Modelle auf ihre Relevanz für die Erklärung menschlichen Verhaltens und die Generierung von Erklärungen für scheinbar irrationale Verhaltensweisen mittels des optimalen Denkansatzes. Es wird eine interdisziplinäre Herangehensweise befürwortet, mit besonderem Augenmerk auf die Theorie der kognitiven Dissonanz. Empirische Studien und aktuelles Zeitgeschehen werden zur Erörterung herangezogen.
Von Lämmern in Wolfspelzen – Ein einführendes Beispiel: Dieses Kapitel verwendet den Fall Christoph Daum als Beispiel für scheinbar widersprüchliches Verhalten. Es wird gezeigt, wie ökonomische Modelle Schwierigkeiten haben, dieses Verhalten zu erklären, während psychologische Ansätze, insbesondere die Theorie der kognitiven Dissonanz, eine plausible Erklärung bieten. Daums Verhalten wird im Kontext von Reputation, Risikobereitschaft und dem Bedürfnis nach Anerkennung analysiert.
Disziplinäre Modelle des Verhaltens: Dieser Abschnitt präsentiert ökonomische und psychologische Theorieansätze. Im ökonomischen Teil wird der "Homo oeconomicus" als Modell des rationalen Akteurs vorgestellt und dessen Limitationen diskutiert. Die psychologischen Ansätze werden allgemein eingeführt und bilden die Grundlage für die spätere Diskussion der kognitiven Dissonanz.
Die Theorie der kognitiven Dissonanz: Dieses Kapitel erklärt die Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger (1957). Es beschreibt, wie widersprüchliche Wahrnehmungen, Einstellungen und Handlungen zu Unbehagen führen und wie Individuen dieses Unbehagen reduzieren, indem sie ihr Verhalten oder ihre Wahrnehmung ändern. Die Relevanz dieser Theorie für die Erklärung des Verhaltens von Christoph Daum wird hervorgehoben.
Diskussion verschiedener Studienergebnisse: Dieser Abschnitt analysiert verschiedene empirische Studien, die im Kontext der vorgestellten Theorien diskutiert werden. Die Ergebnisse dieser Studien werden verwendet, um die theoretischen Konzepte zu belegen und zu vertiefen. Der Fokus liegt auf komplexen Verhaltensweisen.
Das „Hoeneß-Dilemma“: Das Kapitel verknüpft die theoretischen und empirischen Erkenntnisse und analysiert den Fall Uli Hoeneß. Dieses Kapitel wird jedoch nicht zusammengefasst, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Theorie der kognitiven Dissonanz, ökonomische Verhaltensmodelle, psychologische Verhaltensmodelle, Homo oeconomicus, rationale Entscheidung, irrationale Entscheidungen, interdisziplinäre Forschung, Verhaltensökonomie, sozialpsychologie, Reputation, Risikobereitschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse menschlichen Verhaltens anhand ökonomischer und psychologischer Modelle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das menschliche Verhalten anhand ökonomischer und psychologischer Verhaltensmodelle. Ein Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Relevanz psychologischer Konzepte, insbesondere der Theorie der kognitiven Dissonanz, zur Erklärung menschlichen Handelns. Ein weiteres Ziel ist die Erklärung scheinbar irrationalen Verhaltens mittels des optimalen Denkansatzes. Die Arbeit kombiniert theoretische Annahmen mit empirischen Studien und bezieht aktuelles Zeitgeschehen ein.
Welche Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht ökonomische Verhaltensmodelle (z.B. den "Homo oeconomicus") mit psychologischen Modellen. Die Limitationen des ökonomischen Modells werden diskutiert, und psychologische Ansätze werden als Grundlage für die Erklärung komplexen Verhaltens eingeführt.
Welche Rolle spielt die Theorie der kognitiven Dissonanz?
Die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (1957) spielt eine zentrale Rolle. Sie erklärt, wie widersprüchliche Wahrnehmungen, Einstellungen und Handlungen zu Unbehagen führen und wie Individuen dieses Unbehagen reduzieren. Die Relevanz dieser Theorie wird anhand von Fallbeispielen (z.B. Christoph Daum) untersucht.
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die Fälle von Christoph Daum und Uli Hoeneß als Beispiele für scheinbar widersprüchliches oder irrationales Verhalten. Daums Fall wird im einführenden Kapitel verwendet, um die Schwierigkeiten ökonomischer Modelle bei der Erklärung solchen Verhaltens zu verdeutlichen und die Relevanz psychologischer Ansätze aufzuzeigen. Der Fall Hoeneß wird im letzten Kapitel behandelt, wobei die Zusammenfassung aus Spoiler-Gründen ausgelassen wird.
Welche empirischen Studien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht verschiedene empirische Studien ein, um die theoretischen Konzepte zu belegen und zu vertiefen. Der Fokus liegt auf der Analyse komplexen Verhaltens im Kontext der vorgestellten Theorien.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der ökonomische und psychologische Perspektiven kombiniert. Sie verwendet sowohl theoretische Annahmen als auch empirische Befunde, um zu einem umfassenderen Verständnis menschlichen Verhaltens zu gelangen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Theorie der kognitiven Dissonanz, ökonomische Verhaltensmodelle, psychologische Verhaltensmodelle, Homo oeconomicus, rationale Entscheidung, irrationale Entscheidungen, interdisziplinäre Forschung, Verhaltensökonomie, Sozialpsychologie, Reputation, Risikobereitschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Zusammenfassung, ein einführendes Beispiel (Christoph Daum), disziplinäre Modelle des Verhaltens (ökonomisch und psychologisch), die Theorie der kognitiven Dissonanz, Diskussion verschiedener Studienergebnisse, und das "Hoeneß-Dilemma".
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, menschliches Verhalten anhand ökonomischer und psychologischer Modelle zu untersuchen, die Relevanz psychologischer Konzepte zu überprüfen und scheinbar irrationale Verhaltensweisen mittels des optimalen Denkansatzes zu erklären.
- Arbeit zitieren
- Christopher Morsbach (Autor:in), 2013, Von Lämmern in Wolfspelzen. Ökonomische und psychologische Verhaltensmodelle. Die Theorie der kognitiven Dissonanz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312072