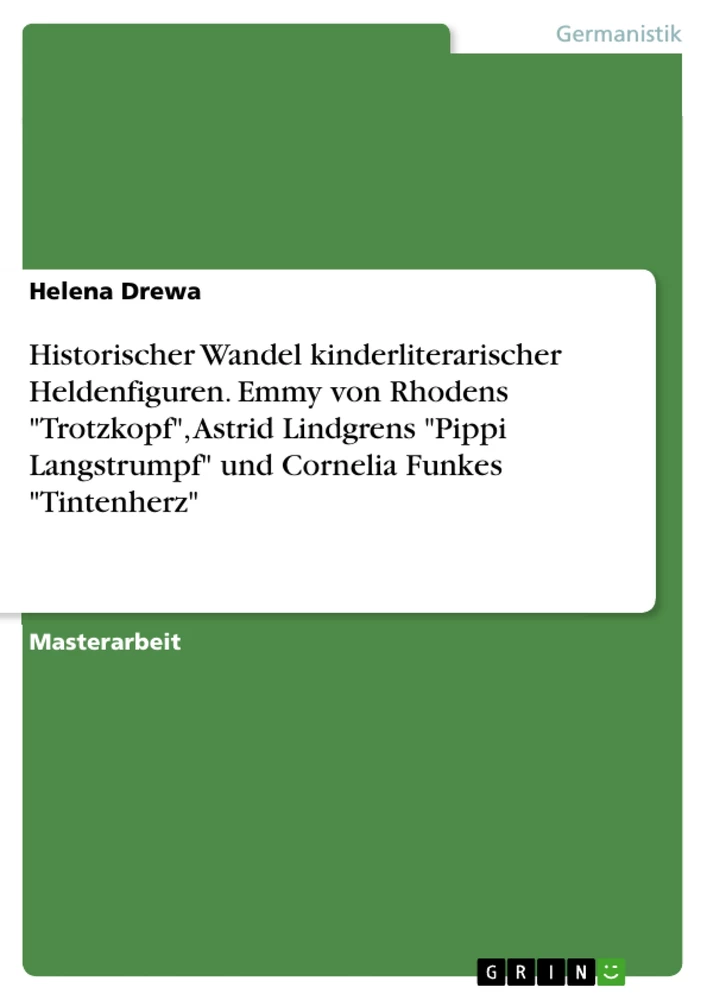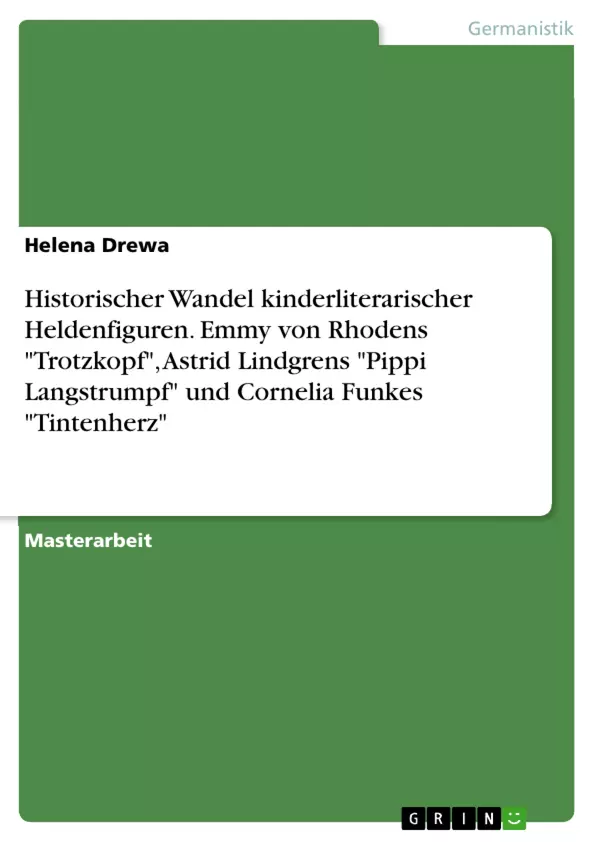Wenn MÜNKLER für die derzeitige postheroische Gesellschaft feststellt, „Früher [seien] die Helden heldenhafter, die Kämpfe gewaltiger und die Siege größer“ gewesen, stellen sich die Fragen, was machte diese Helden heldenhafter und was macht eine literarische Figur oder einen Menschen überhaupt erst zum Helden. Die nachfolgende Untersuchung von Heldenbildern zeigt, dass eine universelle Typisierung der Heldenfigur nur schwer möglich ist, da es sich bei dieser um ein kulturelles Konstrukt handelt. Die Vorstellung von dem Heroischen einer Figur, ändert sich in Abhängigkeit vom Kultur- und Zeitraum, sodass das Erscheinungsbild des Helden einen großen Variationsreichtum aufweist. Dennoch kann als universales Eigenschaft literarischer Darstellungen herausgestellt werden, dass sich in Heldenbildern „die Ambivalenz von Stärke und Schwäche, Größe und Kleinheit, von Allmacht und Ohnmacht, […] widerspiegelt und von ihnen transportiert wird.“ Darin liegt auch die zentrale Bedeutung von Helden für die Sozialisation von Kindern begründet. Als „nicht-angeleitete Orientierung“ unterstützen Heldenbilder die Identitätsbildung des Kindes, das lernt sowohl eigene Schwächen zu akzeptieren also auch die Potentiale seines Handelns zu erkennen. Zudem decken sie Missstände einer Gesellschaft auf und machen Veränderungspotential sichtbar.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszustellen welche Eigenschaften den literarischen Kinderhelden auszeichnen und wie sich Heldenbilder in der Zeit zwischen dem späten 19. und dem frühen 21. Jahrhundert verändert haben. Hierzu sollen die Heldenfiguren der Werke Trotzkopf (Emmy von Rhoden), Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren) und Tintenherz (Cornelia Funke) untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- ZUM BEGRIFF DES HELDEN
- VOM HELDEN UND HELDISCHEN - DER VERSUCH EINER TYPOLOGISIERUNG
- DER HELD ALS TRANSZENDENZENTWURF UNSERES SELBST - ZUR WIRKUNG UND FUNKTION DER HELDENFIGUR
- DER DICHTER UND SEIN HELD - LITERARISCHE FIGURATIONEN DES HEROISCHEN
- ANALYSE DER HELDENFIGUREN
- DER TROTZKOPF
- REZEPTIONSHISTORISCHER HINTERGRUND
- FIGURENANALYSE ZUM TROTZKOPF
- Vom Wildfang zum kleinen, zahmen Vogel - Zur Natürlichkeit als kennzeichnendes Merkmal der Ilse Macket
- Der Held und seine übernatürlichen Helfer – Zur Überwindung des Trotzes und der Rolle von Nellie Grey und Fräulein Güssow
- Alter Trotzkopf: Naturkind und kulturelles Produkt – Zur Gestaltung des Exzeptionellen
- FAZIT DER FIGURENANALYSE ZU DER TROTZKOPF
- PIPPI LANGSTRUMPF
- REZEPTIONSHISTORISCHER HINTERGRUND
- FIGURENANALYSE ZU PIPPI LANGSTRUMPF
- Ein kleiner Übermensch in kindlicher Gestalt - Zur Gestaltung des Exzeptionellen
- Macht [über] die Welt, wie sie ihr gefällt - Zur Konstruktion von Machtverhältnissen
- Ein merkwürdiges Kind - Zum Aspekt des Außenseiter als Grenzgänger
- FAZIT DER FIGURENANALYSE ZU PIPPI LANGSTRUMPF
- TINTENHERZ
- REZEPTIONSHISTORISCHER HINTERGRUND
- FIGURENANALYSE ZUM TINTENHERZ
- ,,Es liegt also in der Familie\" - Zur Gestaltung und Funktion der Familie als Aktionsraum des Helden
- Kinder sind die besseren Erzieher
- FAZIT DER FIGURENANALYSE ZU TINTENHERZ
- DER TROTZKOPF
- VERGLEICHENDE SCHLUSSBETRACHTUNG DER KINDERLITERARISCHEN HELDENFIGUREN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung von Kinderheldenfiguren im Wandel der Zeit. Anhand von drei Beispielen - Emmy von Rhodens Trotzkopf, Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf und Cornelia Funkes Tintenherz - wird die Konstruktion junger Heldinnen beleuchtet. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die charakteristischen Eigenschaften dieser Heldinnen herauszustellen und die Veränderungen in Heldenbildern zwischen dem späten 19. und dem frühen 21. Jahrhundert zu analysieren.
- Entwicklung von Kinderheldenfiguren im Laufe der Zeit
- Konstruktion von Heldinnenfiguren in der Kinderliteratur
- Eigenschaften und Funktionen von Heldinnenfiguren
- Veränderung von Heldenbildern im Kontext der jeweiligen Zeit
- Rezeption historischer und zeitgenössischer Heldenfiguren
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Anschließend wird in einem theoretischen Teil der Begriff des Helden beleuchtet und es wird ein Überblick über verschiedene Typologisierungen des Heroischen gegeben.
Der Analyseteil befasst sich mit den drei ausgewählten Heldinnenfiguren. Für jede Figur wird zunächst der rezeptionshistorische Hintergrund beleuchtet, um die Entstehung und Rezeption der Figuren im Kontext der jeweiligen Zeit zu verstehen. Anschließend erfolgt eine Figurenanalyse, die das charakteristische Verhalten, die Beziehungen zu anderen Figuren und den Neuheitswert im Vergleich zu etablierten Heldenbildern untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kinderliteratur, Heldenfiguren, Heldenbild, Kinderhelden, Figurenanalyse, Rezeption, Wandel, Typisierung, Zeitgeschichte, Geschlechterrollen, Kulturgeschichte, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Bild des Kinderhelden seit dem 19. Jahrhundert gewandelt?
Das Heldenbild wandelte sich von der Disziplinierung (Trotzkopf) über die Autonomie und Kraft (Pippi Langstrumpf) hin zu komplexen Identitätsentwürfen in modernen Fantasiewelten (Tintenherz).
Was versteht man unter dem Helden als kulturelles Konstrukt?
Ein Held ist kein feststehender Typus, sondern seine Eigenschaften und seine Bedeutung ändern sich je nach Kulturkreis und historischem Zeitraum.
Welche Rolle spielen Helden für die Sozialisation von Kindern?
Helden dienen als Orientierungshilfe bei der Identitätsbildung. Kinder lernen durch sie, eigene Schwächen zu akzeptieren und Potenziale ihres Handelns zu erkennen.
Welche Werke werden in der Untersuchung analysiert?
Analysiert werden Emmy von Rhodens „Trotzkopf“, Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ und Cornelia Funkes „Tintenherz“.
Was kennzeichnet die Figur der Ilse Macket im „Trotzkopf“?
Die Figur wandelt sich vom „Wildfang“ zum „zahmen Vogel“, was die Erziehungsideale des späten 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
Warum wird Pippi Langstrumpf als „kleiner Übermensch“ bezeichnet?
Pippi Langstrumpf bricht mit konventionellen Machtverhältnissen und agiert als exzeptionelle Figur, die sich die Welt nach ihren eigenen Regeln gestaltet.
- Quote paper
- Helena Drewa (Author), 2015, Historischer Wandel kinderliterarischer Heldenfiguren. Emmy von Rhodens "Trotzkopf", Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" und Cornelia Funkes "Tintenherz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312118