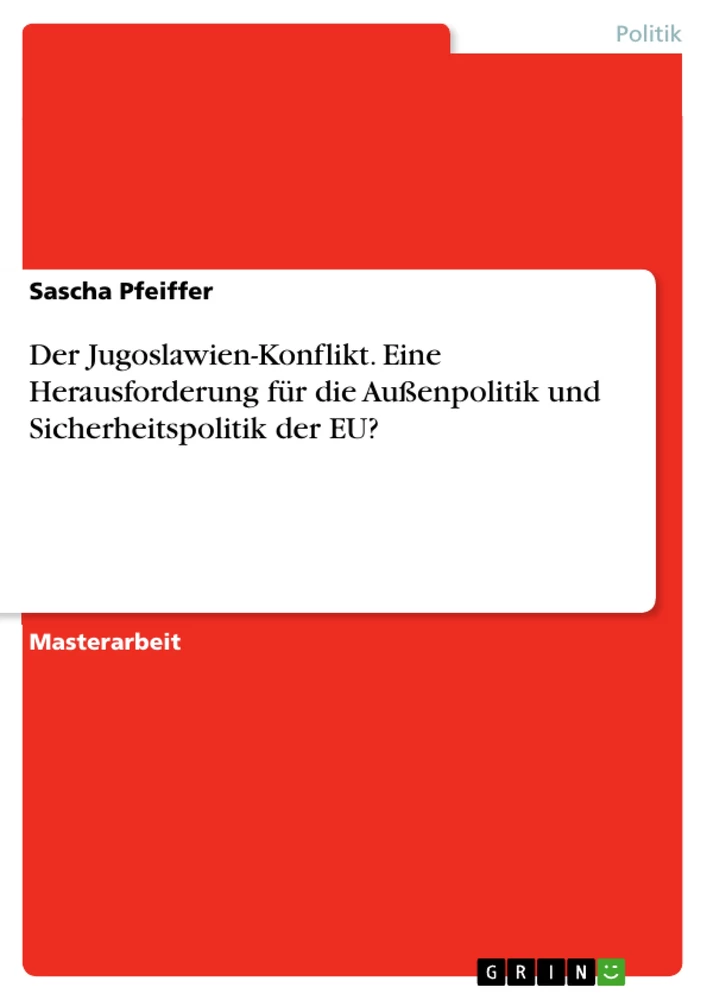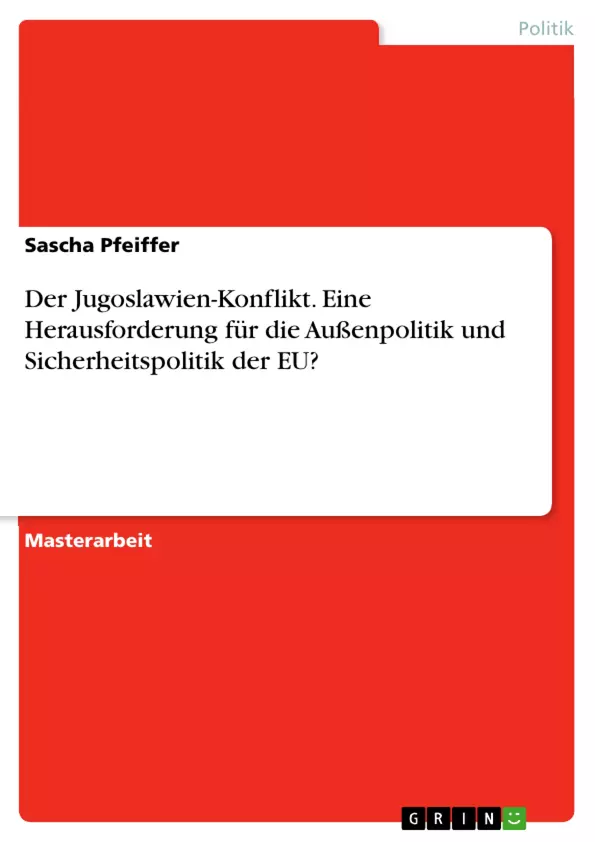"Europa sollte nie wieder ein "Srebrenica" auf seinem Gewissen haben. Den Hasstürmen, die dort im Juli 1995 ihre bittere Ernte einfuhren, hätte man Einhalt gebieten können, wenn wir als ihre Nachbarn die Fähigkeit und die Entschlossenheit zum Handeln gehabt hätten. Dies müssen wir beides finden."
Diese Äußerung von Pat Cox, dem Karlspreisträger von 2004, zeigt deutlich, in welchem Dilemma Europa auch noch knapp 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges steckte und auch noch heute steckt. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa kam die Erkenntnis, dass es nie wieder zu einer solchen Katastrophe auf dem europäischen Kontinent kommen sollte. Die ehemaligen "Erbfeinde" Frankreich und Deutschland beschlossen im Bereich der Montanunion, der EGKS und EWG immer stärker zu kooperieren um gegenseitiges Misstrauen abzubauen und dadurch Vertrauen für zukünftige Kooperation und Integration zu schaffen.
Aus diesen ersten frühen Institutionen ist schließlich die Europäische Union hervor gegangen. Die zunehmende Integration und Verflechtung zwischen den Staaten der EU führte zu einem immer größer werdenden Wohlstand und dem Glauben, dass Europa die Geisel des Krieges für alle Zeit überwunden habe. Doch im Schatten des westlichen Wohlstandes, tat sich auf dem Balkan, direkt wenn man so will auf der Türschwelle zu Europa ein Konflikt auf, welcher die Handlungsunfähigkeit der EU bei solchen Krisen zeigte. Dabei reichen die Wurzeln dieses Konflikts bis weit vor den Ersten Weltkrieg zurück.
Die Idee zur Bearbeitung dieses Themas kam dem Autor im Rahmen einer neuen Welle von Gewalt im Kosovo Anfang des Jahres und mit Blick auf den Beitritt Kroatiens zur EU. Da die Geschichte und Politik Südosteuropas im Rahmen des gewählten Studiengangs nicht ausreichend tiefgehend betrachtet werden konnte, lag die Wahl des Themas naheliegend.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsbericht
- 3. Friedens- und Konfliktforschung
- 4. Historische Entwicklung auf dem Balkan bis 1989
- 5. Die jugoslawischen Zerfallskriege
- 5.1. Der serbisch-kroatische Konflikt
- 5.2. Der Konflikt in Bosnien-Herzegowina
- 5.3. Der Konflikt im Konflikt
- 5.4. Internationalisierung und Ende des Bosnienkrieges
- 5.5. Srebrenica
- 5.6. Der Kosovokrieg
- 6. Von Dünkirchen bis zur Westeuropäischen Union
- 6.1. Der Dünkirchen Vertrag und die Gründung der NATO
- 6.2. Die Westeuropäische Union
- 6.3. Reaktivierung der Westeuropäischen Union
- 6.4. Von den EVG-Verträgen bis zur GSVP
- 7. Entstehung und Wandel der NATO
- 7.1. Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gründung 1949
- 7.2. Innere Spannung mit Frankreich
- 7.3. Restrukturierung und Politik bis zur Gegenwart
- 8. Zwischen institutionelle Beziehungen zwischen EU - WEU und NATO
- 9. Wandel der Außenpolitik der EU in Folge der Balkankriege
- 10. Fazit
- 11. Abkürzungsverzeichnis
- 12. Quellen und Webressourcen
- 13. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Jugoslawienkonflikt und seine Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Die Arbeit analysiert die Handlungsunfähigkeit der EU während der Balkankriege und beleuchtet die historischen, politischen und institutionellen Faktoren, die dazu beigetragen haben. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen zu verstehen, denen sich die EU in diesem Kontext gegenüber sah.
- Historische Entwicklung des Balkans und die Ursachen des Jugoslawienkonflikts
- Analyse der jugoslawischen Zerfallskriege und ihrer einzelnen Phasen
- Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (EU und NATO)
- Wandel der EU-Außenpolitik als Reaktion auf die Balkankriege
- Bewertung der Frage, ob die Balkankriege zu einer vertieften Integration der EU-Außenpolitik geführt haben.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Pat Cox, das die Handlungsunfähigkeit Europas während des Srebrenica-Massakers hervorhebt. Sie skizziert den historischen Kontext, der vom Ende des Zweiten Weltkriegs und der zunehmenden europäischen Integration bis zum Jugoslawienkonflikt reicht. Der Autor erläutert seine Motivation für die Wahl des Themas und betont die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der historischen Entwicklung des Balkans, um den Konflikt in seiner Komplexität zu verstehen. Die Arbeit wird in drei thematische Blöcke gegliedert: die historische Entwicklung des Balkans und die jugoslawischen Zerfallskriege, die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und schließlich die Veränderungen der EU-Außenpolitik als Folge der Konflikte.
2. Forschungsbericht: Dieser Abschnitt beschreibt die Herausforderungen bei der Bearbeitung des Themas. Die geographische Lage des Balkans und die Vielzahl beteiligter Akteure mit unterschiedlichen Interessen erschweren die Analyse. Die Arbeit muss den Konflikt im Kontext des Ost-West-Konflikts (bis 1989) und im Kontext der internationalen Beziehungen und der Bündnisstrukturen (danach) betrachten. Die Analyse der Balkankriege als Herausforderung für die EU-Außenpolitik erfordert die detaillierte Untersuchung der jugoslawischen Zerfallskriege und die Entstehung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik (WEU bis ESVP). Die Komplexität der Verflechtungen zwischen historischen Gegebenheiten, NATO-EU-Beziehungen und aktueller Lage wird betont. Die begrenzte Verfügbarkeit von Primärquellen aufgrund von Sperrfristen wird thematisiert.
4. Historische Entwicklung auf dem Balkan bis 1989: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste den historischen Kontext des Balkans bis 1989 liefern, einschliesslich der relevanten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die zum Jugoslawienkonflikt führten. Es sollte die Vorgeschichte des Konflikts beleuchten, wichtige Akteure benennen und die bestehenden Spannungen aufzeigen, die zum Zerfall Jugoslawiens beitrugen. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die Bedeutung dieses Abschnitts für das Verständnis des späteren Konflikts hervorheben.)
5. Die jugoslawischen Zerfallskriege: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste die verschiedenen Kriege innerhalb des Zerfalls Jugoslawiens behandeln. Es sollte die wichtigsten Akteure, ihre Ziele und die Dynamiken der einzelnen Konflikte beschreiben. Die Rolle internationaler Akteure sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die verschiedenen Konflikte als Teile eines grösseren, komplexen Prozesses darstellen. Beispiele für wichtige Ereignisse und deren Bedeutung wären sinnvoll.)
6. Von Dünkirchen bis zur Westeuropäischen Union: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik von Dünkirchen bis zur WEU nachzeichnen. Es sollte die wichtigsten Meilensteine und ihre Bedeutung für die spätere Reaktion der EU auf den Jugoslawienkonflikt erläutern. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die institutionellen Rahmenbedingungen und ihre Entwicklung im Detail behandeln.)
7. Entstehung und Wandel der NATO: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste die Geschichte der NATO von ihrer Gründung bis zur Zeit der Balkankriege beschreiben. Es sollte die Rolle der NATO bei der Reaktion auf den Konflikt und die Beziehungen zwischen der NATO und der EU während dieser Zeit thematisieren. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die Bedeutung der NATO für das Verständnis der europäischen Sicherheitsarchitektur hervorheben.)
8. Zwischen institutionelle Beziehungen zwischen EU - WEU und NATO: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste die komplexen Beziehungen zwischen der EU, der WEU und der NATO während der Balkankriege beschreiben und analysieren. Es sollte die Herausforderungen und Chancen dieser Dreiecksbeziehung im Detail darstellen. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die Bedeutung der interinstitutionellen Beziehungen für die EU-Reaktion auf den Konflikt betonen.)
9. Wandel der Außenpolitik der EU in Folge der Balkankriege: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels müsste die Veränderungen in der EU-Außenpolitik als Reaktion auf die Balkankriege analysieren. Es sollte die Lehren aus dem Konflikt und ihre Auswirkungen auf die zukünftige EU-Außenpolitik untersuchen. Die Zusammenfassung sollte mindestens 75 Wörter lang sein und die langfristigen Folgen für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik darlegen.)
Schlüsselwörter
Jugoslawienkonflikt, Balkankriege, EU-Außenpolitik, EU-Sicherheitspolitik, NATO, Westeuropäische Union (WEU), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Friedens- und Konfliktforschung, historische Entwicklung des Balkans, Srebrenica, Kosovokrieg, Internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Der Jugoslawienkonflikt und seine Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Jugoslawienkonflikt und seine Auswirkungen auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Sie analysiert die Handlungsunfähigkeit der EU während der Balkankriege und beleuchtet die historischen, politischen und institutionellen Faktoren, die dazu beigetragen haben. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Herausforderungen, denen sich die EU in diesem Kontext gegenüber sah.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Balkans und die Ursachen des Jugoslawienkonflikts, analysiert die jugoslawischen Zerfallskriege und ihre einzelnen Phasen, untersucht die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (EU und NATO), analysiert den Wandel der EU-Außenpolitik als Reaktion auf die Balkankriege und bewertet, ob die Balkankriege zu einer vertieften Integration der EU-Außenpolitik geführt haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die den historischen Kontext und die Forschungsmotivation darstellt; einen Forschungsbericht, der die methodischen Herausforderungen der Arbeit beschreibt; ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Balkans bis 1989; ein Kapitel zu den jugoslawischen Zerfallskriegen mit detaillierten Analysen der einzelnen Konflikte (serbisch-kroatischer Konflikt, Bosnien-Krieg, Kosovokrieg etc.); Kapitel zur Entwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur (Dünkirchen-Vertrag, NATO, WEU, ESVP); Kapitel zu den institutionellen Beziehungen zwischen EU, WEU und NATO; ein Kapitel zum Wandel der EU-Außenpolitik als Folge der Balkankriege; ein Fazit; sowie ein Abkürzungsverzeichnis, Quellenangaben und eine Bibliographie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugoslawienkonflikt, Balkankriege, EU-Außenpolitik, EU-Sicherheitspolitik, NATO, Westeuropäische Union (WEU), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Friedens- und Konfliktforschung, historische Entwicklung des Balkans, Srebrenica, Kosovokrieg, Internationale Beziehungen.
Welche Herausforderungen wurden bei der Bearbeitung des Themas identifiziert?
Die geographische Lage des Balkans und die Vielzahl beteiligter Akteure mit unterschiedlichen Interessen erschwerten die Analyse. Die Arbeit musste den Konflikt im Kontext des Ost-West-Konflikts (bis 1989) und im Kontext der internationalen Beziehungen und der Bündnisstrukturen (danach) betrachten. Die begrenzte Verfügbarkeit von Primärquellen aufgrund von Sperrfristen stellte eine weitere Herausforderung dar.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Diese Frage kann erst nach Lektüre des vollständigen Textes beantwortet werden. Das Fazit des Kapitels 10 wird die Schlussfolgerungen der Arbeit enthalten.)
Wo finde ich die vollständigen Kapitelzusammenfassungen?
Die vollständigen Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel befinden sich im bereitgestellten HTML-Dokument.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Sascha Pfeiffer (Autor:in), 2014, Der Jugoslawien-Konflikt. Eine Herausforderung für die Außenpolitik und Sicherheitspolitik der EU?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312328