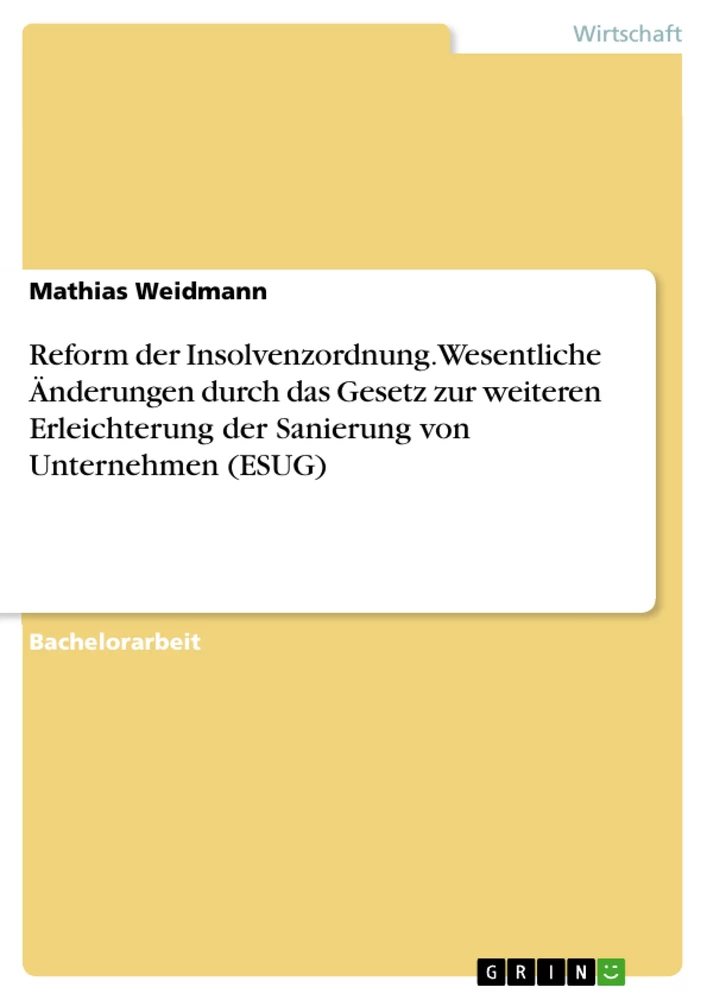In Fachkreisen wurde die Insolvenzordnung (InsO) in ihrer alten Fassung seit langem kritisiert. Bemängelt wurde insbesondere, dass der Ablauf des deutschen Insolvenzverfahrens nicht berechenbar sei und dass kaum eine Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Auswahl des Insolvenzverwalters genommen werden könne. Generell sei die InsO eher auf die Abwicklung statt auf die Sanierung von Unternehmen ausgerichtet und würde der frühzeitigen Sanierung insolvenzbedrohter Unternehmen zahlreiche Hindernisse in den Weg legen. Mit dem am 01.03.2012 in Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen -kurz ESUG genannt- beabsichtigte der Gesetzgeber die Schwachstellen des ehemaligen Insolvenzrechts zu beseitigen und die Fortführung sanierungsfähiger Unternehmen zu erleichtern. Die wesentlichen Schwerpunkte des Reformvorhabens bestanden dabei in der Stärkung der Gläubigerautonomie, der Einführung des sog. Schutzschirmverfahrens sowie dem Ausbau und dem erleichterten Zugang zum Eigenverwaltungsverfahren.
Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wird dem Leser einleitend zunächst das notwendige Grundverständnis zum Themengebiet der Insolvenzabwicklung vermittelt. Nachdem die Reformbedürftigkeit der bisherigen InsO verdeutlicht wurde, werden im weiteren Verlauf die wesentlichen Änderungen, im Speziellen das Schutzschirmverfahren und das modifizierte Eigenverwaltungsverfahren vorgestellt. In Anlehnung an mehrere fremd durchgeführte Studien werden im Rahmen einer ersten Zwischenbilanz sodann die ersten Praxiserfahrungen mit dem neuen Insolvenzrecht dargestellt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation, Problemstellung und praktische Relevanz
- 1.2 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Insolvenzrechtlich relevante Grundlagen und Begrifflichkeiten
- 2.1 Unternehmenskrisen als Vorreiter der Insolvenz
- 2.2 Insolvenzgrund Zahlungsunfähigkeit
- 2.3 Insolvenzgrund drohende Zahlungsunfähigkeit
- 2.4 Insolvenzgrund Überschuldung
- 3 Überblick über das Regelinsolvenzverfahren
- 3.1 Grundlagen und Zielsetzung
- 3.2 Grundzüge der Antragstellung
- 3.3 Das Insolvenzeröffnungsverfahren
- 3.4 Das eröffnete Insolvenzverfahren
- 4 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
- 4.1 Die Eigenverwaltung gem. § 270a InsO
- 4.1.1 Grundlagen und Zielsetzung
- 4.1.2 Zulassungsvoraussetzungen
- 4.1.3 Gründe der Reformbedürftigkeit
- 4.2 Das Schutzschirmverfahren gem. § 270b InsO
- 4.2.1 Grundlagen und Zielsetzung
- 4.2.2 Zulassungsvoraussetzungen
- 4.2.3 Verfahrensablauf
- 5 3 Jahre ESUG - eine Zwischenbilanz
- 5.1 Status Quo
- 5.2 Wesentliche „Post-ESUG-Erkenntnisse"
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Reform der Insolvenzordnung (InsO) und den wesentlichen Änderungen durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG). Ziel ist es, die Reformbedürftigkeit der alten InsO aufzuzeigen, die wesentlichen Neuerungen des ESUG zu erläutern und eine erste Zwischenbilanz der Praxiserfahrungen zu ziehen.
- Die Reformbedürftigkeit der Insolvenzordnung vor dem ESUG
- Die zentralen Änderungen durch das ESUG, insbesondere die Einführung des Schutzschirmverfahrens und die Weiterentwicklung der Eigenverwaltung
- Die ersten Praxiserfahrungen mit dem ESUG
- Die Stärkung der Gläubigerautonomie durch das ESUG
- Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen durch das ESUG
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Reform der Insolvenzordnung ein. Es werden die Ausgangssituation, die Problemstellung und die praktische Relevanz des Themas beleuchtet. Darüber hinaus wird der Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit vorgestellt.
- Kapitel 2: Insolvenzrechtlich relevante Grundlagen und Begrifflichkeiten Hier werden die grundlegenden Begriffe und Konzepte des Insolvenzrechts erläutert, die für das Verständnis der Reform und der Änderungen durch das ESUG notwendig sind. Es werden die verschiedenen Insolvenzgründe, wie Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, erklärt.
- Kapitel 3: Überblick über das Regelinsolvenzverfahren Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Einblick in das Regelinsolvenzverfahren vor der Einführung des ESUG. Es werden die Grundlagen und Zielsetzung des Verfahrens, die Antragstellung, das Insolvenzeröffnungsverfahren und das eröffnete Insolvenzverfahren dargestellt.
- Kapitel 4: Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen Dieses Kapitel behandelt das ESUG und die wichtigsten Änderungen, die es für das deutsche Insolvenzrecht gebracht hat. Insbesondere werden die Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren im Detail analysiert, ihre Grundlagen, Zielsetzungen, Zulassungsvoraussetzungen und den Verfahrensablauf.
- Kapitel 5: 3 Jahre ESUG - eine Zwischenbilanz In diesem Kapitel werden die ersten Praxiserfahrungen mit dem ESUG beleuchtet und ein Zwischenfazit gezogen. Es werden die wichtigsten Entwicklungen und Erfahrungen aus den ersten Jahren der Anwendung des ESUG dargestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Insolvenzordnung (InsO), Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, Gläubigerautonomie, Sanierung, Insolvenzverfahren, Unternehmenskrisen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung ESUG?
ESUG steht für das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“, das am 01.03.2012 in Kraft getreten ist.
Was ist das Schutzschirmverfahren gemäß § 270b InsO?
Es ist ein spezielles Verfahren zur Sanierung bei drohender Zahlungsunfähigkeit, das dem Unternehmen Zeit gibt, unter gerichtlichem Schutz einen Sanierungsplan zu erstellen.
Wie unterscheidet sich die Eigenverwaltung nach der Reform?
Der Zugang zur Eigenverwaltung wurde erleichtert, sodass der Schuldner die Verfügungsgewalt über das Unternehmen behält, statt diese an einen Insolvenzverwalter abzugeben.
Was war der Hauptgrund für die Reform der Insolvenzordnung?
Die alte InsO wurde als zu abwicklungsorientiert kritisiert; das ESUG sollte die Fortführung und Sanierung sanierungsfähiger Unternehmen fördern.
Welche Rolle spielen die Gläubiger im neuen Verfahren?
Das ESUG stärkt die Gläubigerautonomie, insbesondere durch mehr Einflussnahme auf die Auswahl des Insolvenzverwalters bzw. Sachwalters.
- Arbeit zitieren
- Mathias Weidmann (Autor:in), 2015, Reform der Insolvenzordnung. Wesentliche Änderungen durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312335