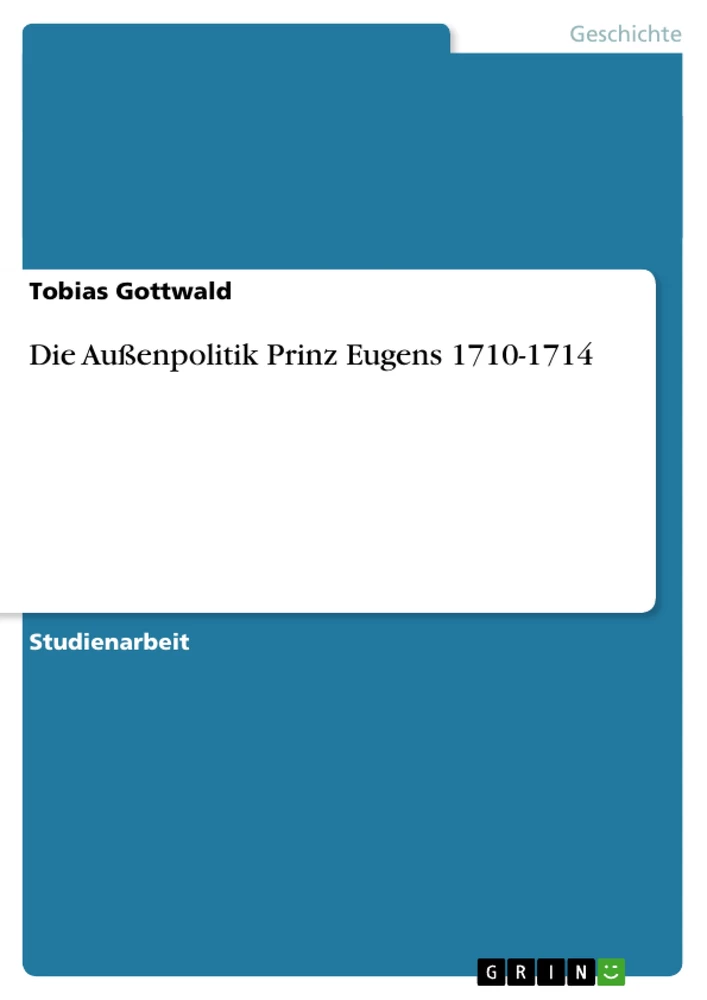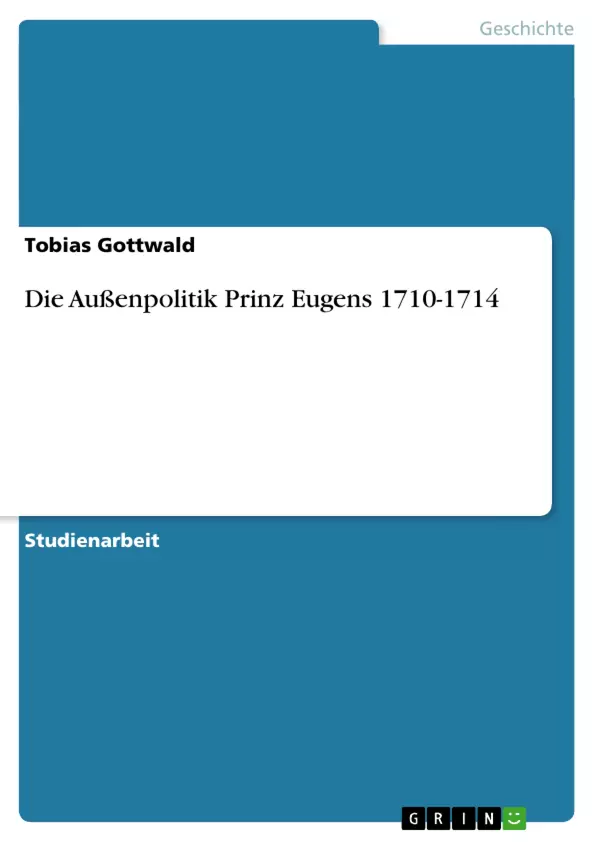Sieben Jahre hatten die Verbündeten der Haager Allianz benötigt, um das Königreich Ludwigs XIV. in dem seit 1701 tobenden Krieg um die Krone Spaniens an den Rand des Zusammenbruchs zu drängen. Als 1709 in Den Haag über einen Frieden verhandelt wurde, war Frankreich militärisch und wirtschaftlich am Ende seiner Kräfte angelangt. Die vormals spanischen Besitzungen in Italien waren ebenso in alliierter Hand wie die südlichen Niederlande. Die mit Ludwig verbündeten Wittelsbacher, die Kurfürsten von Bayern und Köln, waren aus dem Reich vertrieben und alliierte Truppen auf der iberischen Halbinsel aktiv. Versailles war zu Friedensverhandlungen gezwungen. Eine Neuordnung der europäischen Machtverhältnisse schien bevorzustehen. So sah der Haager Präliminarvertrag vom Mai 1709 für den jüngeren Bruder Kaiser Josephs I., Erzherzog Karl, das uneingeschränkte spanische Erbe vor. Dem Reich sollten alle seit 1648 an der Westgrenze verlorenen Besitzungen zurückgegeben werden, während für England koloniale Erwerbungen und Flottenstützpunkte im Mittelmeer und für Holland eine starke Barriere an der französischen Grenze vorgesehen war.
Um seinen Staat vor dem Untergang zu bewahren, war Ludwig XIV. bereit, sich einem Frieden auf dieser Grundlage zu unterwerfen. Die Forschung hat immer wieder darauf hingewiesen, daß 1709 ein derartig konzipierter ‚Siegfrieden’ vor allem deswegen nicht zu Stande gekommen ist, da die Alliierten mit einem Zusatzartikel ihre Forderungen überspannten. Die Klausel verlangte, Ludwig solle sich verpflichten, die Räumung Spaniens falls notwendig gegen seinen Enkel Philipp auch mit Waffengewalt durchzusetzen. Auch die Verhandlungen in Gertruidenburg im darauffolgenden Jahr blieben ohne Ergebnis. Frankreich war trotz aller Not gewillt, den Kampf fortzusetzen.
Während Habsburg und Holland auf eine baldige Niederwerfung Frankreichs drängten, löste das Scheitern der Gertruidenburger Verhandlungen in England bittere Enttäuschung aus. Indem die Tories die spezifisch englischen Interessen gegenüber denen der Allianzpartner hervorhob und in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken konnte, England kämpfe in erster Linie für die Interessen der Kontinentalmächte, schlug sie aus der wachsenden Kriegsmüdigkeit Kapital. Der Tory-Sieg bei den Parlamentswahlen im Oktober 1710 spiegelte diesen Stimmungswandel wider.
Inhaltsverzeichnis
- 2. Die Außenpolitik Eugens in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges
- 2.1 Bündniserhalt und „Siegfrieden“ - Die außenpolitische Zielsetzung Eugens vor dem Zerfall der Haager Allianz (1710/1711)
- 2.2 Auseinandersetzungen um die Verhandlungsgrundlagen (1711-1713)
- 2.3 Arrondierung und Machtkonzentration - Die Diplomatie Eugens bei den Friedensverhandlungen in Rastatt (1713/1714)
- 3. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die außenpolitischen Strategien und Ziele Prinz Eugens in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges (1710-1714). Sie analysiert seine diplomatischen Bemühungen im Kontext des Zerfalls der Haager Allianz und der anschließenden Friedensverhandlungen in Rastatt. Die Arbeit basiert auf der Korrespondenz Eugens.
- Der Zerfall der Haager Allianz und die daraus resultierenden Herausforderungen für Habsburg.
- Prinz Eugens Rolle als Diplomat und seine außenpolitischen Strategien.
- Die Interessen Habsburgs in den Friedensverhandlungen.
- Die Auswirkungen des Krieges auf die europäischen Machtverhältnisse.
- Vergleich der außenpolitischen Prioritäten Eugens mit denen des Kaisers Joseph I.
Zusammenfassung der Kapitel
2. Die Außenpolitik Eugens in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges: Dieses Kapitel analysiert die außenpolitischen Aktivitäten Prinz Eugens während des Zerfalls der Haager Allianz und der anschließenden Friedensverhandlungen. Es beleuchtet seine Bemühungen, die Allianz zu erhalten und einen für Habsburg günstigen Frieden zu erreichen. Die Zusammenfassung der Unterkapitel 2.1, 2.2 und 2.3 zeigt die Entwicklung von Eugens Strategien, von der anfänglichen Bemühung um Bündniserhalt über die Auseinandersetzungen um die Verhandlungsgrundlagen bis hin zu seinen Bemühungen um Machtkonzentration und Arrondierung während der Friedensverhandlungen in Rastatt. Der Fokus liegt auf den politischen und diplomatischen Überlegungen Eugens und seiner Reaktionen auf den sich verändernden Kräfteverhältnissen in Europa. Die militärischen Entwicklungen werden nur am Rande betrachtet.
Schlüsselwörter
Prinz Eugen, Spanischer Erbfolgekrieg, Haager Allianz, Friedensverhandlungen Rastatt, Habsburg, Außenpolitik, Diplomatie, Machtpolitik, europäische Machtverhältnisse, Frieden von Utrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Prinz Eugens Außenpolitik in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die außenpolitischen Strategien und Ziele Prinz Eugens von Savoyen in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges (1710-1714). Der Schwerpunkt liegt auf seinen diplomatischen Bemühungen während des Zerfalls der Haager Allianz und den darauf folgenden Friedensverhandlungen in Rastatt. Die Analyse basiert auf der Korrespondenz des Prinzen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Zerfall der Haager Allianz und die daraus resultierenden Herausforderungen für das Haus Habsburg. Sie analysiert Prinz Eugens Rolle als Diplomat und seine Strategien, die Interessen Habsburgs in den Friedensverhandlungen, die Auswirkungen des Krieges auf die europäischen Machtverhältnisse und vergleicht Eugens außenpolitische Prioritäten mit denen Kaiser Josephs I.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Kapitel 2, "Die Außenpolitik Eugens in der Endphase des Spanischen Erbfolgekrieges", ist das zentrale Kapitel und analysiert Eugens Aktivitäten während des Zerfalls der Haager Allianz und der Friedensverhandlungen. Es unterteilt sich in drei Unterkapitel: 2.1 (Bündniserhalt und „Siegfrieden“), 2.2 (Auseinandersetzungen um die Verhandlungsgrundlagen) und 2.3 (Arrondierung und Machtkonzentration). Kapitel 3 bildet den Schluss der Arbeit.
Auf welchen Quellen basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert primär auf der Korrespondenz Prinz Eugens. Militärische Entwicklungen werden nur am Rande betrachtet, der Fokus liegt auf den politischen und diplomatischen Überlegungen Eugens und seinen Reaktionen auf die sich verändernden Kräfteverhältnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prinz Eugen, Spanischer Erbfolgekrieg, Haager Allianz, Friedensverhandlungen Rastatt, Habsburg, Außenpolitik, Diplomatie, Machtpolitik, europäische Machtverhältnisse, Frieden von Utrecht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die außenpolitischen Strategien Prinz Eugens während einer entscheidenden Phase des Spanischen Erbfolgekrieges zu untersuchen und zu analysieren. Sie möchte seine Rolle als Diplomat und seine Beiträge zu den Friedensverhandlungen beleuchten und in den Kontext der europäischen Machtverhältnisse einordnen.
- Citation du texte
- Tobias Gottwald (Auteur), 2004, Die Außenpolitik Prinz Eugens 1710-1714, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31234