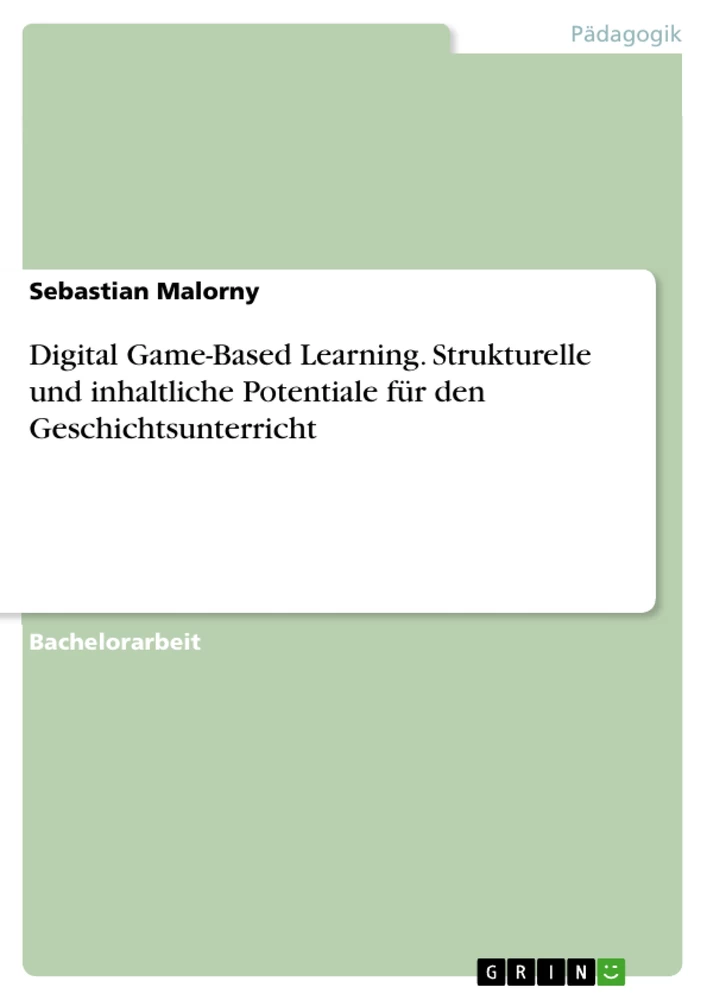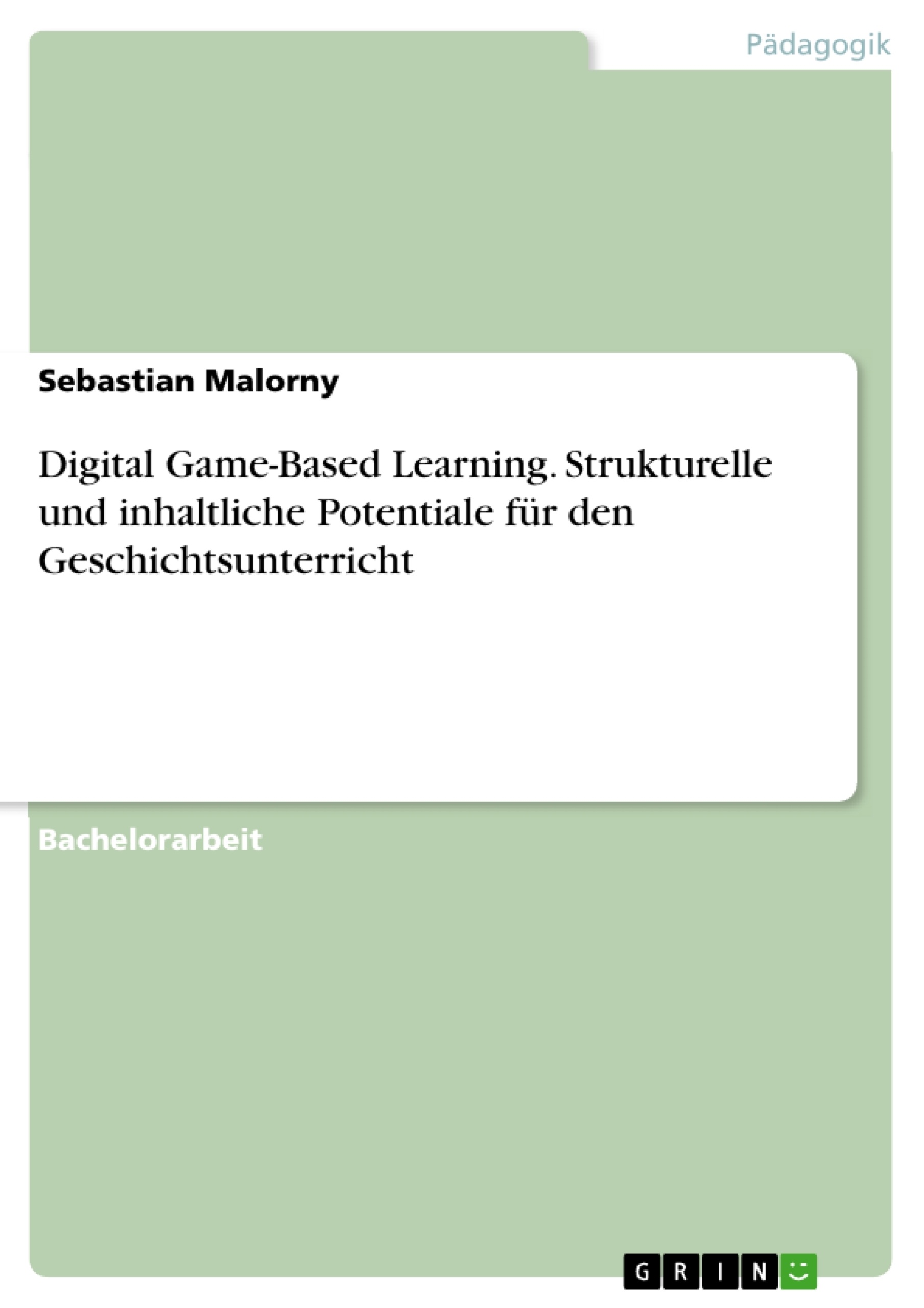Bieten Videospiele eine spezielle Struktur, die man im Geschichtsunterricht nutzen kann? Und falls diese Struktur vorhanden ist, nach welchen Prinzipien muss der Geschichtsunterricht organisiert sein? Diesen Fragen wird in der vorliegenden Bachelorarbeit nachgegegangen.
Aufgrund seiner eigenen Sozialisation, die maßgeblich von den digitalen Spielwelten beeinflusst wurde, aber auch die ständige Kritik von Eltern, Schule und Medien gegenüber seinem Hobby, wollte der Autor feststellen, ob Videospiele einen Platz im Schulunterricht finden konnten. Als Lehramtsstudent im Fach Geschichte und begeisterter Computerspieler von Strategiespielen, hat er seinem Hobby schon immer unterstellt, besonders wichtige Inhalte vermitteln zu können. Schließlich musste er als Feldherr unzählige Schlachten planen und durchführen, strategische Entscheidungen treffen und soziale Kompetenz in Onlinespielen entwickeln.
Diese beiden Fragen werden anhand der Kenntnisse des Verfassers aus dem Fach Bildungswissenschaften versucht zu beantworten. Dabei werden Inhalte aus der Psychologie (Lerntheorien und Lernzieltaxonomien), der Geschichtswissenschaft (Geschichtsbewusstsein und Unterrichtsmodelle) und der Medienpädagogik (u.a. Digital Game-Based Learning, Computer- und Internetnutzung und Experiential gaming model) in Verbindung zueinander gestellt und so die strukturellen und inhaltlichen Potentiale des Digital Game-Based Learning für den Geschichtsunterricht herausgearbeitet.
Zu Beginn dieser Arbeit wird das Digital Game-Based Learning nach Prensky vorgestellt und die Merkmale von digitalen Videospielen erläutert. Weiterhin beschreibt der Autor, wie Videospiele in den Unterricht implementiert werden können und welche Hindernisse zu erwarten sind. Um die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen besser einschätzen zu können, werden sie u.a. mit der aktuellen KIM-Studie (2010) und JIM-Studie (2010) fassbar gemacht. Im Verlauf der Arbeit werde ich die Frage geklärt, welche theoretischen Grundlagen im Digital Game-Based Learning zu finden sind.
Denn auch wenn es der Umfang der Publikationen zu diesem Thema vermuten lässt, eine vollwertige Theorie ist es bislang noch nicht. Diese Kapitel liefern die (theoretischen) Grundlagen für die Unterrichtsmodelle aus der Geschichtswissenschaft, welche dadurch mit dem Digital Game-Based Learning verbunden werden können. Das Fazit stellt die Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 EINLEITUNG
- 2 DIGITAL GAME-BASED LEARNING IN SCHULE UND UNTERRICHT
- 2.1 AUFBAU
- 2.2 DEFINITION
- 2.3 GRUNDANNAHMEN
- 2.4 MERKMALE DIGITALER VIDEOSPIELE
- 2.5 IMPLEMENTIERUNG IM UNTERRICHT
- 2.5.1 Probleme beim Einsatz von DGBL in der Schule
- 2.5.2 An Individualized Inventory for Integrating Instructional Innovations (i5)
- 2.5.3 Instruktion für den Einsatz von kommerziellen Spielen im Unterricht
- 2.6 IT-AUSSTATTUNG IN DEUTSCHEN HAUSHALTEN UND SCHULEN
- 2.6.1 Videospiele und Computer als Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
- 2.6.2 Medienausstattung an deutschen Schulen
- 3 LERNPROZESSE UND DIGITAL GAME-BASED LEARNING
- 3.1 AUFBAU
- 3.2 LERNZIELTAXONOMIE
- 3.2.1 Kognitive Lernziele
- 3.2.2 Affektive Lernziele
- 3.2.3 Psychomotorische Lernziele
- 3.3 KOLBS THEORIE DES ERFAHRUNGSLERNEN
- 3.4 EXPERIENTIAL GAMING MODEL
- 3.5 ANCHORED INSTRUCTION Ansatz
- 3.6 GESCHICHTSBEWUSSTSEIN UND DGBL
- 4 STRUKTURELLE UND INHALTLICHE POTENTIALE DES DGBL FÜR DEN GESCHICHTSUNTERRICHT
- 4.1 AUFBAU
- 4.2 VERKNÜPFUNG VON DGBL MIT METHODISCH-DIDAKTISCHEN KONZEPTEN DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT
- 4.3 UNTERRICHTSModelle im FACH GESCHICHTE
- 4.3.1 DGBL im handlungsorientierten Geschichtsunterricht
- 4.3.2 DGBL im problemorientierten Geschichtsunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die strukturellen und inhaltlichen Potentiale von Digital Game-Based Learning (DGBL) für den Geschichtsunterricht. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration von digitalen Spielen in den Geschichtsunterricht zu analysieren und didaktische Konzepte zu entwickeln, die den Einsatz von DGBL im Unterricht ermöglichen.
- Das Potenzial von DGBL für das Geschichtslernen
- Methodisch-didaktische Konzepte für den Einsatz von DGBL im Geschichtsunterricht
- Die Bedeutung von Geschichtsbewusstsein im Kontext von DGBL
- Die Rolle von DGBL in handlungs- und problemorientiertem Geschichtsunterricht
- Die Einbindung von DGBL in bestehende Lehrpläne
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 stellt die Arbeit ein und beschreibt die Motivation, DGBL im Geschichtsunterricht zu untersuchen. Kapitel 2 definiert DGBL, beleuchtet seine Grundannahmen und Merkmale sowie seine Implementierung im Unterricht. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten des Einsatzes von DGBL in der Schule diskutiert, einschließlich der IT-Ausstattung in deutschen Haushalten und Schulen. Kapitel 3 befasst sich mit Lernprozessen und DGBL. Es werden verschiedene Lerntheorien, wie Kolbs Theorie des Erfahrungslernen und das Experiential Gaming Model, vorgestellt. Die Bedeutung von Geschichtsbewusstsein im Zusammenhang mit DGBL wird ebenfalls beleuchtet. Kapitel 4 analysiert die strukturellen und inhaltlichen Potentiale von DGBL für den Geschichtsunterricht. Es werden verschiedene Unterrichtsmodelle im Fach Geschichte vorgestellt, die den Einsatz von DGBL ermöglichen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Digital Game-Based Learning, Geschichtsunterricht, DGBL, Geschichtsbewusstsein, Lerntheorien, Kolbs Theorie, Experiential Gaming Model, Unterrichtsmodelle, handlungsorientierter Geschichtsunterricht, problemorientierter Geschichtsunterricht, IT-Ausstattung, Medienpädagogik
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Digital Game-Based Learning (DGBL)?
DGBL bezeichnet das Lernen durch digitale Videospiele, bei dem Spielstrukturen genutzt werden, um Wissen und Kompetenzen in einem motivierenden Kontext zu vermitteln.
Wie können Videospiele im Geschichtsunterricht helfen?
Spiele ermöglichen es Schülern, historische Entscheidungen nachzuvollziehen (z.B. als Strategen), fördern das Geschichtsbewusstsein und erlauben handlungsorientiertes sowie problemorientiertes Lernen.
Welche Lerntheorien stützen den Einsatz von DGBL?
Wichtige Grundlagen sind Kolbs Theorie des Erfahrungslernens, das Experiential Gaming Model und der Anchored Instruction Ansatz.
Welche Probleme gibt es beim Einsatz von DGBL in Schulen?
Hindernisse sind oft die mangelnde IT-Ausstattung der Schulen, zeitliche Einschränkungen durch Lehrpläne und Vorurteile gegenüber dem Medium Videospiel.
Was sind kognitive und affektive Lernziele bei DGBL?
Kognitive Ziele betreffen den Wissenserwerb und das Verständnis komplexer Systeme, während affektive Ziele die Empathie für historische Akteure und die Veränderung von Einstellungen beinhalten.
- Quote paper
- Sebastian Malorny (Author), 2012, Digital Game-Based Learning. Strukturelle und inhaltliche Potentiale für den Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312542