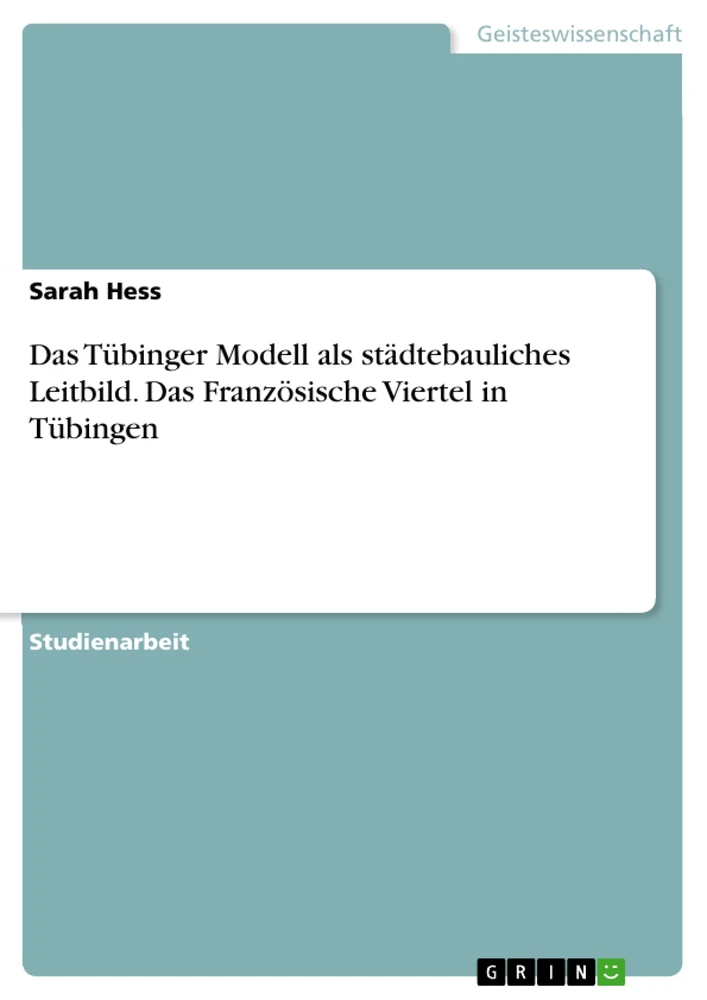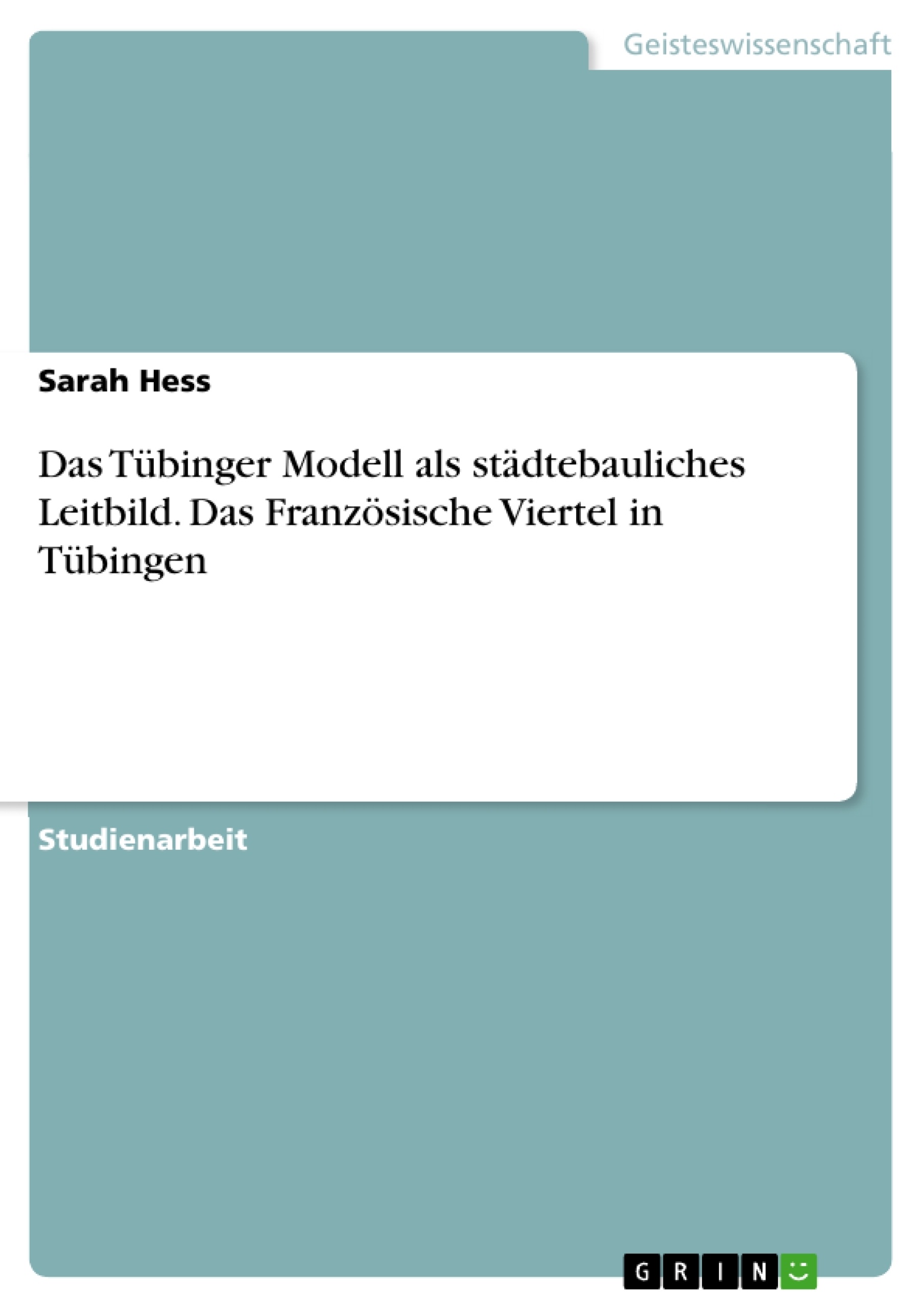Die gesellschaftliche Bedeutung des Wohnens wird im Bezug auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft immer mehr zum entscheidenden Faktor. Wohnen ist ein Lebensbereich mit elementarer Bedeutung, denn er ist der Mittelpunkt alltäglicher Lebenserfahrung. Wohnen ist aber auch eine Form der sozialen Interaktion, es schließt das Wohnumfeld ebenso mit ein wie die soziale Nachbarschaft. Der Standort der Wohnung ist ausschlaggebend für die Einbettung in soziale Beziehungsnetze.
Das französische Viertel in Tübingen ist, mit seinem preisgekrönten Konzept, inzwischen zum beispielgebenden Vorbild und internationalen Leitbild für nachhaltige Stadtentwicklung geworden. Es hat eine Vielzahl von Preisen erhalten, unter anderem den deutschen Städtepreis 2001. Es kann als eine Art Gegenmodell zum seit Jahrzehnten gängigen Verfahren der Nutzungstrennung und der strengen Separierung von Arbeiten und Wohnen gesehen werden. Durch das Konzept innerstädtischen Wohnens und die Mischung der Sozialstruktur entsteht eine große Vielfalt an Wohnformen.
Durch meine, an das Französische Viertel angrenzende Wohnlage nutze ich selbst oft die kurzen Wege, die der Stadtteil durch die vielfältige Infrastruktur bietet. Für diese Nutzung ausschlaggebend sind für mich aber auch die kinderfreundlichen Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten. In der vorliegenden Hausarbeit untersuche ich, ob durch das städtebauliche Konzept das soziale Miteinander im Viertel tatsächlich gestärkt wird und ob durch diese Wohn- und Lebensform eine bessere Integration der Bewohner erreicht werden kann. Für mich stellt sich auch die Frage, ob durch solche städtebaulichen Maßnahmen ein gesellschaftlich positiver Einfluss auf die ansteigende Anonymität und Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen in der Nachbarschaft genommen werden kann.
Dafür definiere ich zunächst einige zentrale Begriffe. Im weiteren Verlauf werde ich detailliert auf die Konzeption des Viertels eingehen. Literarisch werde ich mich hauptsächlich auf Andreas Feldtkeller beziehen, dessen Werken die Grundidee des Rahmenplanes entstammt. Um auf die weitere Entwicklung des Viertels genauer eingehen zu können, stütze ich meine Arbeit auf eine soziologische Studie, die von Katharina Manderscheid über den Stadtteil gemacht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Öffentlicher Raum
- 2.2 Urbanität
- 2.3 Integration
- 3. Das städtebauliche Konzept
- 3.1 Wohnen und Leben im Französischen Viertel
- 3.2 Gewerbe und Arbeitsplätze im Französischen Viertel
- 4. Integration und Urbanität
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das städtebauliche Konzept des französischen Viertels in Tübingen und dessen Auswirkungen auf das soziale Miteinander und die Integration der Bewohner. Es wird analysiert, ob das Konzept, welches als Gegenmodell zur Nutzungstrennung von Wohnen und Arbeiten gilt, tatsächlich zu einem stärkeren sozialen Zusammenhalt und einer verbesserten Integration beiträgt und ob es einen positiven Einfluss auf die zunehmende Anonymität in der Nachbarschaft hat.
- Das städtebauliche Konzept des französischen Viertels in Tübingen
- Soziale Interaktion und Zusammenhalt im Wohnumfeld
- Integration von Bewohnern unterschiedlicher sozialer Schichten
- Der öffentliche Raum als Faktor für Integration und soziales Miteinander
- Auswirkungen städtebaulicher Maßnahmen auf Anonymität und Gleichgültigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die gesellschaftliche Bedeutung von Wohnen für den sozialen Zusammenhalt. Sie stellt das französische Viertel in Tübingen als beispielgebendes Modell für nachhaltige Stadtentwicklung vor und nennt dessen Auszeichnungen. Die Arbeit untersucht, ob das städtebauliche Konzept zu mehr sozialem Miteinander und Integration führt und ob es die zunehmende Anonymität in Nachbarschaften positiv beeinflussen kann. Die Autorin beschreibt ihre Motivation durch ihre eigene Wohnlage im Umfeld des Viertels und kündigt die Definition zentraler Begriffe und die detaillierte Untersuchung des Konzepts an, wobei sie auf die Arbeiten von Andreas Feldtkeller und Katharina Manderscheid verweist.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert die Schlüsselbegriffe „Öffentlicher Raum“, „Urbanität“ und „Integration“. Der öffentliche Raum wird anhand der Definition von Gabriele Steffen erläutert, die neben der räumlichen Dimension auch die psychologischen, politischen und rechtlichen Aspekte betont. Urbanität wird nach Feldtkeller als soziale, kulturelle und funktionale Vielfalt mit einer funktionalen Mischung verstanden, während Krämer-Badoni Integration als Teilhabe an verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen beschreibt.
3. Das städtebauliche Konzept: Dieses Kapitel beschreibt das städtebauliche Konzept des französischen Viertels, das im Gegensatz zum traditionellen Modell der Nutzungstrennung von Wohnen und Arbeiten steht. Es basiert auf der Idee von Andreas Feldtkellers Buch „Die zweckentfremdete Stadt“ und wurde durch private Baugemeinschaften realisiert. Das Konzept zielt auf bezahlbares Bauen, hohe Identifikation, strukturelle Vielfalt sowie soziale und funktionale Mischung ab. Die hohe bauliche Dichte hat Wohnraum für fast 2500 Bewohner in einer Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen geschaffen, mit Größen von 35 bis 230 Quadratmetern.
Schlüsselwörter
Französisches Viertel Tübingen, Stadtentwicklung, soziale Integration, Urbanität, öffentlicher Raum, Wohnen, soziale Mischung, nachhaltige Stadtplanung, Baugemeinschaften, Anonymität, sozialer Zusammenhalt.
Häufig gestellte Fragen zum französischen Viertel Tübingen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das städtebauliche Konzept des französischen Viertels in Tübingen und dessen Auswirkungen auf das soziale Miteinander und die Integration der Bewohner. Im Fokus steht die Frage, ob das Konzept, welches Wohnen und Arbeiten verbindet, zu mehr sozialem Zusammenhalt und Integration beiträgt und die zunehmende Anonymität in Nachbarschaften positiv beeinflusst.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie das städtebauliche Konzept des französischen Viertels, soziale Interaktion und Zusammenhalt, Integration verschiedener sozialer Schichten, die Rolle des öffentlichen Raums für Integration und soziales Miteinander sowie die Auswirkungen städtebaulicher Maßnahmen auf Anonymität und Gleichgültigkeit. Es werden die Schlüsselbegriffe „Öffentlicher Raum“, „Urbanität“ und „Integration“ definiert und anhand theoretischer Ansätze erläutert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Begriffserklärungen, ein Kapitel zum städtebaulichen Konzept des französischen Viertels, ein Kapitel zu Integration und Urbanität und ein Fazit. Die Einleitung stellt das französische Viertel als beispielgebendes Modell für nachhaltige Stadtentwicklung vor und beschreibt die Forschungsmotivation. Die Kapitelüberschriften geben einen detaillierten Überblick über den Inhalt.
Welche konkreten Aspekte des französischen Viertels werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf das städtebauliche Konzept des Viertels, das im Gegensatz zum traditionellen Modell der Nutzungstrennung von Wohnen und Arbeiten steht. Es werden Aspekte wie bezahlbares Bauen, hohe Identifikation, strukturelle Vielfalt, soziale und funktionale Mischung sowie die Auswirkungen der hohen baulichen Dichte auf das Zusammenleben der Bewohner untersucht.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Arbeiten von Andreas Feldtkeller (z.B. "Die zweckentfremdete Stadt") und Katharina Manderscheid. Die Definition des öffentlichen Raums stützt sich auf Gabriele Steffen, die Definition von Urbanität auf Feldtkeller und die von Integration auf Krämer-Badoni. Die Arbeit verwendet diese theoretischen Ansätze, um das städtebauliche Konzept und dessen Auswirkungen zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn der vollständige Text des Fazits verfügbar ist. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch einen Hinweis auf die Forschungsfragen und die zu erwartenden Ergebnisse.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französisches Viertel Tübingen, Stadtentwicklung, soziale Integration, Urbanität, öffentlicher Raum, Wohnen, soziale Mischung, nachhaltige Stadtplanung, Baugemeinschaften, Anonymität, sozialer Zusammenhalt.
- Citar trabajo
- Sarah Hess (Autor), 2015, Das Tübinger Modell als städtebauliches Leitbild. Das Französische Viertel in Tübingen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312557