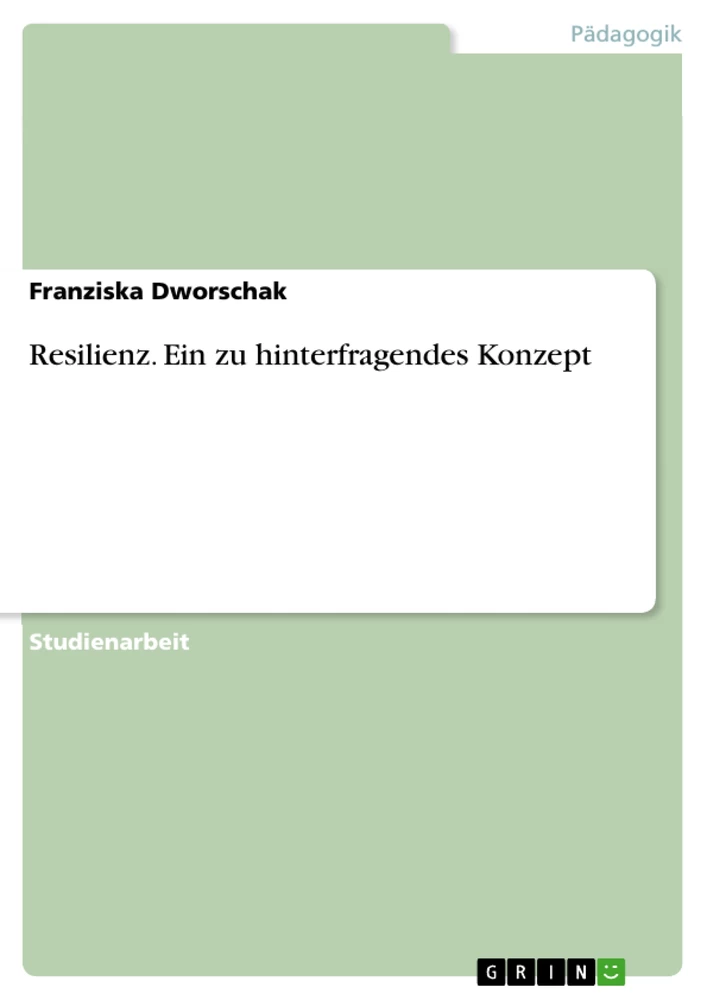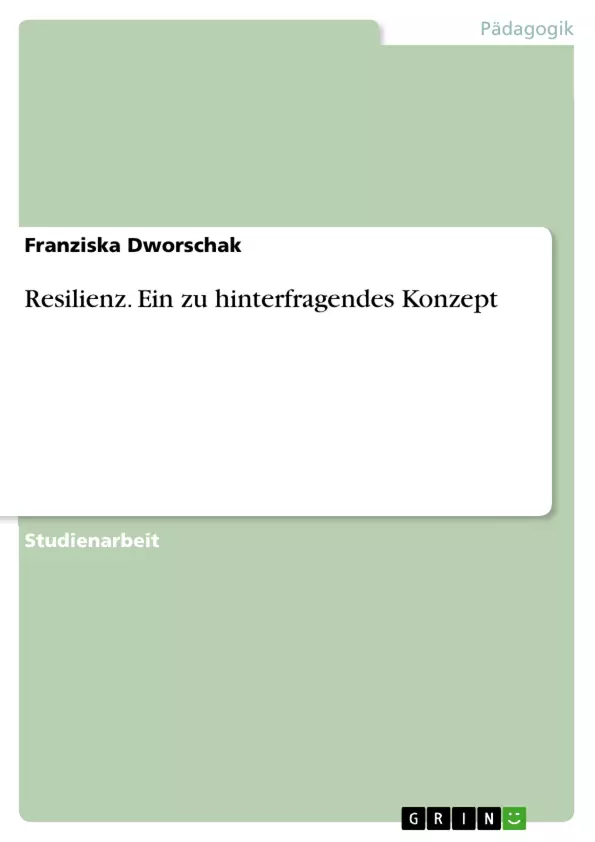Die Resilienztheorie ist seit Jahren ein intensiv diskutiertes Thema, dass multidisziplinär große Beachtung findet und starken Einfluss auf die Praxen der einzelnen Disziplinen aufweist.
Das Ziel der Pädagogik im Allgemein ist, Menschen zu stabilen und gesunden Persönlichkeiten zu erziehen, um ihnen so eine gute und gelingende Lebensführung im Kontext einer erfolgreichen gesellschaftlichen Integration zu ermöglichen. Die Resilienztheorie stellt hierbei einen Baustein dar, der für die Verwirklichung dieses Zieles angewandt wird. Aufgrund der Schutzfaktoren und Risikofaktoren ist es möglich Entwicklungsstimuli zu identifizieren und mögliche Entwicklungsrisiken aufgrund von äußeren Gegebenheiten und personalen Faktoren zu bestimmen – oder nicht?
Im Folgenden wird ein Überblick über die Bedeutung des Resilienzbegriffs für die Pädagogik mit den aktuellen Fragen des Forschungsstandes gegeben. Dieser Überblick dient als Grundlage für mögliche (gedankliche) Stolpersteine und soll einen Anstoß geben, das Resilienzkonzept aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das vieldiskutierte Thema der Bildung soll in diesem Zusammenhang, als mögliche Resilienzförderung und Chance für eine gelingende Lebensführung dargestellt werden und welche Schwierigkeiten sich in Bezug auf die Bildungsthematik hieraus ergeben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Praxisbezug und weiterführende Fragestellungen
- 2.1 Zentrale Bedeutung des Resilienzbegriffs für die Pädagogik
- 2.2 Forschungsstand
- 2.2.1 Anlage oder Umwelt - Resilienz als Prozess
- 2.2.2 Die Langzeitperspektive
- 2.2.3 Offene Forschungsfragen
- 3. Mögliche Stolpersteine
- 3.1 Resilienz als Garant für ein geglücktes Leben?
- 3.2 Normalitätsvorstellungen
- 4. Bildung als Chance – für wen und wofür?
- 4.1 Zusammenhang von gelingender Lebensführung und Bildung
- 4.2 Die ursprüngliche Idee der Bildung
- 4.3 Ähnlichkeiten der Konzepte „Bildung“ und „Resilienz“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert das Konzept der Resilienz, insbesondere im Kontext der Pädagogik, und hinterfragt seine Relevanz und potenzielle Stolpersteine. Das Ziel ist es, das Konzept aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die Debatte um die Bedeutung von Resilienz im Bildungsbereich anzustoßen.
- Die zentrale Rolle des Resilienzbegriffs in der Pädagogik
- Der aktuelle Forschungsstand zu Resilienz und dessen Implikationen für die Pädagogik
- Mögliche Stolpersteine beim Verständnis und der Anwendung des Resilienzkonzepts
- Die Bedeutung von Bildung als potenzielle Resilienzförderung
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Konzepten „Bildung“ und „Resilienz“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in das Thema Resilienz ein und unterstreicht seine Bedeutung in der Pädagogik. Es stellt dar, dass die Resilienztheorie die Variabilität der individuellen Entwicklungsverläufe im Fokus hat, insbesondere bei Personengruppen, die Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind.
Kapitel zwei beleuchtet den Praxisbezug des Resilienzbegriffs und stellt weiterführende Fragestellungen auf. Im ersten Unterkapitel wird die zentrale Bedeutung des Resilienzbegriffs für die Pädagogik herausgearbeitet und es wird gezeigt, dass die Resilienzforschung aus der Entwicklungspsychopathologie entstanden ist und sich mit den Ursachen von sozialen und psychischen Entwicklungsstörungen befasst. Im zweiten Unterkapitel wird der aktuelle Forschungsstand zur Resilienz behandelt, wobei die Themen Anlage vs. Umwelt, Langzeitperspektive und offene Forschungsfragen beleuchtet werden.
Kapitel drei widmet sich möglichen Stolpersteinen bei der Anwendung des Resilienzkonzepts. Es wird diskutiert, ob Resilienz als Garant für ein geglücktes Leben angesehen werden kann und inwieweit das Konzept Normalitätsvorstellungen und die Definition von „gesunder“ Entwicklung impliziert.
Kapitel vier untersucht Bildung als Chance für die Förderung von Resilienz. Es wird der Zusammenhang von gelingender Lebensführung und Bildung sowie die ursprüngliche Idee von Bildung im Kontext der Aufklärung beleuchtet. Das Kapitel untersucht die Ähnlichkeiten der Konzepte „Bildung“ und „Resilienz“ im Hinblick auf ihre grundlegende Idee der „gelingenden Lebensführung“.
Schlüsselwörter (Keywords)
Resilienz, Pädagogik, Entwicklungspsychopathologie, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Forschungsstand, Langzeitstudien, Bildung, Lebensführung, Normalitätsvorstellungen, Sozialisation, Individuelle Entwicklung, Selbsttätigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Resilienztheorie in der Pädagogik?
Ziel ist es, Kinder zu stabilen Persönlichkeiten zu erziehen, die trotz widriger Umstände oder Risikofaktoren eine gesunde Entwicklung und gesellschaftliche Integration meistern.
Was sind Schutz- und Risikofaktoren?
Risikofaktoren sind äußere oder personale Gegebenheiten, die die Entwicklung gefährden, während Schutzfaktoren (wie eine stabile Bezugsperson) diese Risiken abmildern können.
Ist Resilienz eine angeborene Eigenschaft oder ein Prozess?
Die moderne Forschung betrachtet Resilienz eher als einen dynamischen Prozess der Interaktion zwischen Individuum und Umwelt, nicht als feststehendes Persönlichkeitsmerkmal.
Welche Stolpersteine gibt es beim Resilienzkonzept?
Kritisch hinterfragt wird, ob Resilienz als "Garant" für ein geglücktes Leben missverstanden wird und welche Normalitätsvorstellungen dabei mitschwingen.
Wie hängen Bildung und Resilienz zusammen?
Bildung wird als Chance zur Resilienzförderung gesehen, da sie Kompetenzen vermittelt, die eine gelingende Lebensführung unterstützen.
Aus welcher Disziplin stammt die Resilienzforschung ursprünglich?
Sie ist aus der Entwicklungspsychopathologie entstanden, die sich mit den Ursachen von sozialen und psychischen Störungen befasst.
- Citation du texte
- Franziska Dworschak (Auteur), 2014, Resilienz. Ein zu hinterfragendes Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312615