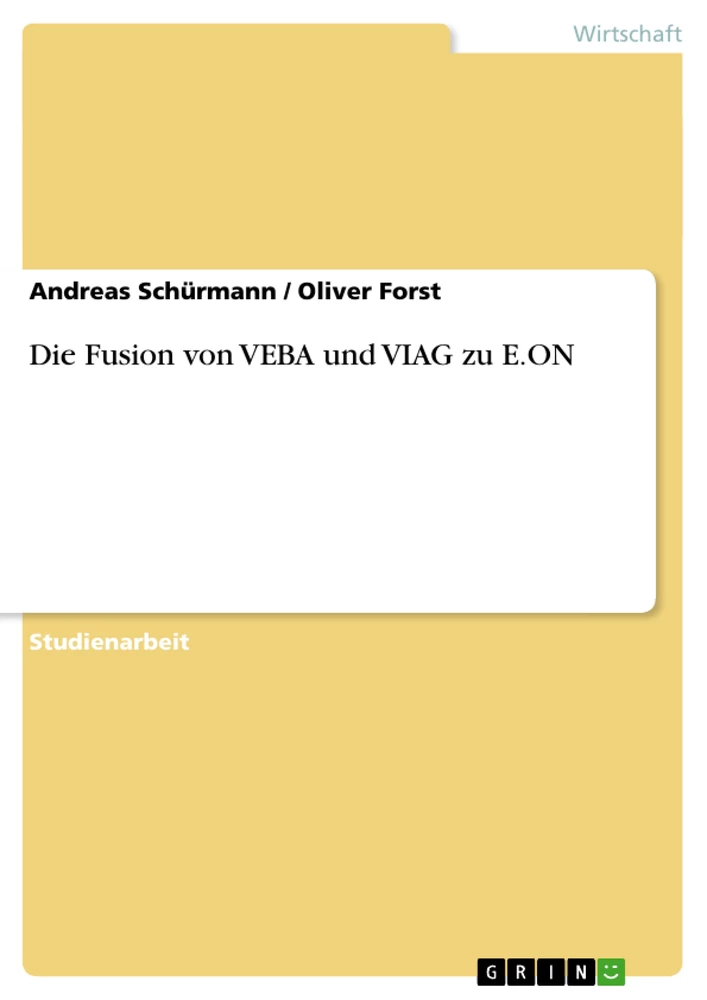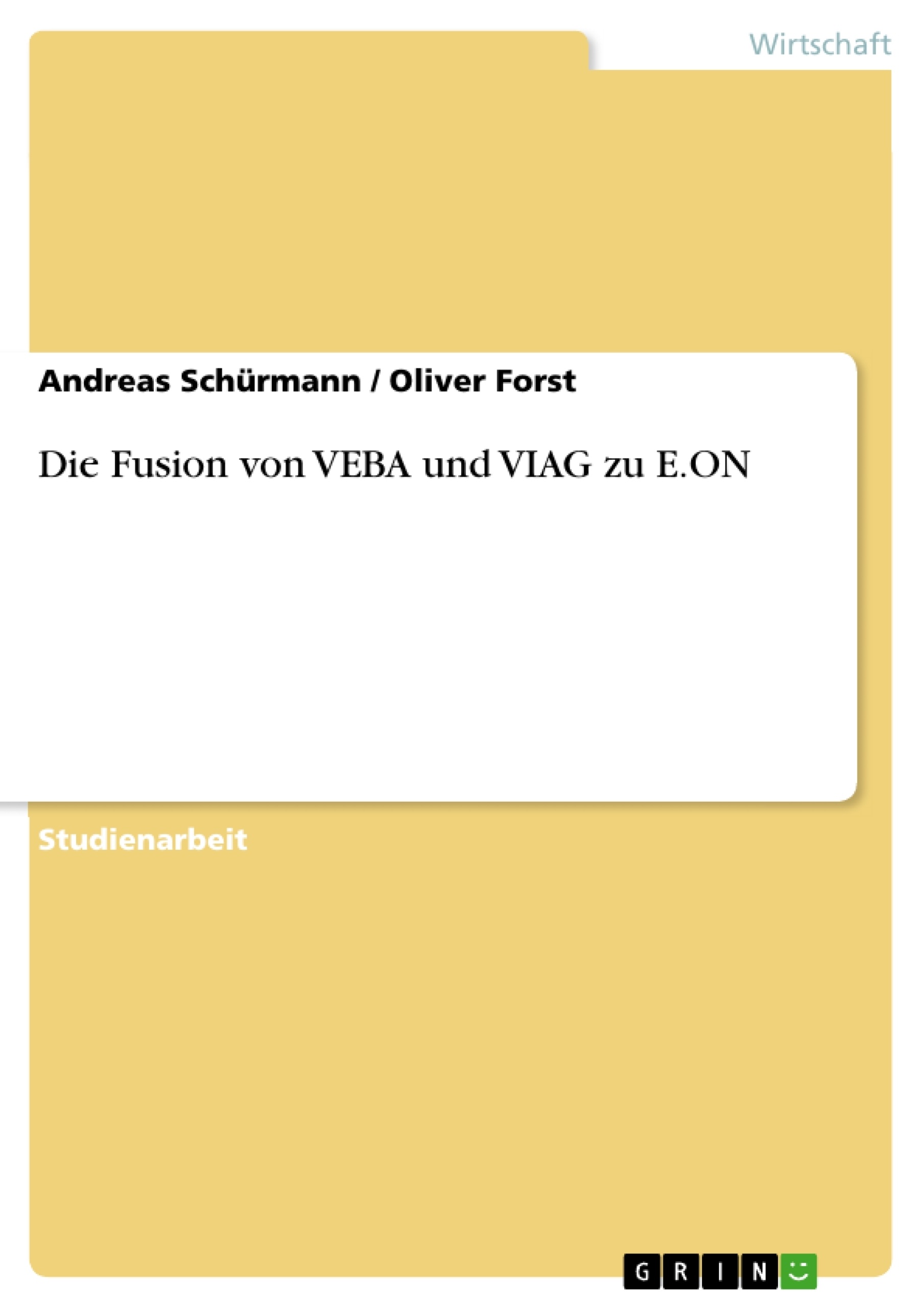Die Fusionskontrolle hat die Aufgabe, einer „übermäßigen“ Marktbeherrschung zu begegnen. Ziel ist es, wettbewerbliche Marktstrukturen zu erhalten und vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume von Unternehmen im Interesse der materiellen Handlungsfreiheit anderer Unternehmen und der Verbraucher zu verhindern. Die Fusionskontrolle soll also einer Gefährdung des Wettbewerbs begegnen, die sich aus einer Veränderung der Marktstruktur in Folge eines Zusammenschlusses ergeben kann.
Die Fusionskontrolle wird nicht auf einen bestimmten Theorieansatz gestützt. Maßgebend hierfür ist der Gedanke, dass sich die Marktstellung eines Unternehmens in der Regel nicht alleine aufgrund der Prüfung eines Strukturkriteriums (z.B. Marktanteil, aktueller oder potenzieller Wettbewerb), sondern nur anhand einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände des Einzelfalls beurteilen lässt. Im Einzelfall kann dies dazu führen, dass selbst Zusammenschlüsse, bei denen hohe Marktanteile erreicht werden, nicht untersagt werden, weil andere Strukturfaktoren, wie z.B. ein leistungsfähiger, potenzieller Wettbewerb aus dem Ausland und eine nachfragestarke Marktgegenseite, aller Erwartungen nach keine unkontrollierten wettbewerblichen Verhaltensspielräume der Zusammenschlussbeteiligten zulassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kartellrechtliche Grundlagen für die Prüfung von Fusionen
- 1.1. Der Marktbeherrschungsbegriff in der deutschen Fusionskontrolle
- 1.1.1. Zuständigkeiten des Bundeskartellamtes
- 1.2. Der Marktbeherrschungsbegriff im europäischen Wettbewerbsrecht
- 1.2.1. Zuständigkeiten der EU-Wettbewerbskommission
- 2. Definition „natürliche Monopole“
- 3. Ausgangssituation auf dem deutschen/europäischen Strommarkt
- 4. Ausgangssituation auf dem globalen Chemiemarkt
- 5. Status Quo Betrachtung von VEBA AG und VIAG AG
- 5.1. Historische Betrachtung von VEBA AG
- 5.1.1. Unternehmensstruktur der VEBA AG im Jahr 1998
- 5.1.1.1. Unternehmensprofil PreussenElektra AG
- 5.1.1.2. Unternehmensprofil Degussa-Hüls AG
- 5.1.2. Anteilseignerstruktur
- 5.2. Historische Betrachtung von VIAG AG
- 5.2.1. Unternehmensstruktur der VIAG AG im Jahr 1998
- 5.2.1.1. Unternehmensprofil Bayernwerk AG
- 5.2.1.2. Unternehmensprofil SKW Trostberg AG
- 5.2.2. Anteilseignerstruktur
- 6. Die Fusion VEBA/VIAG zu E.ON
- 6.1. Vorteile der Verschmelzung
- 6.1.1. Strategische Vorteile
- 6.1.2. Synergiepotentiale
- 6.1.2.1. Marktsynergien
- 6.1.2.2. Kostensynergien
- 6.1.3. Gewachsene Finanzkraft des neuen Unternehmens
- 6.2. Der Weg zum Zusammenschluss
- 6.2.1. „Merger of equals“
- 6.2.2. Wesentliche Schritte der Zusammenführung
- 6.2.2.1. Abschluss des Verschmelzungsvertrages
- 6.2.2.2. Außerordentliche HV von VEBA und VIAG
- 6.2.2.3. Ordentliche HV von VEBA und VIAG
- 6.2.2.4. Eintragung der Verschmelzung
- 6.2.3. Erwerb von VIAG-Aktien durch die VEBA AG
- 6.3. Unternehmensbewertung VEBA/VIAG
- 6.3.1. Unternehmenswert der VEBA AG
- 6.3.2. Unternehmenswert der VIAG AG
- 6.4. Umtauschverhältnis
- 7. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen
- 7.1. Finanzwirtschaftliche Aspekte und Kennzahlen
- 7.2. Rechnungslegung des neuen Unternehmens
- 8. Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen
- 8.1. Erlöschen der VIAG AG und ihrer Aktien
- 8.2. Umtausch von VIAG Aktien in VEBA-VIAG Aktien
- 8.3. Beteiligungsverhältnisse bei der VEBA-VIAG AG nach der Verschmelzung
- 8.4. Satzung des neuen Unternehmens
- 8.4.1. Firma und Sitz
- 8.4.2. Gegenstand des Unternehmens
- 8.5. Kosten des Zusammenschlusses
- 9. Kartellrechtliche Auflagen der Fusion
- 10. Unternehmerische Ausrichtung und Strategie von E.ON
- 10.1. Unternehmerische Ausrichtung in den Kerngeschäftsfeldern
- 10.1.1. Energie
- 10.1.2. Chemie
- 10.1.3. Telekommunikation
- 10.1.4. Immobilien
- 10.1.5. Randaktivitäten
- 10.2. Finanzielle Ziele von E.ON
- 11. Konzernstruktur der E.ON AG nach der Fusion
- 11.1. Führungs- und Organisationsstruktur von E.ON
- 12. Umsetzung der Unternehmensstrategie
- 12.1. Desinvestitionen in den Jahren 2000 bis 2003
- 12.2. Investitionen in den Jahren 2000 bis 2003
- 12.3. Aktuelle Situation der E.ON AG
- 12.4. Aktuelle Konzernstruktur der E.ON AG
- 13. E.ON im Vergleich zum größten deutschen Wettbewerber RWE AG
- 14. Herausbildung eines faktischen Duopols
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Fusion von VEBA und VIAG zu E.ON. Ziel ist es, die kartellrechtlichen, finanzwirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte dieser bedeutenden Unternehmenszusammenführung zu beleuchten und die strategischen Überlegungen dahinter zu verstehen. Die Arbeit untersucht die Ausgangssituation beider Unternehmen, den Fusionsprozess selbst und die Folgen für den neu entstandenen Konzern.
- Kartellrechtliche Prüfung der Fusion
- Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Fusion
- Gesellschaftsrechtliche Aspekte der Fusion
- Strategische Ziele und Umsetzung der Fusion
- Marktpositionierung von E.ON nach der Fusion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kartellrechtliche Grundlagen für die Prüfung von Fusionen: Dieses Kapitel legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Prüfung von Fusionen dar, sowohl auf nationaler (Bundeskartellamt) als auch auf europäischer Ebene (EU-Wettbewerbskommission). Es definiert den Begriff der Marktbeherrschung und erläutert die Zuständigkeiten der jeweiligen Behörden bei der Bewertung der Auswirkungen einer Fusion auf den Wettbewerb. Die detaillierte Betrachtung des Marktbeherrschungsbegriffs dient als Grundlage für die spätere Analyse der E.ON-Fusion.
3. Ausgangssituation auf dem deutschen/europäischen Strommarkt: Dieses Kapitel beschreibt den europäischen und deutschen Strommarkt vor der Fusion von VEBA und VIAG. Es analysiert den Markt und seine Strukturen bevor die Fusion stattfand, um den Kontext der Fusion besser zu verstehen und die Beweggründe der beteiligten Unternehmen zu beleuchten. Die Analyse könnte Aspekte der Regulierung, der Marktliberalisierung und den Wettbewerbsumfeld einbeziehen, um die Ausgangssituation vollständig zu erfassen.
4. Ausgangssituation auf dem globalen Chemiemarkt: Ähnlich Kapitel 3, analysiert dieses Kapitel den globalen Chemiemarkt vor der Fusion. Es beleuchtet die Marktstrukturen, den Wettbewerb und die Positionierung von VEBA und VIAG in diesem Sektor. Eine Analyse der Marktanteile, der Wettbewerbsintensität und der strategischen Ausrichtung der Unternehmen im Chemiebereich ist hier zentral.
5. Status Quo Betrachtung von VEBA AG und VIAG AG: Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über die Unternehmensstrukturen und die strategische Ausrichtung von VEBA und VIAG vor der Fusion. Die historische Entwicklung beider Unternehmen, ihre jeweiligen Geschäftsfelder (Energie, Chemie etc.), und ihre Anteilseignerstrukturen werden beleuchtet. Die Analyse der individuellen Stärken und Schwächen beider Unternehmen bildet die Grundlage für das Verständnis der Synergieeffekte der geplanten Fusion.
6. Die Fusion VEBA/VIAG zu E.ON: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und beschreibt den Fusionsprozess selbst. Es analysiert die strategischen Vorteile der Fusion, die Synergiepotentiale (Marktsynergien und Kostensynergien) und den Weg zum Zusammenschluss, inklusive der Unternehmensbewertung und des Umtauschverhältnisses der Aktien. Das Kapitel beleuchtet den "Merger of equals"-Ansatz und die wesentlichen Schritte der Zusammenführung beider Unternehmen.
7. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: Dieses Kapitel untersucht die finanziellen Konsequenzen der Fusion für das neue Unternehmen E.ON. Es analysiert die relevanten Kennzahlen, die Bilanzierung und die Auswirkungen auf die Finanzkraft des fusionierten Konzerns. Die Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit, die Kapitalstruktur und die Investitionsmöglichkeiten werden ebenfalls thematisiert.
8. Gesellschaftsrechtliche Auswirkungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesellschaftsrechtlichen Aspekten der Fusion. Es beschreibt den Erlöschen der VIAG AG und den Umtausch der Aktien, die Beteiligungsverhältnisse in der neuen VEBA-VIAG AG und die Satzung des neu entstandenen Unternehmens. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Fusion und die damit verbundenen Prozesse werden detailliert dargestellt.
10. Unternehmerische Ausrichtung und Strategie von E.ON: Dieses Kapitel analysiert die strategische Ausrichtung und die Ziele von E.ON nach der Fusion. Es beschreibt die Geschäftsfelder (Energie, Chemie, Telekommunikation, Immobilien etc.) und die finanziellen Ziele des neuen Konzerns. Die langfristige Strategie des Unternehmens und die angestrebte Marktpositionierung werden hier beleuchtet.
11. Konzernstruktur der E.ON AG nach der Fusion: Dieses Kapitel beschreibt die Konzernstruktur von E.ON nach dem Abschluss der Fusion, inklusive der Führungs- und Organisationsstruktur. Die Hierarchien und die strategischen Entscheidungswege innerhalb des Konzerns werden hier dargestellt.
12. Umsetzung der Unternehmensstrategie: Dieses Kapitel analysiert die Umsetzung der Unternehmensstrategie von E.ON nach der Fusion, fokussiert auf Desinvestitionen und Investitionen in den Jahren 2000 bis 2003. Es zeigt, wie die Strategie in die Tat umgesetzt wurde und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die strategischen Ziele zu erreichen.
Schlüsselwörter
VEBA, VIAG, E.ON, Fusion, Unternehmenszusammenschluss, Kartellrecht, Fusionskontrolle, Marktbeherrschung, Finanzwirtschaft, Gesellschaftsrecht, Unternehmensstrategie, Synergieeffekte, Energiemarkt, Chemiemarkt, Konzernstruktur.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: VEBA/VIAG Fusion zu E.ON
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Fusion der VEBA AG und der VIAG AG zur E.ON AG. Sie beleuchtet die kartellrechtlichen, finanzwirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte dieser Fusion und untersucht die strategischen Überlegungen der beteiligten Unternehmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ausgangssituation beider Unternehmen (VEBA und VIAG), den Fusionsprozess selbst (einschließlich der kartellrechtlichen Prüfung), die Folgen für den neu entstandenen Konzern E.ON, die strategischen Ziele der Fusion, die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Marktpositionierung von E.ON nach der Fusion. Spezifische Bereiche umfassen die Analyse des deutschen und europäischen Strommarktes, des globalen Chemiemarktes, die Unternehmensstrukturen von VEBA und VIAG, die Synergieeffekte der Fusion, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen (Kennzahlen, Bilanzierung), gesellschaftsrechtliche Aspekte (Aktienumtausch, Satzung), die Konzernstruktur von E.ON und einen Vergleich mit dem Wettbewerber RWE.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die jeweils einen Aspekt der Fusion behandeln. Sie beginnt mit den kartellrechtlichen Grundlagen, beschreibt die Ausgangssituation auf den relevanten Märkten (Strom und Chemie), analysiert die Unternehmensstrukturen von VEBA und VIAG, detailliert den Fusionsprozess selbst, untersucht die finanzwirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen, beleuchtet die strategische Ausrichtung und Umsetzung der Strategie von E.ON, beschreibt die Konzernstruktur von E.ON nach der Fusion, und schließt mit einem Vergleich zu RWE und der Herausbildung eines faktischen Duopols ab.
Welche kartellrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die kartellrechtliche Prüfung der Fusion sowohl auf nationaler (Bundeskartellamt) als auch auf europäischer Ebene (EU-Wettbewerbskommission). Sie definiert den Begriff der Marktbeherrschung und analysiert die Zuständigkeiten der Behörden. Die kartellrechtlichen Auflagen der Fusion werden ebenfalls beleuchtet.
Welche finanzwirtschaftlichen Aspekte werden analysiert?
Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Fusion werden anhand relevanter Kennzahlen und der Bilanzierung des neuen Unternehmens E.ON untersucht. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen auf die Finanzkraft, die Kreditwürdigkeit, die Kapitalstruktur und die Investitionsmöglichkeiten.
Welche gesellschaftsrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die gesellschaftsrechtlichen Aspekte beinhalten den Erlöschen der VIAG AG, den Umtausch der Aktien, die Beteiligungsverhältnisse in der neuen E.ON AG, die Satzung des neuen Unternehmens und die Kosten des Zusammenschlusses.
Welche strategischen Ziele von E.ON werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die strategische Ausrichtung und die Ziele von E.ON nach der Fusion in den Kerngeschäftsfeldern (Energie, Chemie, Telekommunikation, Immobilien). Die finanziellen Ziele und die langfristige Strategie des Unternehmens werden beleuchtet.
Wie ist die Konzernstruktur von E.ON nach der Fusion dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Konzernstruktur von E.ON nach der Fusion, einschließlich der Führungs- und Organisationsstruktur. Die Hierarchien und strategischen Entscheidungswege werden dargestellt.
Wie wird die Umsetzung der Unternehmensstrategie von E.ON analysiert?
Die Umsetzung der Strategie wird anhand von Desinvestitionen und Investitionen in den Jahren 2000 bis 2003 analysiert. Die Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele werden dargestellt.
Wie wird E.ON mit dem Wettbewerber RWE verglichen?
Die Arbeit vergleicht E.ON mit dem größten deutschen Wettbewerber RWE AG und analysiert die Herausbildung eines faktischen Duopols.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
VEBA, VIAG, E.ON, Fusion, Unternehmenszusammenschluss, Kartellrecht, Fusionskontrolle, Marktbeherrschung, Finanzwirtschaft, Gesellschaftsrecht, Unternehmensstrategie, Synergieeffekte, Energiemarkt, Chemiemarkt, Konzernstruktur.
- Arbeit zitieren
- Andreas Schürmann (Autor:in), Oliver Forst (Autor:in), 2004, Die Fusion von VEBA und VIAG zu E.ON, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31262