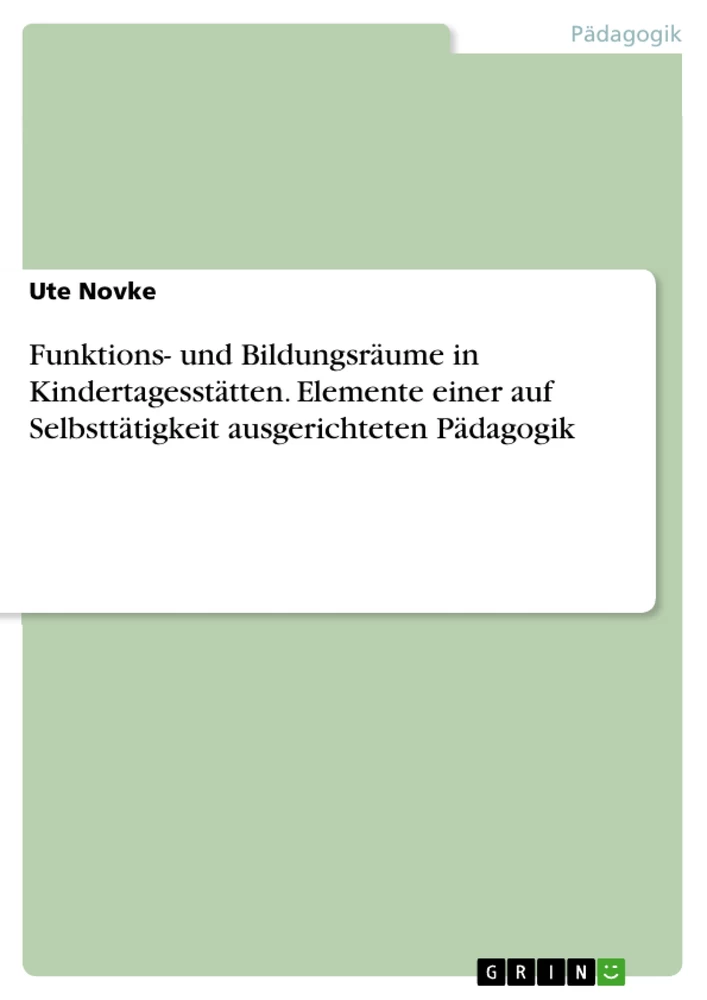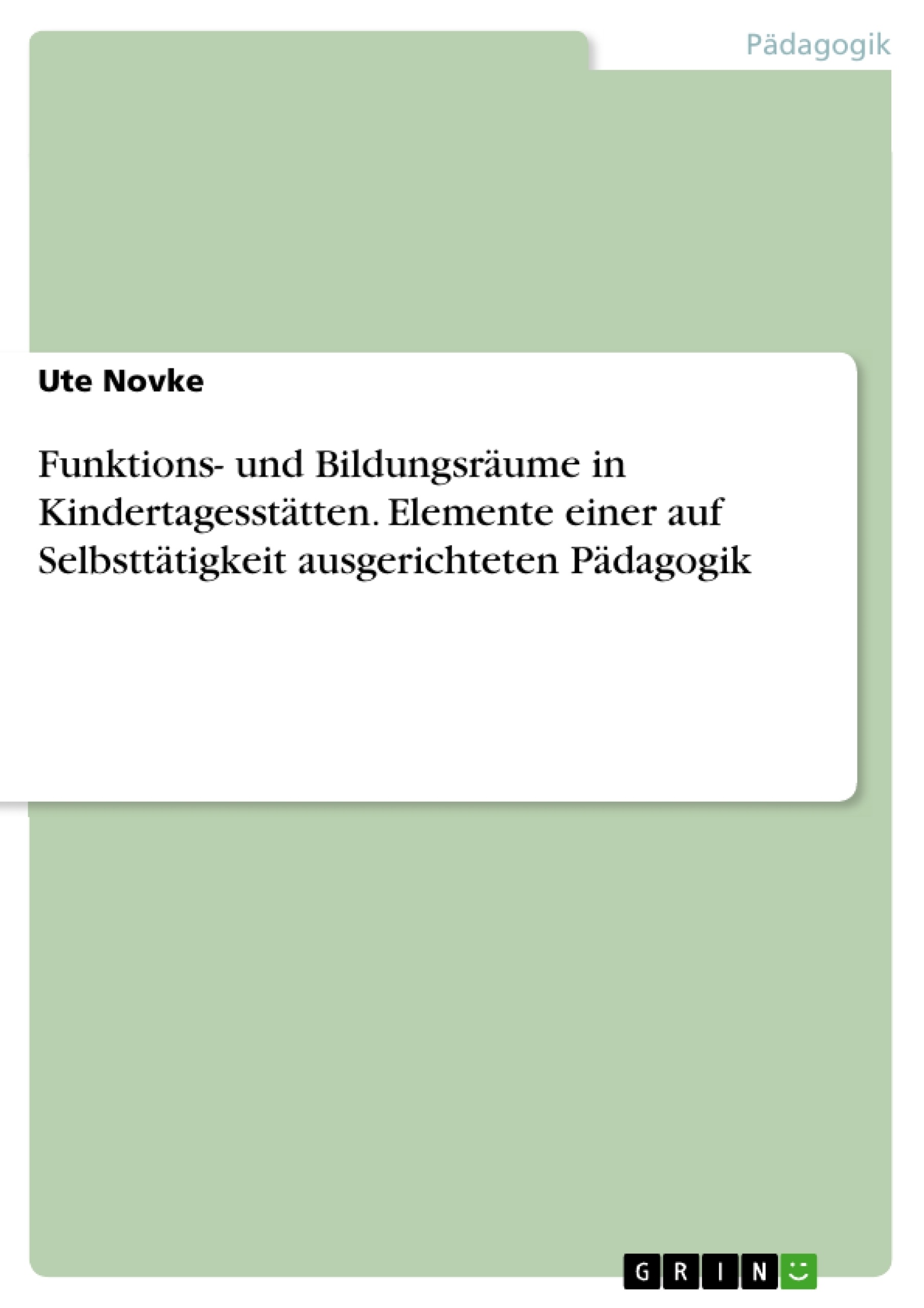Seit im Jahr 2006 der Neue Sächsische Bildungsplan für die Kindertagesstätten (im Folgenden Kita genannt) erstellt wurde, stellen sich viele Einrichtungen auf die neuen Herausforderungen in Bezug auf Erziehung und Bildung der anvertrauten Kinder ein. Die Dresdner städtischen Einrichtungen haben auf ein offenes Konzept umgestellt und die Kitas der freien Träger folgen nach.
Statt der althergebrachten Gruppenzimmer werden den Kindern Funktionsräume angeboten. Tägliche Angebote der Erzieher weichen selbstbestimmten Tätigkeiten der Kinder. Gruppenstrukturen werden teilweise oder ganz aufgelöst. Bildung wird neu betrachtet und die Verantwortung für das Lernen wird dem Lernenden selbst zurückübertragen(vgl. Sächsischer Bildungsplan, 2006: 5 ff.).
In der vorliegenden Hausarbeit wird der Frage nachgegangen, wie durch Raumgestaltungskonzepte Bildungsprozesse der Kinder angeregt und unterstützt werden können. Im ersten Teil der Arbeit werden der Bildungsbegriff erläutert und neue Erkenntnisse der Hirnforschung zu Entwicklungsaufgaben von Kindern zusammengefasst. Es wird aufgeführt, inwieweit diese Erkenntnisse das neue Bildungsverständnis der Kita und die Gestaltung von Funktionsräumen als Lern- und Erlebenswelt stützen. In der Ausarbeitung wird aufgezeigt, wie verschiedene Konzeptformen Raumnutzungsvarianten entwickeln, um die Lust der Kinder am Lernen und ihre aktive Neugier, sich Wissen anzueignen, zu nutzen.
Da meine Einrichtung sich konzeptionell neu orientiert, soll geprüft werden, welche Konzepte modernen Anforderungen genügen. Da auch die Öffnung der Gruppenräume ein Thema in meiner Kita ist, wird untersucht, wie Räume sinnvoll in spezielle Funktionsräume umgewandelt werden können und was dabei beachtet werden sollte. Dies wird am Beispiel von vier ausgewählten Funktionsräumen aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Entwicklungsaufgaben in der Kindheit
- 1.1 Der Begriff Bildung
- 1.2 Konsequenzen für die Gestaltung von Räumen in Kitas
- 2. Neurobiologische Erkenntnisse zur Anregung von Bildungsprozessen
- 2.1 Erkenntnisse der Hirnforschung
- 2.2 Konsequenzen für die Arbeit in den Kitas
- 3. Bildungs- und Raumnutzungskonzepte ausgewählter pädagogischer Ansätze in Kitas
- 3.1 Der Situationsansatz
- 3.2 Die Reggio-Pädagogik
- 3.3 Der INFANS-Bildungsansatz
- 3.4 Der Ansatz der Montessoripädagogik
- 4. Der Raum als Bildungsraum
- 4.1 Raumaufteilung nach Funktionen
- 4.1.1 Bewegungsräume
- 4.1.2 Ruheräume
- 4.1.3 Raum für Rollenspiel
- 4.1.4 Räume zur ganzheitlichen Kreativitätsförderung
- 4.2 Akkustik, und Licht in Räumen
- 4.1 Raumaufteilung nach Funktionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie Raumgestaltungskonzepte in Kindertagesstätten (Kitas) die Bildungsprozesse von Kindern anregen und unterstützen können.
- Der Bildungsbegriff und seine Relevanz für die Gestaltung von Lernumgebungen
- Neurobiologische Erkenntnisse über die Entwicklung von Kindern und ihre Auswirkungen auf die Gestaltung von Räumen
- Verschiedene pädagogische Ansätze und ihre Raumgestaltungskonzepte
- Die Bedeutung von Funktionsräumen für die Förderung von Selbsttätigkeit und Bildung
- Die Rolle von Raumgestaltungselementen wie Akustik und Licht
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Raumgestaltung in Kitas ein und erläutert den aktuellen Wandel hin zu einem stärker auf Selbsttätigkeit ausgerichteten Bildungsverständnis. Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Entwicklungsaufgaben von Kindern und dem Bildungsbegriff. Hierbei wird die Bedeutung von Bildung für die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Kindern hervorgehoben. Kapitel 2 analysiert neurobiologische Erkenntnisse zur Anregung von Bildungsprozessen. Es wird betont, dass Kinder unterschiedliche Lernbedürfnisse haben und die Lernumgebung individuell an diese angepasst werden muss. Kapitel 3 untersucht die Bildungs- und Raumnutzungskonzepte verschiedener pädagogischer Ansätze wie den Situationsansatz, die Reggio-Pädagogik, den INFANS-Bildungsansatz und die Montessoripädagogik. Kapitel 4 befasst sich mit der Bedeutung von Räumen als Bildungsräume und geht auf die spezifischen Anforderungen an die Gestaltung von Funktionsräumen wie Bewegungsräume, Ruheräume, Räume für Rollenspiel und Räume zur ganzheitlichen Kreativitätsförderung ein. Darüber hinaus werden die Bedeutung von Akustik und Licht in Räumen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Bildung, Raumgestaltung, Kindertagesstätten, Funktionsräume, Selbsttätigkeit, neurobiologische Erkenntnisse, pädagogische Ansätze, Situationsansatz, Reggio-Pädagogik, INFANS-Bildungsansatz, Montessoripädagogik, Bewegungsraum, Ruheräume, Rollenspiel, Kreativität, Akustik, Licht.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Funktionsräume in einer Kita?
Funktionsräume sind spezialisierte Bereiche (z.B. Bauecke, Kunstatelier, Bewegungsraum), die Kindern gezielte Bildungsanreize bieten und das klassische Gruppenzimmer ersetzen.
Wie unterstützt Raumgestaltung Bildungsprozesse?
Ein gut gestalteter Raum fungiert als „dritter Erzieher“, indem er zur Selbsttätigkeit anregt, Neugier weckt und unterschiedliche Lernbedürfnisse anspricht.
Welche Rolle spielt die Hirnforschung für Kita-Konzepte?
Neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass Kinder am besten durch aktives Handeln und in einer anregenden Umgebung lernen, was das offene Konzept stützt.
Was ist der INFANS-Bildungsansatz?
Dieser Ansatz fokussiert auf die Beobachtung der Interessen der Kinder und die daraus abgeleitete Gestaltung von individuellen Bildungsangeboten.
Warum sind Ruheräume in Kitas wichtig?
Neben Aktivität benötigen Kinder Rückzugsorte zur Entspannung und Verarbeitung von Reizen, um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten.
- Arbeit zitieren
- Ute Novke (Autor:in), 2014, Funktions- und Bildungsräume in Kindertagesstätten. Elemente einer auf Selbsttätigkeit ausgerichteten Pädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312626