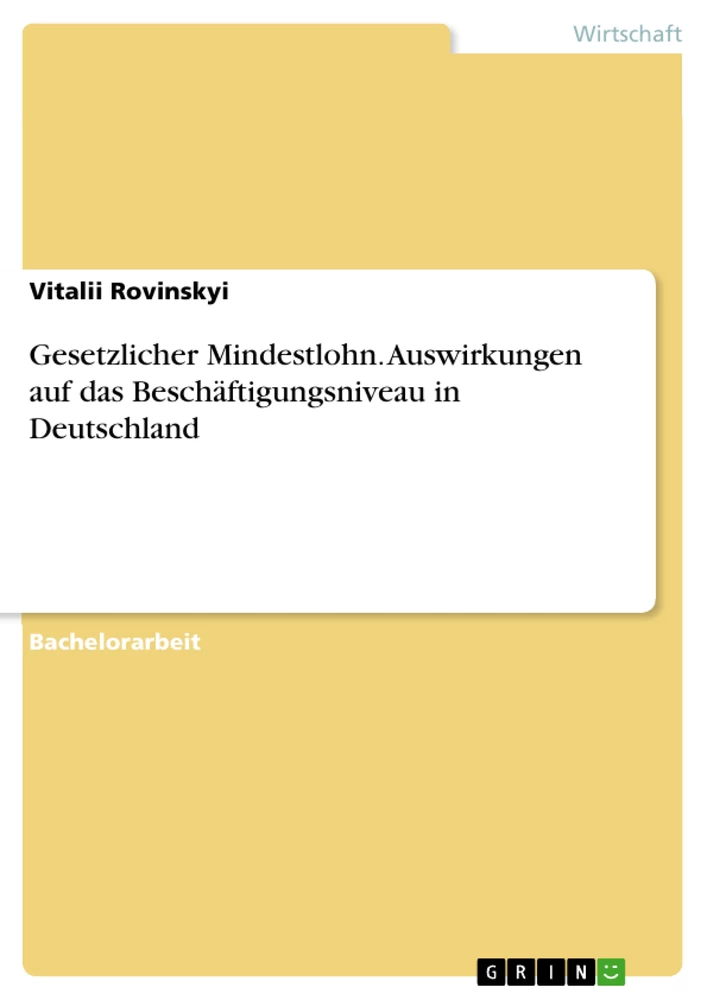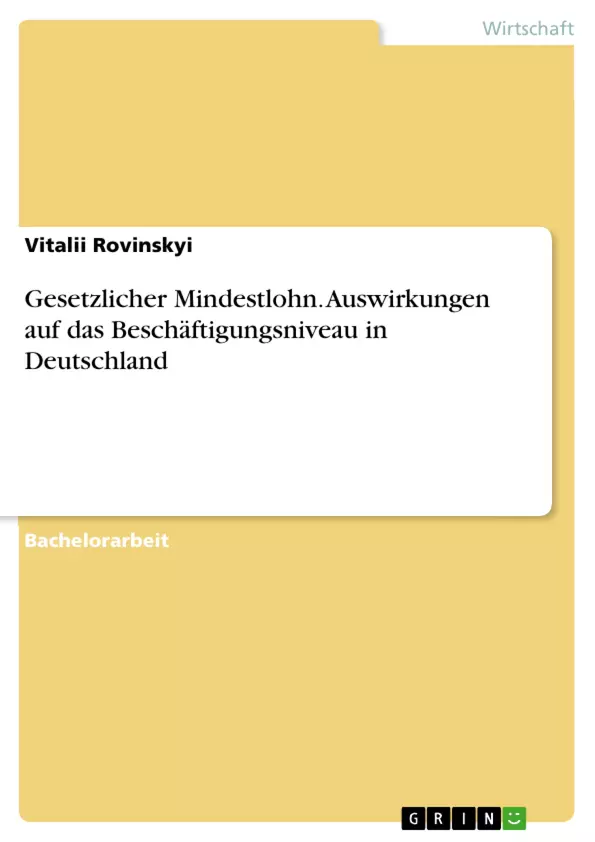Im Jahr der Bundestagswahl 2013 war die schon seit Jahrzehnten geführte Mindestlohn-Debatte aktuell wie nie. Im Hinblick auf die Lohnentwicklung in Deutschland ist dies auch wenig verwunderlich: Während 2006 der Anteil der
Beschäftigten mit Niedriglohn noch bei 18,7 % lag, arbeiteten 2010 bereits 20,6 % aller Beschäftigten in Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten für einen Niedriglohn. Damit hat Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Auch die Lohnschere zwischen Arm und Reich wird immer größer. So ist bei der Deutschen Bank AG das Lohnverhältnis zwischen Managern und den dort tätigen Arbeitnehmern von 50:1 im Jahr 1997 auf 240:1 im Jahr 2003 gestiegen.
Diese Missstände versucht die Politik durch Lohnregulierungen zu beheben. Nach langwierigen Verhandlungen ist nunmehr ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn i. H. v. 8,50 € brutto je Stunde, der zum 1. Januar 2015 eingeführt werden und zum 1. Januar 2017 uneingeschränkt gelten, insbesondere die unter dieser Mindestgrenze liegenden tariflichen Regelungen ablösen, soll, Gegenstand des Schwarz-Roten Koalitionsvertrags. Die Mindestlohneinführung soll nach seiner Zielsetzung einen angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmer gewährleisten. Gute Arbeit müsse sich lohnen und existenzsichernd sein, darin sind sich die Koalitionspartner einig. Während die Mindestlohn-Befürworter darin eine wirkungsvolle Maßnahme gegen "Armutslöhne" sehen, sprechen die Gegner von einem "Arbeitsplatzvernichtungsprogramm". Letztlich geht es bei der kontroversen Debatte also um die Frage nach den Auswirkungen einer Mindestlohneinführung auf das Beschäftigungsniveau in Deutschland.
Mittlerweile liegt bereits ein Gesetzesentwurf eines Tarifautonomiestärkungsgesetzes der Bundesregierung vor, das zum Ziel hat, "die Tarifautonomie zu stärken und angemessene Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherzustellen". Im Hinblick auf diese fortgeschrittene Entwicklung besteht Anlass, sich noch einmal mit der Funktionalität und den voraussichtlichen Auswirkungen eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigungssituation in Deutschland auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Bestandsaufnahme
- 2.1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung
- 2.2 Anzahl und Struktur der voraussichtlich Betroffenen
- 3. Verfassungsmäßigkeit eines gesetzlichen Mindestlohns
- 3.1 Eingriff in die Koalitionsfreiheit
- 3.2 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- 3.2.1 Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum
- 3.2.2 Verhältnismäßigkeit
- 3.2.3 Stabilität der sozialen Sicherungssysteme
- 4. Mindestlohn im Lichte der ökonomischen Theorien
- 4.1 Mindestlohn nach der Klassisch-Neoklassischen Theorie
- 4.1.1 Ausgangspunkt
- 4.1.2 Auswirkungen der Mindestlohneinführung
- 4.1.3 Kritische Bewertung des Modells
- 4.1.3.1 Veränderte Arbeitsangebotskurve
- 4.1.3.2 Substitutionseffekte
- 4.1.3.3 Steigung der Produktivität
- 4.1.3.4 Monopsonbildung
- 4.2 Mindestlohn nach der Keynesianischen Theorie
- 4.2.1 Ausgangspunkt
- 4.2.2 Auswirkungen der Mindestlohneinführung
- 5. Empirische Untersuchungen
- 5.1 Weltweite Studien zum Mindestlohn
- 5.1.1 Mindestlohn in Europa
- 5.1.2 Weltweite Studienergebnisse
- 5.1.2.1 Erfahrungen aus den USA
- 5.1.2.2 Europäische Studien
- 5.1.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Evaluationen der Branchenmindestlöhne nach dem AEntG
- 5.2.1 Evaluationsmethode
- 5.2.2 Evaluationsergebnisse
- 5.2.3 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auf das Beschäftigungsniveau in Deutschland. Ziel ist es, die ökonomischen Theorien zum Mindestlohn zu beleuchten und diese mit empirischen Studien zu vergleichen. Die Arbeit analysiert sowohl die verfassungsrechtlichen Aspekte als auch die praktischen Folgen einer solchen Maßnahme.
- Wirtschaftswissenschaftliche Theorien zum Mindestlohn (klassisch-neoklassisch und keynesianisch)
- Verfassungsrechtliche Aspekte eines Mindestlohns
- Empirische Befunde zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigung
- Analyse des deutschen Gesetzesentwurfs zum Mindestlohn
- Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftssektoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland ein und beschreibt die Problemstellung. Es skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Arbeit, um den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten und den Kontext der Untersuchung zu etablieren. Die Problemstellung wird klar definiert und die Relevanz der Forschungsfrage hervorgehoben.
2. Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Mindestlohn und analysiert die Anzahl und Struktur der voraussichtlich betroffenen Arbeitnehmer. Es bildet die Grundlage für die spätere ökonomische und verfassungsrechtliche Analyse, indem es den aktuellen Stand der Gesetzgebung und die betroffenen Bevölkerungsgruppen detailliert beschreibt. Die Zahlen und Daten dienen als Basis für die folgenden Kapitel, die die potentiellen Auswirkungen des Mindestlohns untersuchen.
3. Verfassungsmäßigkeit eines gesetzlichen Mindestlohns: In diesem Kapitel wird die Vereinbarkeit eines gesetzlichen Mindestlohns mit dem Grundgesetz untersucht. Es werden die potentiellen Eingriffe in die Koalitionsfreiheit analysiert und die verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsgrundlagen, wie das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, detailliert beleuchtet. Die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme im Kontext des Mindestlohns wird ebenfalls kritisch hinterfragt. Diese Analyse ist essentiell, um die rechtliche Grundlage der Mindestlohnpolitik zu verstehen.
4. Mindestlohn im Lichte der ökonomischen Theorien: Dieses Kapitel vergleicht die Vorhersagen der klassischen und keynesianischen Wirtschaftstheorie bezüglich der Auswirkungen eines Mindestlohns. Es werden die unterschiedlichen Modellannahmen und ihre Implikationen für den Arbeitsmarkt detailliert dargestellt. Die kritische Bewertung der Modelle umfasst die Analyse von Substitutionseffekten, Produktivitätsänderungen und der Möglichkeit von Monopsonbildung. Die Gegenüberstellung der theoretischen Ansätze bereitet den Boden für die Bewertung der empirischen Ergebnisse in den folgenden Kapiteln.
5. Empirische Untersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert empirische Studien zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen weltweit, mit einem Fokus auf Europa und den USA. Es analysiert die Evaluationsmethoden und Ergebnisse von Branchenmindestlöhnen im Kontext des deutschen Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG). Die Zusammenfassung der Ergebnisse liefert wichtige Evidenz für die Bewertung der theoretischen Modelle und die Schlussfolgerungen der Arbeit. Die kritische Betrachtung der Methodik verschiedener Studien ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Beschäftigung, Deutschland, ökonomische Theorien, Verfassungsmäßigkeit, empirische Studien, Arbeitsmarkt, Keynesianismus, Neoklassik, AEntG, Koalitionsfreiheit, Existenzminimum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auf das Beschäftigungsniveau in Deutschland. Sie beleuchtet ökonomische Theorien, vergleicht diese mit empirischen Studien und analysiert verfassungsrechtliche Aspekte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt wirtschaftswissenschaftliche Theorien zum Mindestlohn (klassisch-neoklassisch und keynesianisch), verfassungsrechtliche Aspekte, empirische Befunde zu den Auswirkungen auf die Beschäftigung, den deutschen Gesetzesentwurf und die potenziellen Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftssektoren.
Welche ökonomischen Theorien werden untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Vorhersagen der klassischen und keynesianischen Wirtschaftstheorie bezüglich der Auswirkungen eines Mindestlohns. Sie analysiert die Modellannahmen und deren Implikationen für den Arbeitsmarkt, inklusive Substitutionseffekten, Produktivitätsänderungen und der Möglichkeit von Monopsonbildung.
Wie werden die verfassungsrechtlichen Aspekte behandelt?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit eines gesetzlichen Mindestlohns mit dem Grundgesetz. Sie analysiert potentielle Eingriffe in die Koalitionsfreiheit und beleuchtet verfassungsrechtliche Rechtfertigungsgrundlagen wie das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme wird ebenfalls betrachtet.
Welche empirischen Studien werden berücksichtigt?
Die Arbeit präsentiert empirische Studien zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen weltweit, mit Fokus auf Europa und den USA. Sie analysiert Evaluationsmethoden und Ergebnisse von Branchenmindestlöhnen im Kontext des deutschen Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung und Vorgehensweise), Bestandsaufnahme (Gesetzesentwurf und betroffene Arbeitnehmer), Verfassungsmäßigkeit, Mindestlohn im Lichte ökonomischer Theorien und empirische Untersuchungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mindestlohn, Beschäftigung, Deutschland, ökonomische Theorien, Verfassungsmäßigkeit, empirische Studien, Arbeitsmarkt, Keynesianismus, Neoklassik, AEntG, Koalitionsfreiheit, Existenzminimum.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes einzelnen Kapitels und dessen Beitrag zur Gesamtargumentation der Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit ergeben sich aus der Zusammenfassung der empirischen Befunde und der Gegenüberstellung mit den ökonomischen Theorien und verfassungsrechtlichen Aspekten. Diese werden im letzten Kapitel (Kapitel 5) detailliert dargestellt.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit den Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland auseinandersetzen möchten. Sie ist insbesondere für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften relevant.
- Arbeit zitieren
- Vitalii Rovinskyi (Autor:in), 2014, Gesetzlicher Mindestlohn. Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313050