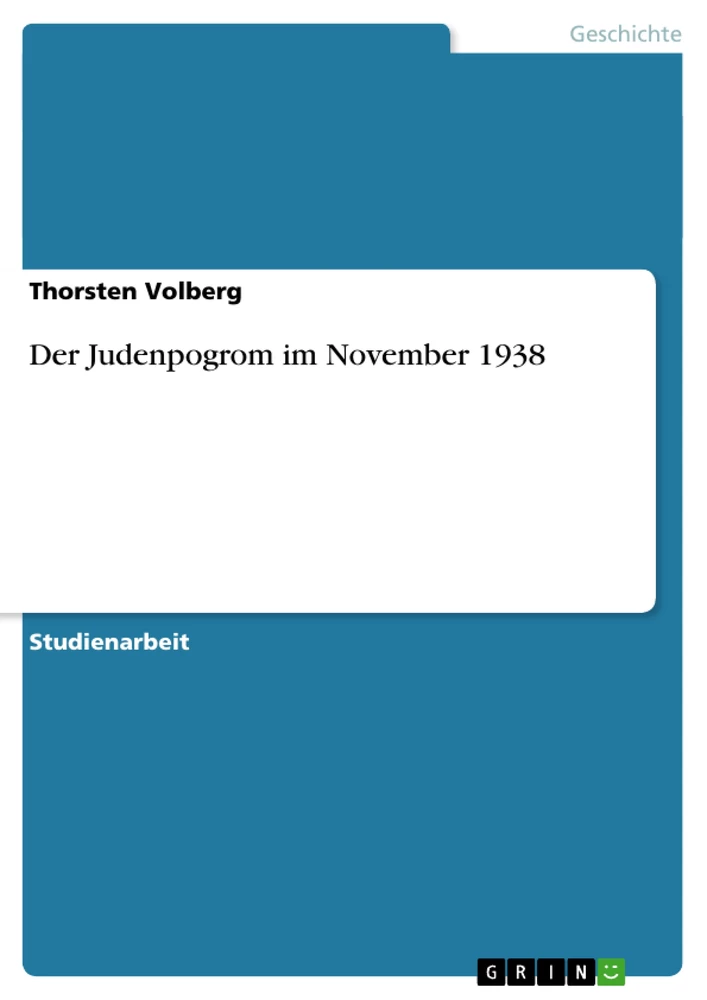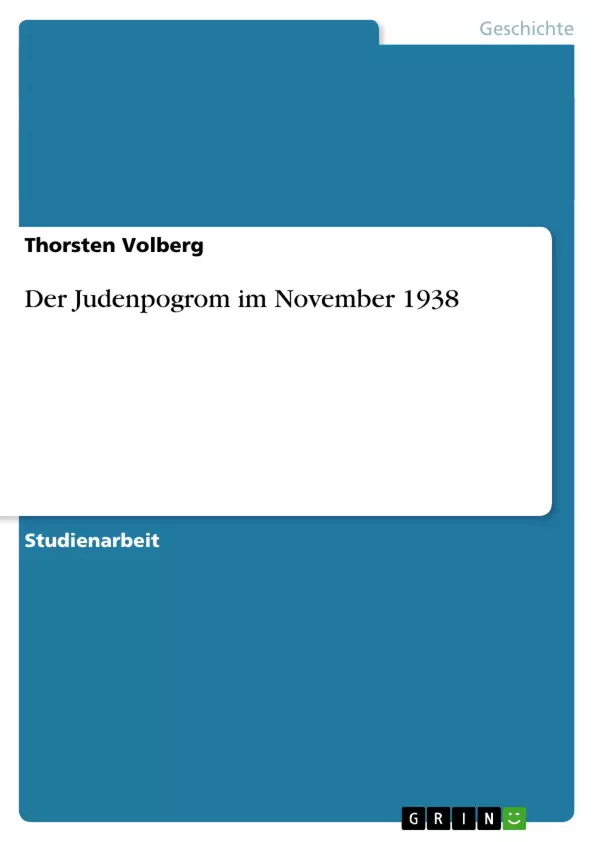Der in den 30er und 40er Jahren begangene Völkermord an den deutschen und europäischen Juden ist einer der dunkelsten Kapitel in der Geschichte der gesamten Menschheit. Selbst ein unglaublich hohes Maß an Vorstellungskraft kann einem die Dimension dieser schleichenden, aber dennoch systematischen und im Laufe der Zeit fast perfektionierten Ausgrenzung und Ermordung einer ganzen Bevölkerungsgruppe nur schwer begreiflich machen. Es war eine Zeit, in der unter der nationalsozialistischen Regierung im Deutschen Reich die Verfolgung der Juden ein noch nie dagewesenes Ausmaß annahm. Allein aus diesem Grund wird jüdisches Leben in Deutschland zwangsläufig immer mit den Bildern aus den Konzentrationslagern, den Deportationen und den Gaskammern in Verbindung gebracht werden. Doch wie das Leben der jüdischen Bevölkerung im nationalsozialistischen Alltag vor Beginn des zweiten Weltkriegs aussah, wissen nur wenige. Gerade aber dieser Zeitraum ist enorm wichtig, um überhaupt einen Bezug zu diesen schrecklichen Ereignissen und den oft irreal wirkenden Bildern zu bekommen. Sich nun ein Bild vom Alltagsleben der 30er Jahre machen zu wollen, bleibt immer mit der Schwierigkeit verbunden, dass es aus einer Gesellschaft heraus geschieht, in der jüdische Gemeinden in deutschen Städten nur noch wenig präsent sind. Man muss versuchen, sich gedanklich von einer Gesellschaft zu lösen, in der nicht zuletzt Meinungs- und Glaubensfreiheit zu den Grundrechten der Bevölkerung zählen und sich nun in einen Alltag hineindenken, der geprägt ist von Angst und Terror, von Verfolgung und politisch gewollter Diskriminierung. Doch es wird immer schwer sein, in einer Zeit, in der politischer Extremismus in bundesdeutschen Parlamenten kaum vertreten ist, auch nur annähernd ein Gefühl für das Leben unter einem diktatorischen Regime zu bekommen. Es ist aber dennoch möglich, diese fast unüberwindbare Distanz zwischen den allgemeinen Erläuterungen in den Geschichtsbüchern und dem tatsächlich vom Einzelnen Erlebten, mit Hilfe von staatlichen und nicht-staatlichen Geheimberichten, Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, zumindest teilweise zu überbrücken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herkunft des Antisemitismus
- Die Vorgeschichte der jüdischen Bevölkerung
- Die europäischen Juden vor dem 1. Weltkrieg
- Die jüdische Bevölkerung in der Weimarer Republik
- Die Juden und die NS-Rassenideologie
- Die jüdische Bevölkerung in der nationalsozialistischen Gesellschaft
- Die „Judenpolitik“ der Nationalsozialisten
- Der Beginn 1933
- Die Nürnberger Gesetze
- Der Judenpogrom 1938
- Die Vorgeschichte
- Der Beginn
- Der „Volkszorn“
- Brennende Synagogen
- Mord
- Die Tage nach dem Pogrom
- Reaktionen der Bevölkerung
- Die Hilfsbereitschaft als Randerscheinung
- Fazit
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet den Judenpogrom im November 1938 und versucht, diesen historischen Wendepunkt in der „Judenpolitik“ der Nationalsozialisten in den Kontext des Alltagslebens im nationalsozialistischen Deutschland zu stellen. Sie untersucht die Vorgeschichte der Judenverfolgung, die Rolle des Antisemitismus und der NS-Rassenideologie sowie die Reaktionen der Bevölkerung auf den Pogrom.
- Der Judenpogrom als Wendepunkt in der NS-Judenpolitik
- Die Rolle von Antisemitismus und NS-Rassenideologie
- Die Situation der jüdischen Bevölkerung im nationalsozialistischen Alltag
- Die Reaktionen der Bevölkerung auf den Pogrom
- Die Bedeutung des Pogroms für das Verständnis des Holocausts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung des Pogroms im November 1938 im Kontext der NS-Judenpolitik. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Geschichte des Antisemitismus, wobei die Rolle von Vorurteilen und nationalistischem Denken im Vordergrund steht. Das dritte Kapitel beleuchtet die Geschichte der europäischen Juden, insbesondere in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik. Die Kapitel 4 und 5 betrachten die Juden und die NS-Rassenideologie sowie die Situation der jüdischen Bevölkerung in der nationalsozialistischen Gesellschaft. Das sechste Kapitel behandelt die „Judenpolitik“ der Nationalsozialisten, wobei der Schwerpunkt auf dem Beginn 1933 und den Nürnberger Gesetzen liegt.
Das siebte Kapitel widmet sich dem Judenpogrom 1938 selbst. Es beleuchtet die Vorgeschichte, den Beginn, die Eskalation zum „Volkszorn“, die Brandlegung von Synagogen und die Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung. Das achte Kapitel befasst sich mit den Tagen nach dem Pogrom und den Reaktionen der Bevölkerung. Es wird auch die Bedeutung der Hilfsbereitschaft als Randerscheinung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Judenpogrom 1938, der NS-Judenpolitik, Antisemitismus, Rassenideologie, Nationalsozialismus, Holocaust, Alltagsleben, Reaktionen der Bevölkerung, Hilfsbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah beim Judenpogrom im November 1938?
Im November 1938 kam es zu systematischen Gewalttaten gegen die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich, bei denen Synagogen in Brand gesetzt, Geschäfte zerstört und Menschen ermordet oder in Konzentrationslager deportiert wurden.
Warum gilt der Pogrom als Wendepunkt in der NS-Judenpolitik?
Der Pogrom markierte den Übergang von der diskriminierenden Ausgrenzung hin zur offenen, gewaltsamen Verfolgung und systematischen Zerstörung der jüdischen Existenzgrundlage.
Welche Rolle spielte die NS-Rassenideologie?
Die Rassenideologie lieferte die pseudowissenschaftliche Rechtfertigung für den Antisemitismus und die systematische Vernichtung jüdischen Lebens als politisches Ziel.
Wie reagierte die deutsche Bevölkerung auf die Ereignisse?
Die Reaktionen reichten von aktiver Beteiligung und Zustimmung bis hin zu passivem Zusehen. Hilfsbereitschaft gegenüber den Opfern blieb eine seltene Randerscheinung.
Was waren die Nürnberger Gesetze?
Die 1935 erlassenen Gesetze bildeten die rechtliche Basis für die rassistische Diskriminierung und den Entzug der Staatsbürgerrechte für Juden in Deutschland.
Wie sah der Alltag jüdischer Bürger vor dem Pogrom aus?
Der Alltag war bereits vor 1938 durch zunehmende soziale Isolation, wirtschaftliche Diskriminierung und ständige Angst vor staatlichen Repressionen geprägt.
- Citation du texte
- Thorsten Volberg (Auteur), 2000, Der Judenpogrom im November 1938, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31312