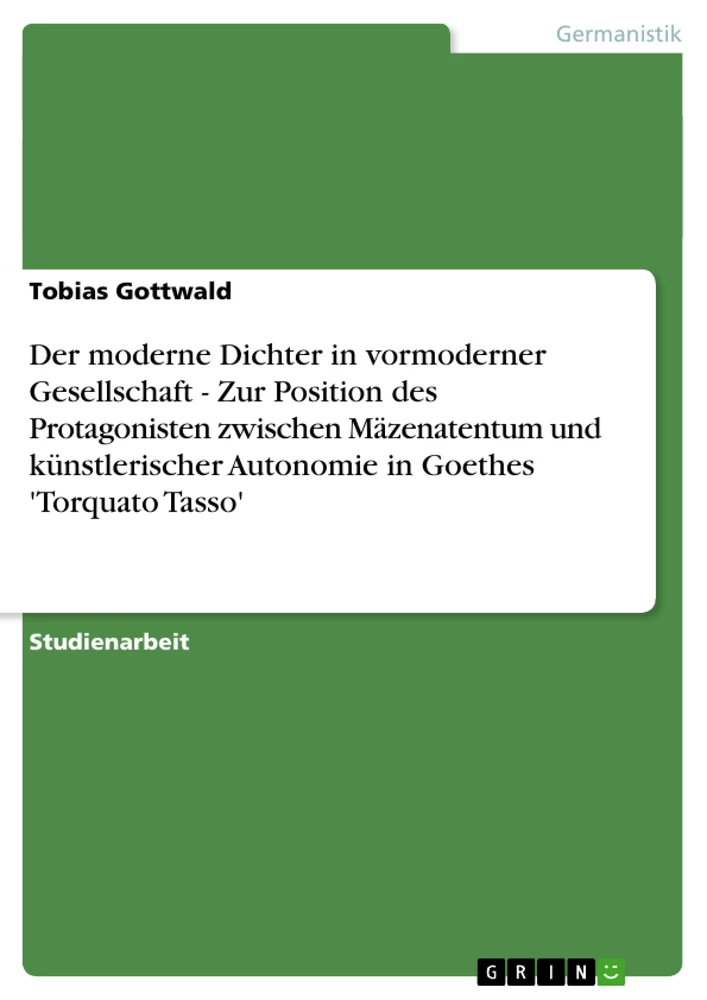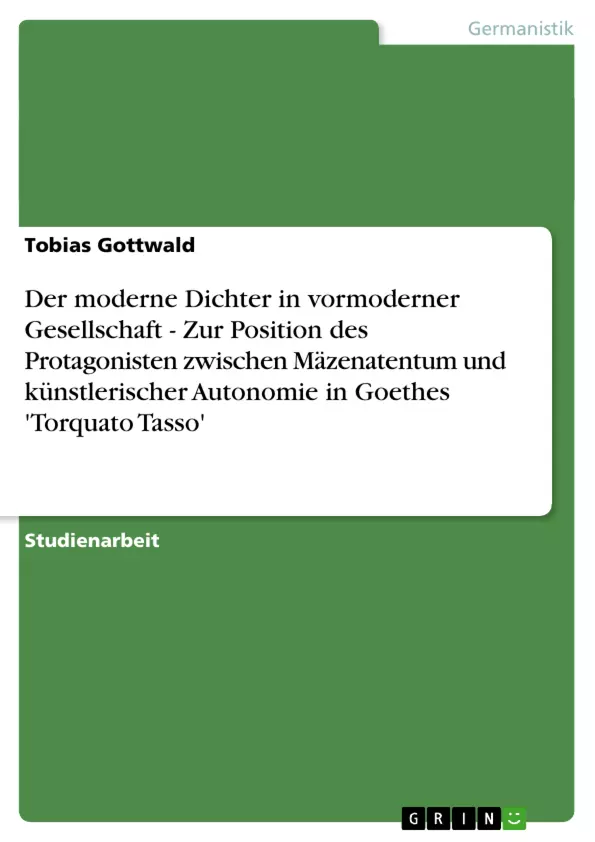Goethes „Torquato Tasso“ gilt als erstes Künstlerdrama der Weltliteratur. Nie zuvor ist die Existenz
eines Künstlercharakters als Grundgedanke einer dramatischen Dichtung problematisiert worden. 1
Die neuartige Konzentration auf die Innerlichkeit und die damit einhergehende Armut an äußerer
Handlung rief unter den zeitgenössischen Kritikern bei aller Anerkennung auch tadelnde Töne
hervor. So kommt ein Rezensent der Leipziger „Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften“ im
Jahre 1790, also ein Jahr nach der Drucklegung zu dem Ergebnis, „Torquato Tasso“ sei kein
eigentliches „Drama in Aristoteles’ Sinn“, sondern „nichts weiter [...] als eine dramatische
Schilderung eines Charakters“. 2 Neben der Konzentration auf die Innerlichkeit des Protagonisten ist die zeitliche Situierung des Dramas von zentraler Bedeutung. Es ist, wie Borchmeyer formuliert, „am fiktiven Schnittpunkt zweier Zeitalter angesiedelt.“ Dabei entscheidend ist „die Spannung zwischen der vo m ästhetischen
Autonomieprinzip bestimmten (bürgerlichen) Poesie respektive Dichterexistenz und der (feudal-
)höfischen Welt mit ihren spezifischen Ansprüchen an die Künste und den Küns tler“.3
Schon die ältere Forschung, insbesondere die bedeutende Monographie von Wolfdietrich Rasch
(1954) und die Tasso-Interpretation von Wilkinson (1962), hat Tasso als beispielhafte Dichterfigur
gedeutet. Dabei versteht Rasch die Dichterkrönung als eigentlichen Anstoß der dramatischen
Handlung, die die „rätselvolle, schwer durchschaubare“ Problematik des Künstlers und seine
tragische Existenz veranschauliche.4 Hierbei aber wurde die Bedeutung der höfischen Umwelt mit
ihrer spezifischen Erwartungshaltung nicht ausreichend aufgearbeitet. Die Hofwelt erscheint nur als
Hintergrund und Widerstand.5 Gerhard Kaiser (1977) stellt in seiner Studie erstmals den Konflikt von Dichter und Gesellschaft in den Mittelpunkt. Er greift dabei die von Rasch und Wilkinson vorgebrachten Deutungen Tassos auf,
verfeinert sie aber, indem er Tasso nicht nur als paradigmatischen Dichter, sondern als einen
spezifisch modernen Dichter versteht. [...] 1 Vgl. Borchmeyer (1982) S. 139 f. und (1998) S. 168 f. 2 Rezension der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften (Leipzig, 1790); zit. nach HA (2000) Bd. V, S. 501. 3 Borchmeyer (1982) S. 139 f. 4 Vgl. Hinderer (1997), S. 243. 5 Kaiser (1977), S. 175 f.
Inhaltsverzeichnis
- I1. Einleitung.
- 2. Hauptteil....
- 2.1. Repräsentation und Divertissement - Zum Horizont höfischer Erwartung an die Poesie und den Poeten........3
- 2.2. Tasso als,moderner' Dichter...\n.7
- 2.2.1. Zum Begriff des Modernen...\n.7
- 2.2.2. Moderne und Autonomiestreben in „Torquato Tasso\"..\n9
- 2.2.3. Symbolik..\n14
- I. Lorbeer und Dichterkrönung
- II. Die Seidenwurm-Metapher
- 2.2.4. Der Genie-Gedanke als Signum moderner Dichterexistenz....\n.17
- 3. Schluß.
- 4. Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Problematik des nach Autonomie strebenden Künstlers im Spannungsfeld feudalen Mäzenatentums und künstlerischer Freiheit, am Beispiel von Goethes „Torquato Tasso“. Sie untersucht die Frage, inwiefern die Gegensätzlichkeit von Dichter und Hof mit der Antinomie von "modern" und "vormodern" korrespondiert und Tasso als ein "moderner" Dichter bezeichnet werden kann.
- Analyse der Kunstauffassung des ferraresischen Hofes und deren Erwartungshaltung an Dichter und Dichtung.
- Untersuchung der Figur Tassos und seines Kunstverständnisses.
- Theoretische Abgrenzung des Begriffs "Modernes" und dessen Anwendung auf das Drama.
- Analyse der Symbolik des Schauspiels im Hinblick auf eine "moderne" oder "autonome" Kunstauffassung.
- Bedeutung des Genie-Gedankens im Kontext der künstlerischen Autonomie.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Bedeutung von Goethes „Torquato Tasso“ als erstem Künstlerdrama der Weltliteratur und beleuchtet die Kontroversen um das Stück, insbesondere die Konzentration auf die Innerlichkeit des Protagonisten und die Armut an äußerer Handlung. Außerdem wird die zeitliche Situierung des Dramas am „fiktiven Schnittpunkt zweier Zeitalter“ und die Spannung zwischen der "bürgerlichen Poesie" und der "höfischen Welt" hervorgehoben. Die Einleitung führt weiter die Forschung zu "Torquato Tasso" von Rasch, Wilkinson, Kaiser, Girschner, Vaget, Borchmeyer, Reed und Hinderer an, die sich mit der Problematik des Künstlers in der Gesellschaft und dem Konflikt zwischen künstlerischer Autonomie und den Erwartungen des Hofes auseinandersetzen.
Kapitel 2.1 analysiert die Kunstauffassung des ferraresischen Hofes und stellt die Erwartungen an die Poesie und den Poeten dar. Die Studie beleuchtet den politischen Hintergrund und die Bedeutung des Mäzenatentums für die Selbstdarstellung des Hofes. Der utilitaristische Charakter der Kunstauffassung des Hofes wird deutlich, Kunst wird als Mittel der Repräsentation und Glorifizierung des Fürsten verstanden.
Schlüsselwörter
Goethe, Torquato Tasso, Künstlerdrama, Künstlercharakter, Autonomie, Mäzenatentum, höfisches Erwartungshorizont, Kunstauffassung, Modernes, Vormodernes, Genie-Gedanke, Symbolik, Repräsentation, Divertissement.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Goethes "Torquato Tasso" als Künstlerdrama?
Es ist das erste Drama der Weltliteratur, das die Existenz und die innere Problematik eines Künstlers zum zentralen Thema macht.
Was ist der Hauptkonflikt im Stück?
Der Konflikt liegt im Spannungsfeld zwischen dem Streben nach künstlerischer Autonomie und den utilitaristischen Erwartungen des höfischen Mäzenatentums.
Inwiefern ist Tasso ein "moderner" Dichter?
Tasso verkörpert den modernen Genie-Gedanken und das Bedürfnis nach subjektiver Freiheit, was im Gegensatz zur vormodernen, repräsentativen Hofwelt steht.
Welche Symbole werden in der Arbeit analysiert?
Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Symbole des Lorbeers (Dichterkrönung) und die Seidenwurm-Metapher.
Was erwartete der Hof von Ferrara von der Kunst?
Kunst diente dem Hof primär als Mittel der Repräsentation, zur Glorifizierung des Fürsten und als gehobener Zeitvertreib (Divertissement).
- Citar trabajo
- Tobias Gottwald (Autor), 2003, Der moderne Dichter in vormoderner Gesellschaft - Zur Position des Protagonisten zwischen Mäzenatentum und künstlerischer Autonomie in Goethes 'Torquato Tasso', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31323