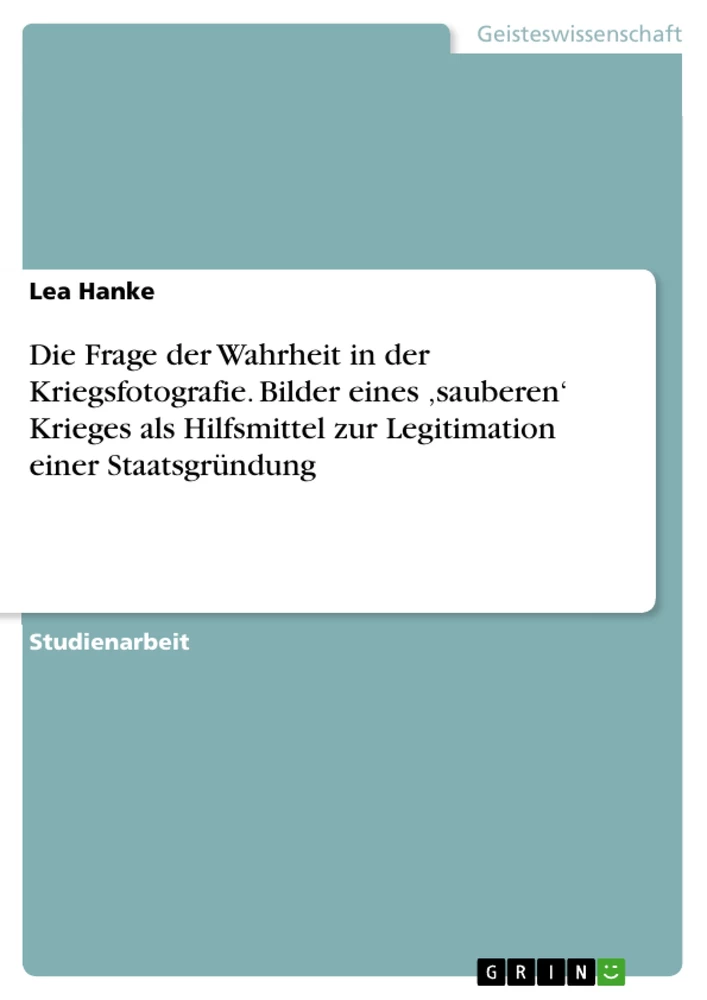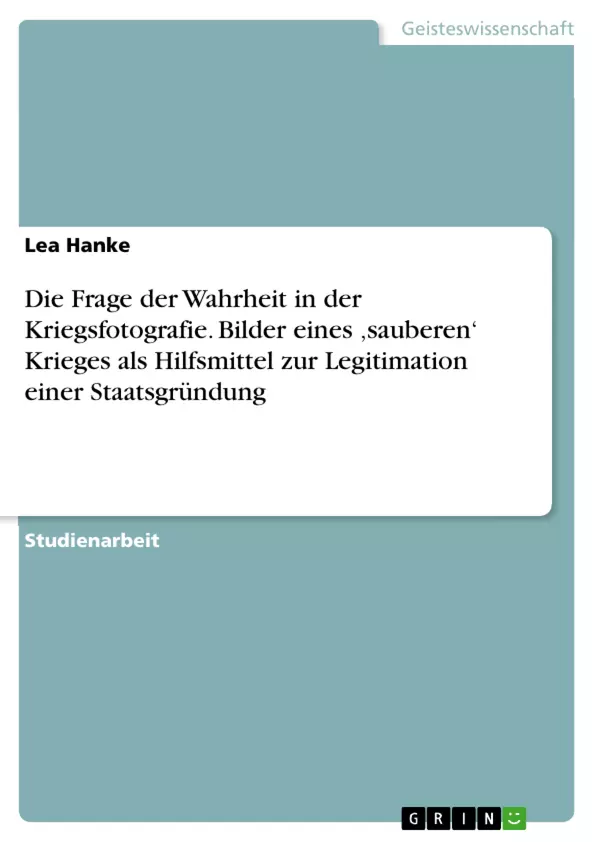Wenn wir an eine Kriegsfotografie denken, denken wir auch zugleich an grausame Bilder, auf denen verletzte Soldaten und Kriegsopfer abgebildet sind. Jedoch ist es erst seit dem Vietnamkrieg und der zugleich beginnenden Anti-Kriegsbewegung üblich, die harte Realität des Krieges zu zeigen. Zuvor in den Kriegen, genau genommen seit Beginn der Fotografie, wurde es hingegen vermieden diese grauenhaften Zustände im Krieg abzubilden. Aber warum war dies so? Dieser Frage – weshalb ein Kriegsbild keinen ‚wahren‘ Krieg abbildet – soll im Folgenden nachgegangen werden.
Dafür wird die Methode der Bildsegmentanalyse nach Roswitha Breckner angewendet. Diese Methode wird zunächst vorgestellt und anschließend folgt die Analyse eines Kriegsbildes. Als Fotografie wurde das Bild die „Düppeler Schanzen“ von Friedrich Brandt aus dem Jahre 1864 ausgewählt. Das Bild gehört zu den ersten Kriegsfotografien Europas, nach dem Krimkrieg und dem Amerikanischen Bürgerkrieg, und ist im Deutsch-Dänischen Krieg entstanden. Nach der Analyse folgt eine Einordnung in den historischen Kontext und die Fragestellung wird beantwortet. Im Fazit werden die Ergebnisse noch einmal festgehalten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Bildsegmentanalyse nach Roswitha Breckner
- Die Bildsegmentanalyse des Bildes „Düppeler Schanzen“
- Der Weg des Blickes und erste Eindrücke
- Die ikonische Darstellung
- Die Beschreibung und Interpretation der Bildsegmente
- Das erste Bildsegment
- Das zweite Bildsegment
- Das dritte Bildsegment
- Das vierte Segment
- Die Kombination der Bildsegmente
- Kombination des ersten und zweiten Bildsegments
- Die Kombination des dritten und vierten Segments
- Die Interpretation des Gesamtbildes
- Die perspektivische Projektion und die planimetrische Komposition
- Einordnung in einen historischen Kontext
- Die Uniformen der Soldaten
- Bestimmung des Krieges von der Fotografie
- Die Darstellung des sauberen Krieges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Kriegsfotografien keinen ‚wahren‘ Krieg abbilden. Dazu wird die Methode der Bildsegmentanalyse nach Roswitha Breckner angewandt, um ein Kriegsbild aus dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 zu analysieren. Ziel ist es, zu zeigen, wie die Fotografie als Medium eingesetzt wurde, um eine bestimmte Perspektive auf den Krieg zu konstruieren.
- Bildsegmentanalyse als Methode zur Interpretation von Kriegsfotografien
- Die Inszenierung des Kriegsbildes „Düppeler Schanzen“
- Der Einfluss von technischen und politischen Rahmenbedingungen auf die Darstellung von Krieg in Fotografien
- Die Rolle der Fotografie in der Konstruktion von nationalem Stolz und politischer Legitimation
- Die Darstellung eines ‚sauberen‘ Krieges als Mittel zur Manipulation der öffentlichen Meinung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Kriegsfotografie und die Bedeutung der Bildsegmentanalyse nach Roswitha Breckner. Anschließend wird die Methode anhand des Bildes „Düppeler Schanzen“ angewendet, wobei die Bildsegmente einzeln und in Kombination analysiert werden, um zu verschiedenen Lesarten und Interpretationen zu gelangen. Im Kapitel 4 wird das Bild in einen historischen Kontext eingeordnet, indem die Uniformen der Soldaten bestimmt und der Krieg, in dem die Fotografie entstanden ist, identifiziert wird. Das Kapitel 5 befasst sich mit der Darstellung des ‚sauberen‘ Krieges in der Fotografie des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie die Fotografie als Instrument zur Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt wurde.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kriegsfotografie, Bildsegmentanalyse, Inszenierung, Deutsch-Dänischer Krieg, Düppeler Schanzen, Friedrich Brandt, ‚sauberer‘ Krieg, Propaganda, nationaler Stolz, politische Legitimation
Häufig gestellte Fragen
Warum zeigten frühe Kriegsfotografien keine Toten?
Bis zum Vietnamkrieg war es üblich, die Grausamkeiten auszublenden, um den Krieg als „sauber“, heroisch und politisch legitim darzustellen.
Was ist die Bildsegmentanalyse nach Roswitha Breckner?
Dies ist eine Methode zur Interpretation von Bildern, bei der das Foto in Segmente unterteilt wird, um den Blickweg, die Komposition und verschiedene Bedeutungsebenen systematisch zu erschließen.
Was zeigt das Foto „Düppeler Schanzen“ von 1864?
Das Bild zeigt preußische Soldaten nach dem Sieg im Deutsch-Dänischen Krieg. Es ist eine der ersten Kriegsfotografien Europas und dient als Beispiel für eine inszenierte Darstellung.
Wie wurde Fotografie zur Legitimation von Staatsgründungen genutzt?
Bilder von ordentlichen, siegreichen Soldaten stärkten den nationalen Stolz und rechtfertigten politische Bestrebungen (wie die deutsche Einigung) durch eine ästhetisierte Darstellung des Militärs.
Was versteht man unter einem „sauberen Krieg“ in der Fotografie?
Es bezeichnet eine Darstellungsweise, die Leid, Schmutz und Tod ausspart und stattdessen Ordnung, Disziplin und technisches Gerät in den Vordergrund rückt.
Welchen Einfluss hatten technische Rahmenbedingungen damals?
Lange Belichtungszeiten machten Schnappschüsse von Kampfhandlungen unmöglich. Daher sind frühe Kriegsbilder oft statisch und nachgestellt (inszeniert).
- Quote paper
- Lea Hanke (Author), 2015, Die Frage der Wahrheit in der Kriegsfotografie. Bilder eines ‚sauberen‘ Krieges als Hilfsmittel zur Legitimation einer Staatsgründung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313408