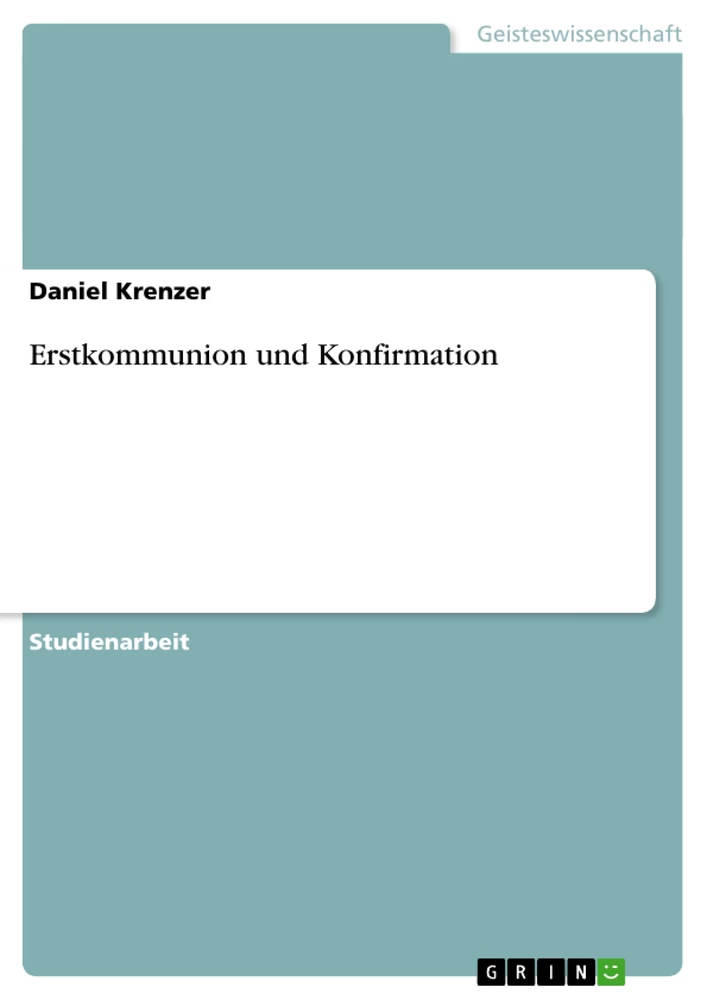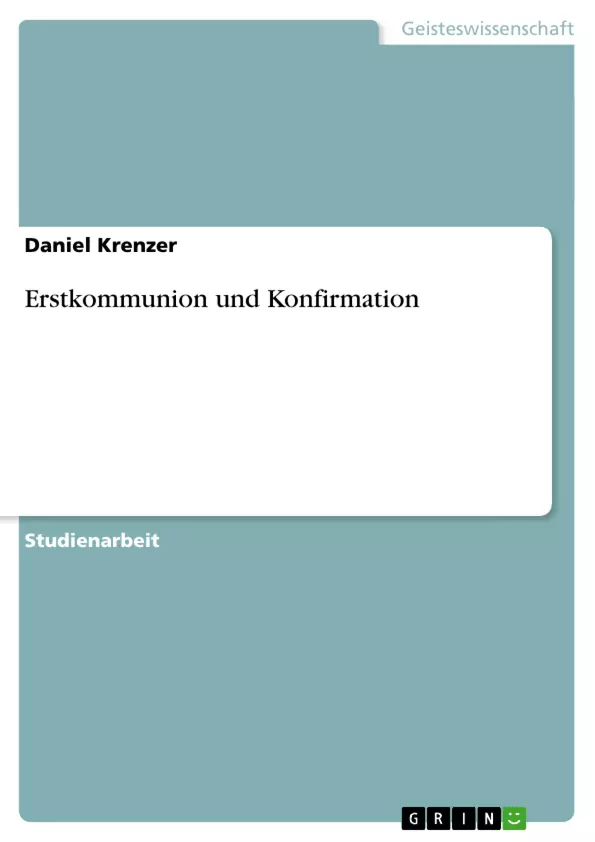Die Hausarbeit soll sich mit den beiden christlichen Festen der Erstkommunion und Konfirmation beschäftigen. Dabei ist aber nicht der religiöse Hintergrund der Schwerpunkt, sondern die Bräuche und Rituale, die die beiden Feste erst zu dem machen, was sie sind. Natürlich müssen dazu erst einmal die katholische Erstkommunion und die evangelische Konfirmation in ihrer Entstehungsgeschichte und dem religiösen Verständnis heraus vorgestellt werden.
Anschließend werde ich genauer auf die Bräuche und Rituale zu sprechen kommen, die sich im Laufe der Zeit an die beiden Feste angelagert haben und diese miteinander vergleichen. Neben weit verbreiteten Bräuchen werde ich auch auf speziellere, nur regional bekannte eingehen. Auch solche, die früher allgemein bekannt waren, heute aber keine Rolle mehr spielen, will ich vorstellen.
Im Kapitel 4 werde ich das Patentum, das in beiden Konfessionen eine große Rolle spielt, in erster Linie in Bezug auf Erstkommunion und Konfirmation vorstellen sowie Überschneidungen und Differenzen herausarbeiten. Zum Abschluss werde ich einige Beispiele aus dem Handbuch des deutschen Aberglaubens rund um den Weißen Sonntag kurz vorstellen.
Neben der in der Bibliographie genannten Literatur dienten mir mehrere Gespräche mit evangelischen Christen über ihre Erfahrungen mit der eigenen Konfirmation als Quellen, da ich als Katholik natürlich nur einseitig eigene Erfahrungen sammeln konnte. Vereinzelte Angaben beruhen zudem auf eigenen Erfahrungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Religiöser und gesellschaftlicher Hintergrund
- 2.1 Die katholische Erstkommunion
- 2.2 Die evangelische Konfirmation
- 3. Bräuche und Rituale im Rahmen der Feierlichkeiten
- 4. Das Patentum
- 5. Aberglaube rund um den Weißen Sonntag
- 6. Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bräuche und Rituale der katholischen Erstkommunion und der evangelischen Konfirmation. Der Fokus liegt weniger auf den religiösen Hintergründen, sondern auf den gesellschaftlichen Praktiken, die diese Feste prägen. Die Arbeit vergleicht die Bräuche beider Konfessionen und beleuchtet sowohl weit verbreitete als auch regionale Besonderheiten, inklusive solcher, die früher Bedeutung hatten, heute aber verschwunden sind.
- Vergleich der Bräuche und Rituale der Erstkommunion und Konfirmation
- Historische Entwicklung und religiöses Verständnis beider Feste
- Regionale Variationen und der Wandel der Traditionen
- Die Rolle des Patenamtes in beiden Konfessionen
- Aberglaube im Zusammenhang mit dem Weißen Sonntag
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Bräuche und Rituale der Erstkommunion und Konfirmation, anstatt auf die rein religiösen Aspekte. Es wird angekündigt, dass die Arbeit die Entstehung und das religiöse Verständnis beider Feste beleuchten, die Bräuche vergleichen und sowohl weit verbreitete als auch regionale, eventuell vergangene Praktiken vorstellen wird. Besondere Beachtung findet das Patentum und der Aberglaube rund um den Weißen Sonntag.
2. Religiöser und gesellschaftlicher Hintergrund: Dieses Kapitel behandelt die geschichtlichen und religiösen Hintergründe der Erstkommunion und Konfirmation. Es beschreibt die Entwicklung der katholischen Erstkommunion ab dem Laterankonzil von 1215, wo die Trennung von Taufe und Abendmahl beschlossen wurde, und die Festlegung des Weißen Sonntags als gängigen Termin. Weiterhin wird die evangelische Konfirmation erläutert, die auf Martin Luther zurückgeht und als Kompromiss zwischen der Ablehnung der Firmung als Sakrament und der Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses im reiferen Alter entstand. Der Text vergleicht die Integration der Jugendlichen in die Gemeinde und die damit verbundenen Rechte in beiden Konfessionen.
3. Bräuche und Rituale im Rahmen der Feierlichkeiten: Dieses Kapitel (dessen Inhalt im Ausgangstext fehlt) würde einen detaillierten Vergleich der Bräuche und Rituale beider Feste beinhalten. Dies würde die konkreten Praktiken, wie beispielsweise die Kleidung, die Feierlichkeiten selbst, und die damit verbundenen Traditionen umfassen. Ein Vergleich der regionalen Unterschiede und der Entwicklung dieser Bräuche im Laufe der Zeit wäre zentral.
4. Das Patentum: Dieses Kapitel (dessen Inhalt im Ausgangstext fehlt) würde sich mit der Rolle des Patenamtes bei der Erstkommunion und Konfirmation auseinandersetzen. Es würde die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konfessionen im Hinblick auf die Aufgaben und die Bedeutung des Paten untersuchen und möglicherweise auch historische Entwicklungen beleuchten.
5. Aberglaube rund um den Weißen Sonntag: Dieses Kapitel (dessen Inhalt im Ausgangstext nur angedeutet wird) würde sich mit dem Aberglauben im Zusammenhang mit dem Weißen Sonntag befassen. Es würde verschiedene Aberglaubenstraditionen vorstellen, ihre Verbreitung und mögliche regionale Variationen analysieren und gegebenenfalls ihre historische Entwicklung nachzeichnen.
Schlüsselwörter
Erstkommunion, Konfirmation, katholische Kirche, evangelische Kirche, Bräuche, Rituale, Weiße Sonntag, Patentum, Jugendübergangsrituale, religiöse Traditionen, gesellschaftliche Praktiken, regionale Variationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Katholische Erstkommunion und Evangelische Konfirmation
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Bräuche und Rituale der katholischen Erstkommunion und der evangelischen Konfirmation. Der Fokus liegt dabei weniger auf den rein religiösen Aspekten, sondern auf den gesellschaftlichen Praktiken und Traditionen, die diese Feste prägen. Verglichen werden die Bräuche beider Konfessionen, einschließlich regionaler Besonderheiten und historischer Entwicklungen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Bräuche und Rituale von Erstkommunion und Konfirmation; historische Entwicklung und religiöses Verständnis beider Feste; regionale Variationen und der Wandel der Traditionen; die Rolle des Patenamtes in beiden Konfessionen; Aberglaube im Zusammenhang mit dem Weißen Sonntag.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Religiöser und gesellschaftlicher Hintergrund (einschließlich der Einzelheiten zu Erstkommunion und Konfirmation); Bräuche und Rituale im Rahmen der Feierlichkeiten; Das Patentum; Aberglaube rund um den Weißen Sonntag; Zusammenfassung und Schlusswort.
Wie wird der religiöse und gesellschaftliche Hintergrund behandelt?
Das Kapitel zum religiösen und gesellschaftlichen Hintergrund beschreibt die geschichtlichen und religiösen Hintergründe beider Feste. Es beleuchtet die Entwicklung der katholischen Erstkommunion ab dem Laterankonzil von 1215 und die Entstehung der evangelischen Konfirmation im Kontext der reformatorischen Bewegung. Der Vergleich der Integration der Jugendlichen in die Gemeinde und die damit verbundenen Rechte in beiden Konfessionen wird ebenfalls angesprochen.
Was wird im Kapitel "Bräuche und Rituale" behandelt?
Dieses Kapitel (dessen detaillierter Inhalt im vorliegenden Text fehlt) wird einen detaillierten Vergleich der Bräuche und Rituale beider Feste bieten, inklusive Kleidung, Feierlichkeiten und Traditionen. Regionale Unterschiede und die Entwicklung dieser Bräuche im Laufe der Zeit werden analysiert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zum Patentum?
Das Kapitel zum Patentum (dessen detaillierter Inhalt im vorliegenden Text fehlt) wird die Rolle des Patenamtes bei der Erstkommunion und Konfirmation untersuchen. Es wird Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konfessionen bezüglich der Aufgaben und Bedeutung des Paten beleuchten und möglicherweise auch historische Entwicklungen berücksichtigen.
Was ist der Inhalt des Kapitels zum Aberglauben?
Das Kapitel zum Aberglauben (dessen Inhalt im vorliegenden Text nur angedeutet wird) wird verschiedene Aberglaubenstraditionen rund um den Weißen Sonntag vorstellen. Es wird ihre Verbreitung, regionale Variationen und gegebenenfalls ihre historische Entwicklung analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Erstkommunion, Konfirmation, katholische Kirche, evangelische Kirche, Bräuche, Rituale, Weißer Sonntag, Patentum, Jugendübergangsrituale, religiöse Traditionen, gesellschaftliche Praktiken, regionale Variationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist ein Vergleich der Bräuche und Rituale der katholischen Erstkommunion und der evangelischen Konfirmation mit Fokus auf die gesellschaftlichen Praktiken. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung und das religiöse Verständnis beider Feste, regionale Variationen und den Wandel der Traditionen. Besondere Beachtung finden das Patentum und der Aberglaube rund um den Weißen Sonntag.
- Citar trabajo
- Daniel Krenzer (Autor), 2004, Erstkommunion und Konfirmation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31355