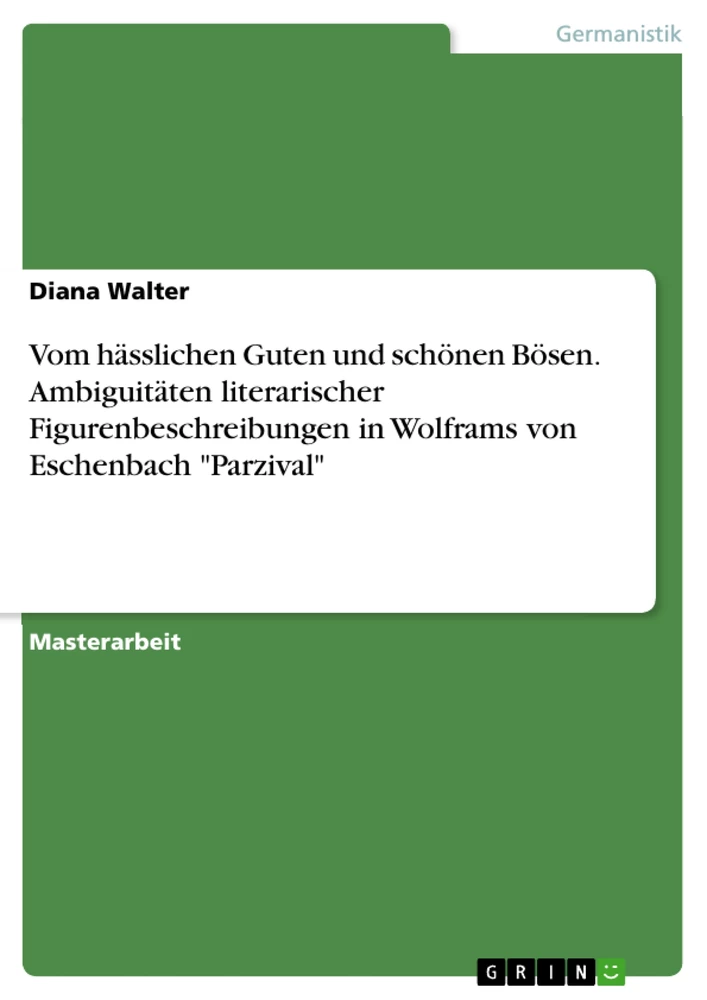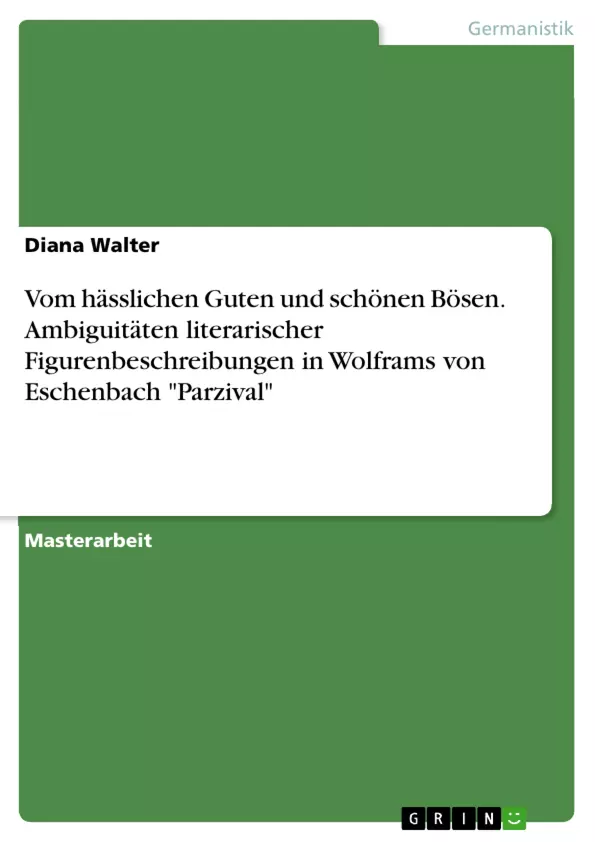Tatsächlich begegnet dem Rezipienten nur selten eine missgestaltete Person. Auf umgekehrte Weise scheint sich in diesen wenigen Fällen auch wieder das scholastische Prinzip zu bestätigen. Die hässliche Gestalt wird als moralisch verwerflich inszeniert. Man denke nur an den unverschämten Zwerg im „Erec“ oder an den bedrohlich wirkenden Waldmenschen im „Iwein“. Mithin verwundert die moderne
Auffassung, Gestalten in der mittelalterlichen Literatur seien nicht mehr als Stereotypen, überhaupt nicht. Eine ideale höfische Welt grenzt sich von der schlechten Sphäre des
Bäurischen ab. Allerdings vernachlässigt diese Strukturierung all jene Romanfiguren, welche dem Axiom widersprechen. Ganz besonders werden derartige Abweichungen im „Parzival“ ersichtlich. Der Protagonist wird zwar als schönster Mann seit Adams Lebzeiten beschrieben.
Sein Verhalten ist aber an vielen Stellen moralisch fragwürdig. Parzival versündigt sich sogar mehrere Male. Eine andere Figur des Romans besitzt Wildschwein ähnliche Zähne sowie schwarzes, stumpfes Haar. Gleichwohl hat die Gralsbotin Cundrie die septem artes liberales studiert und beherrscht drei Sprachen. Die Aufzählung ließe sich mit Orgeluse, Malcreatiure
und anderen fortsetzen.
Diese Ambiguitäten der Figurenbeschreibung in Wolframs Erzählung sind eigentlich bekannt.
Dennoch wurde der Untersuchung des Außen-Innen-Diskurses in der höfischen Literatur bisher zu wenig Beachtung geschenkt. Studien beschäftigen sich entweder mit der äußerlichen oder innerlichen Präsentation von Romangestalten. Dabei ist doch gerade die Auseinandersetzung mit Problemfeldern abseits von vermeintlichen Leitbildern spannend. Wie korreliert die Körperdarstellung mit der charakterlichen Inszenierung? Welchem Faktor wird mehr
Bedeutung zugemessen und woran lässt sich dies erkennen?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Schönheit und Hässlichkeit im philosophischen Diskurs des Mittelalters
- 3. Schönheit und Hässlichkeit im literarischen Diskurs des Mittelalters
- 3.1 Schönheit, Tugend und Adel
- 3.2 Hässlichkeit, Lasterhaftigkeit und „Unhöfischheit“
- 3.3 Hässliches Gutes – schönes Böses?
- 4. Zur Methodik: Erzählstimme und Fokalisierung
- 5. Parzival Das schöne Böse?
- 5.1 Die ambige Konzeption der Figur
- 5.2 Schönheit, Genealogie und impliziertes Gut-Sein: Parzivals „art“
- 5.3 Kindheit und Erziehung in Soltane
- 5.3.1 Tägliche Routinen
- 5.3.2 Parzivals erster Kontakt mit der höfischen Sphäre
- 5.4 Parzivals Irrwege
- 5.4.1 Jeschutes Schändung
- 5.4.2 Erstes Treffen mit Sigune: Restauration der inneren Idealität
- 5.4.3 Höfische Erziehung
- 5.4.4 Vorläufige Harmonie von Innen und Außen in Pelrapeire
- 5.4.5 Zusammenbruch des Scheins: Parzivals Frageversäumnis
- 5.4.6 Ithers Ermordung
- 5.5 Nach dem Frageversäumnis – Klimax der Ambiguitäten
- 5.5.1 Der Gralsknappe
- 5.5.2 Sigune und Jeschute: Anklage, Rechtfertigung und Reue
- 5.5.3 Erzähler vs. Figur oder Absolute Ambiguität
- 5.5.4 Parzivals Gotteshass
- 5.6 Entkörperlichung
- 5.6.1 Dezimierte Schönheitslobe und Stilisierung von Tugenden
- 5.6.2 ,,ich bin ein man der sünde hât“ – Formelle Aufhebung der Ambiguität
- 5.6.3 Parzivals Erhebung zum Gralskönig als Zeichen innerer Wandlung?
- 6. Cundrie Das hässliche Gute?
- 6.1 ,,Die unsüeze und doch diu fiere“
- 6.1.1 Eindimensionalität und Negativierung
- 6.1.2 Charakterliche Inszenierung
- 6.2 Exkurs: Malcreatiure, Adam und der Ursprung von Hässlichkeit
- 6.3 Abnehmende Ambiguität
- 6.4 Parzivals Patronin und Botschafterin
- 6.1 ,,Die unsüeze und doch diu fiere“
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die mehrdeutige Konzeption von Figurenbeschreibungen in Wolframs von Eschenbachs „Parzival“ hinsichtlich der klassischen Dichotomie hässlich/böse und schön/gut. Sie analysiert die Figur des Parzival und die Gralsbotin Cundrie, um herauszuarbeiten, wie die unterschiedlichen Ebenen von narrativer Stimme und Wahrnehmungsperspektiven diese Dichotomie in Frage stellen.
- Ambiguität der Figurenbeschreibungen in Wolframs „Parzival“
- Korrelation von Körperdarstellung und charakterlicher Inszenierung
- Analyse der Figuren Parzival und Cundrie
- Ebenen von narrativer Stimme und Wahrnehmungsperspektiven
- Überprüfung des klassischen Dichotomie hässlich/böse und schön/gut
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Figurenbeschreibungen in Wolframs „Parzival“ einführt und die Forschungsfrage formuliert. Das zweite Kapitel beleuchtet den philosophischen Diskurs über Schönheit und Hässlichkeit im Mittelalter. Das dritte Kapitel analysiert die literarische Darstellung von Schönheit und Hässlichkeit in höfischen Romanen. Das vierte Kapitel stellt die methodische Grundlage der Arbeit vor. Kapitel 5 untersucht die Figur des Parzivals und seine Ambiguität in Bezug auf Schönheit und Moral. Kapitel 6 analysiert die Figur der Cundrie und ihren Kontrast zwischen äußerer Hässlichkeit und innerer Weisheit. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Schönheit, Hässlichkeit, Ambiguität, Figurenbeschreibung, narrative Stimme, Wahrnehmungsperspektiven, höfische Literatur, Wolfram von Eschenbach, „Parzival“, Parzival, Cundrie. Sie analysiert die Figuren und ihre Darstellung in Bezug auf die klassische Dichotomie hässlich/böse und schön/gut.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Schönheit und Moral in Wolframs „Parzival“ zusammen?
Eigentlich galt im Mittelalter: Schön ist gut, hässlich ist böse. Wolfram bricht dies jedoch auf, indem er den schönen Parzival moralisch fragwürdig handeln lässt und die hässliche Cundrie als weise und tugendhaft darstellt.
Wer ist Cundrie und warum ist sie eine ambivalente Figur?
Cundrie ist die Gralsbotin, die äußerlich extrem hässlich (mit Wildschweinzähnen) beschrieben wird, aber hochgebildet ist, drei Sprachen beherrscht und die septem artes liberales studiert hat.
Warum wird Parzival als „schönes Böses“ bezeichnet?
Obwohl Parzival als schönster Mann seit Adam gilt, begeht er schwere Sünden, wie die Ermordung Ithers oder das Versäumnis der Mitleidsfrage auf der Gralsburg.
Was bedeutet der „Außen-Innen-Diskurs“ in der höfischen Literatur?
Es ist die Untersuchung der Korrelation zwischen der körperlichen Erscheinung (Außen) und der charakterlichen bzw. moralischen Verfassung (Innen) einer literarischen Figur.
Was ist das Ziel von Parzivals „Entkörperlichung“ am Ende des Romans?
Am Ende tritt das Lob seiner Schönheit zurück und seine Tugenden werden stilisiert. Dies symbolisiert seine innere Wandlung und Reife zum Gralskönig.
- Quote paper
- Diana Walter (Author), 2015, Vom hässlichen Guten und schönen Bösen. Ambiguitäten literarischer Figurenbeschreibungen in Wolframs von Eschenbach "Parzival", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313579