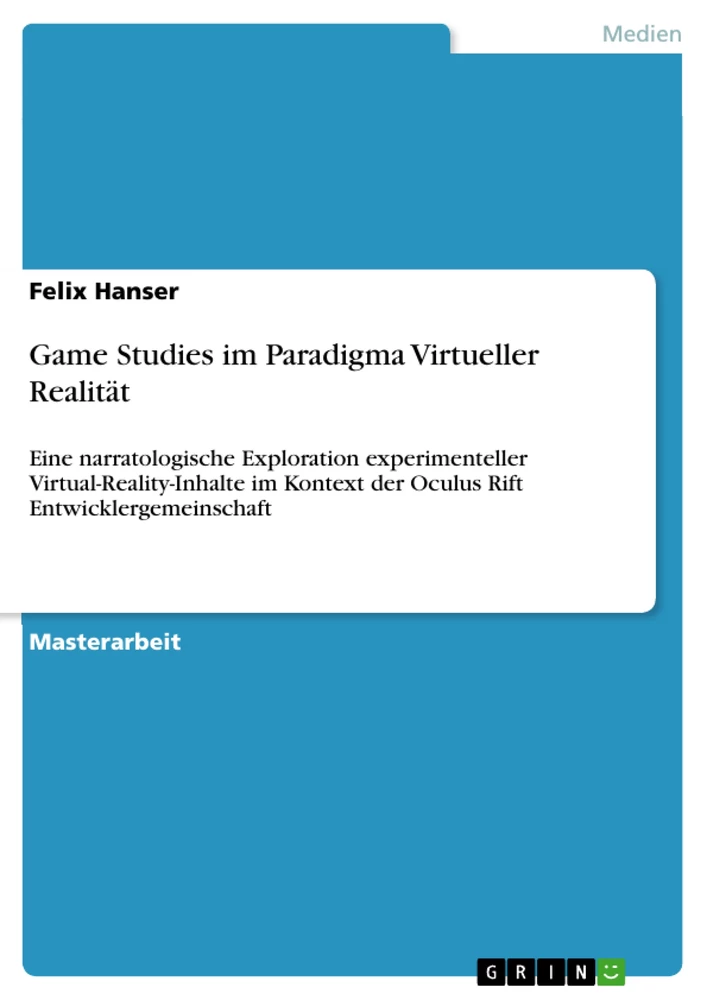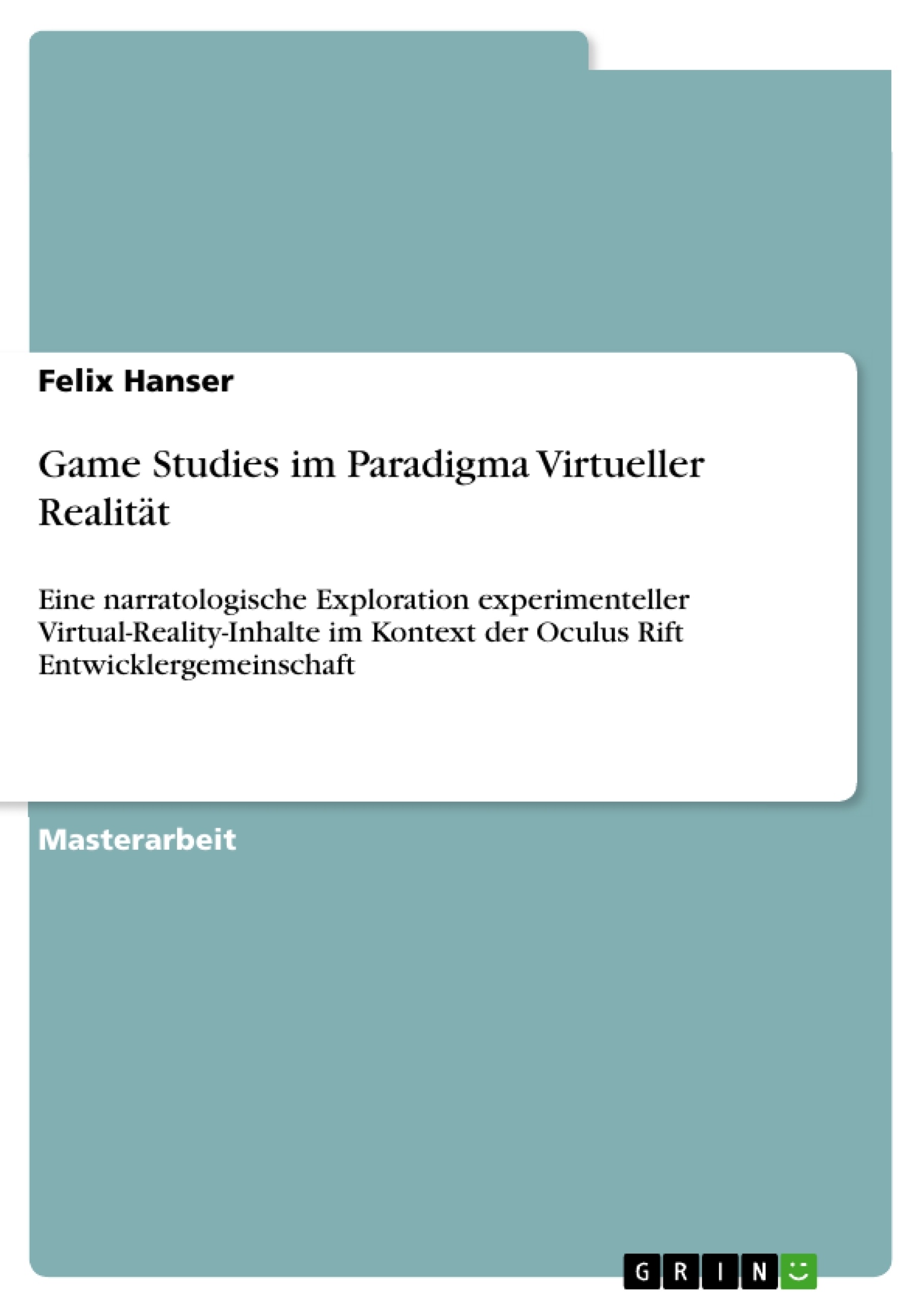Die Computertechnologie Virtual Reality (VR) steht kurz vor ihrer Kommerzialisierung und verspricht die alltägliche Verfügbarkeit einer neuartigen Medienerfahrung, die es erlaubt, sich mithilfe neuer Displaytechnik und der sensorischen Verfolgung von Nutzerbewegungen auf realistische Weise in einer virtuellen Umgebung zu bewegen. In diesem Zusammenhang erfahren in jüngster Zeit kommerzielle Datenbrillen bzw. VR-Brillen (Head-Mounted Display, kurz: HMD) öffentliche Aufmerksamkeit.
Mediengeschichtlich betrachtet, handelt es sich um die Einführung einer neuen Mediengattung, deren global-gesellschaftlichen Auswirkungen zwar theoretisch von verschiedenen Wissenschaftlern beschworen werden (vgl. Bühl, 2000; Faßler, 2008), aber empirisch erst noch explizit erforscht werden müssen. Theoretisch ist beispielsweise die Rede davon, dass sich in den kommenden Jahren durch VR-Technologie der „technologische Kern unserer Gesellschaft“ (Bühl, 2000: 17) erneut verändern wird.
Im Allgemeinen wird in dieser Abschlussarbeit ein Teil dieses sich anbahnenden sozialen Wandels durch die gesellschaftliche Institutionalisierung von Virtual Reality-Technologie als potenzielles Massenmedium aus der Perspektive der Medien- und Kommunikationswissenschaft untersucht. Genauer leistet die Abschlussarbeit einen ersten, an zeitgenössischer Erfahrung orientierten Beitrag dazu, diese neue Medienform anhand ihrer gegenwärtig öffentlich bzw. kommerziell verfügbaren Medieninhalte zu untersuchen und davon ausgehend mögliche Ausgestaltungen der weiterführenden Etablierung dieser Medientechnologie aufzeigen.
Dazu werden veröffentlichte Inhalte in Form von Softwareangeboten für die Oculus Rift VR, eine der ersten kommerziellen VR-Brillen, untersucht. Genauer sollen anhand veröffentlichter Inhalte die Möglichkeiten und Grenzen des Erzählens, der Narrativität, kommerzieller VR-Technik erforscht und Rückschlüsse auf Virtual Reality als potenzielles Unterhaltungsmedium ermöglicht werden. Im Besonderen werden hier die noch nicht konventionalisierten inhaltlichen und gestalterischen Spezifikationen aus einer erzähltheoretischen Perspektive untersucht, welche sich mit einer, der Gegenstandsangemessenheit geschuldeten, transdisziplinären Theorieauswahl bedient.
Eine explorative Online-Befragung zur Nutzung und Rezeption von VR-Inhalten für die Oculus Rift (DK2) bildet dabei eine empirische Grundlage der am Medieninhalt orientierten Studie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Abschlussarbeit
- Virtuelle Realität als Desiderat der Medien- und Kommunikationswissenschaft
- Definition und thematische Einordnung von Virtual Reality
- Institutionalisierung von Virtual Reality durch die Unterhaltungsindustrie
- Die Wirklichkeit kommerzieller Head-Mounted Displays
- Von First-Person Games zu Virtual Reality
- Aktuelle VR-Technik am Beispiel der Oculus Rift als Platform und VR-Display
- Die Hardware des Oculus Rift VR Developer Kit 2
- VR-Spezifische Erzähltheorien mit Blick auf Interactive Storytelling
- Narratologie und Virtual Reality
- Erzähltheorie im Kontext der Computerspielforschung
- Computerspiele aus der Perspektive intratextueller Erzähltheorie
- Computerspiele aus der Perspektive transmedialer Erzähltheorie
- Explorative Online-Befragung zur Nutzung der Oculus Rift
- Explorative Online-Befragung zur Software-Entwicklung für die Oculus Rift
- Motion Sickness als Einschränkung für VR-Inhalte
- Narratologische Computerspielanalyse nach Markus Engelns
- Computerspiele als Software mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten
- Die Rolle des Spielers
- Narrativität als Konstrukt im Schnittbereich zwischen Spiel und Spieler
- Differenzierung der Elemente des Computerspiels mit Realisierungsebenen
- Vermittlungsdreieck - Interaktion von Einzelelementen zwischen den Realisierungsebenen
- Elemente narrativer Rezeptionsangebote zur Realisierung von Narrativität
- Analyse: Narrative Typisierung von Asunder als Computerspiel
- Begründung der Auswahl des Untersuchungsgegenstands
- Lineare Beschreibung des Spielverlaufs
- Anwendung des analytischen Fragebogens von Markus Engelns
- Figuration der Typologie
- Analysefazit
- Elemente narrativer Rezeptionsangebote als VR-Inhalt im Verhältnis von Narration, Simulation und Interaktion
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der narratologischen Erforschung experimenteller Virtual-Reality-Inhalte im Kontext der Oculus Rift Entwicklergemeinschaft. Ziel ist es, die Potenziale und Herausforderungen von Virtual Reality für das Storytelling zu untersuchen und anhand einer Analyse des VR-Spiels "Asunder" ein tiefergehendes Verständnis von der narrativen Gestaltung von Virtual-Reality-Erlebnissen zu entwickeln.
- Die Rolle von Virtual Reality in der Medien- und Kommunikationswissenschaft
- Die Entwicklung der VR-Technologie und die Bedeutung der Oculus Rift
- Narrative Konzepte und ihre Anwendung im Kontext von Computerspielen
- Die Analyse von "Asunder" als VR-Spiel und die Untersuchung der Interaktion von Narration, Simulation und Interaktion
- Das Potenzial von Virtual Reality für das interaktive Erzählen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Virtual Reality für die Medien- und Kommunikationswissenschaft dar, definiert den Begriff "Virtual Reality" und beleuchtet die Institutionalisierung von Virtual Reality durch die Unterhaltungsindustrie.
- Die Wirklichkeit kommerzieller Head-Mounted Displays: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Virtual-Reality-Technologie und der Bedeutung des Oculus Rift als Platform und VR-Display. Es werden die Hardwarekomponenten des Oculus Rift VR Developer Kit 2 beschrieben und die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Mediums Virtual Reality für das Storytelling diskutiert.
- Narratologie und Virtual Reality: Das Kapitel widmet sich der Anwendung narrativer Theorien im Kontext von Computerspielen und Virtual Reality. Es werden verschiedene Ansätze der Computerspielforschung vorgestellt und der Einfluss von Virtual Reality auf die erzählerische Gestaltung von Computerspielen untersucht.
- Narratologische Computerspielanalyse nach Markus Engelns: Hier wird die Methode der narratologischen Computerspielanalyse von Markus Engelns vorgestellt und deren Anwendung in Bezug auf Virtual-Reality-Inhalte erläutert. Es werden die wichtigsten Elemente der Computerspielanalyse, wie die Rolle des Spielers, die Narrative und die Interaktion von Spiel und Spieler, im Detail betrachtet.
- Analyse: Narrative Typisierung von Asunder als Computerspiel: In diesem Kapitel wird das VR-Spiel "Asunder" anhand der Methode von Markus Engelns analysiert. Die narrative Typisierung von "Asunder" wird anhand der Handlung, der Figuren, der Spielwelt und der Interaktion des Spielers mit der Spielumgebung erörtert.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Game Studies, der Virtual-Reality-Forschung und der Narratologie. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Virtual Reality, Oculus Rift, Head-Mounted Displays, Narratologie, Computerspielforschung, Interactive Storytelling, Interaktion, Simulation, Immersion, Motion Sickness, "Asunder" und Markus Engelns.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Abschlussarbeit?
Die Arbeit untersucht Virtual Reality (VR) als neues Massenmedium aus der Perspektive der Narratologie und Computerspielforschung.
Welche VR-Hardware steht im Fokus der Untersuchung?
Die Studie konzentriert sich auf das Oculus Rift VR Developer Kit 2 (DK2) als eine der ersten kommerziell verfügbaren VR-Brillen.
Welches VR-Spiel wurde für die Analyse herangezogen?
Das Spiel „Asunder“ wurde ausgewählt, um die Möglichkeiten und Grenzen des Erzählens in der virtuellen Realität zu erforschen.
Was versteht man unter „Motion Sickness“ im VR-Kontext?
Es beschreibt die Übelkeit, die durch Diskrepanzen zwischen visueller Wahrnehmung und körperlicher Bewegung in VR entstehen kann und die Inhaltsgestaltung einschränkt.
Welche Methode wurde zur Analyse der VR-Inhalte verwendet?
Es wurde die narratologische Computerspielanalyse nach Markus Engelns angewendet, die das Zusammenspiel von Spiel, Spieler und Narrativität betrachtet.
- Quote paper
- Felix Hanser (Author), 2015, Game Studies im Paradigma Virtueller Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313639